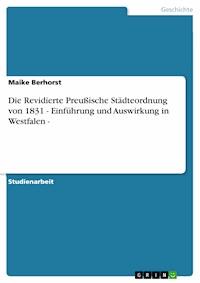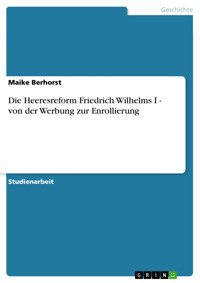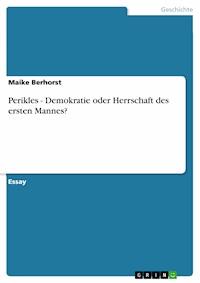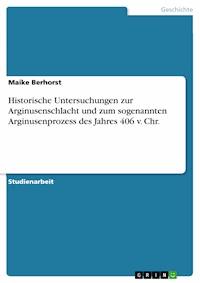36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Geschichte - Sonstiges, Note: 1,3, Universität Münster, Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie sich im Laufe des 9. Jahrhunderts der Kontakt zwischen Dänen und Franken in Friesland entwickelte. In dieser Gegend kann seit den 820er Jahren eine längerfristige Ansiedlung dänischer Anführer innerhalb des fränkischen Landes beobachtet werden, wenn auch diese meistens fränkischer Oberhoheit unterworfen waren. Was führte die Dänen in das Frankenreich und gerade nach Friesland? Welche Hintergründe hatte es, dass Mitglieder eines dänischen Königsgeschlechts zu fränkischen Lehnsmännern wurden und damit sogar in das Reichssystem eingegliedert wurden? Warum ließen die fränkischen Herrscher diese Fremden in ihrem Reich zu, d.h. welche Vorteile versprachen sie sich hiervon? Die kommenden Überlegungen folgen einer chronologischen Gliederung, beginnend mit König Godfrid Anfang des 9. Jahrhundert, welcher als erster bekannter Däne politische Interessen im Norden des Frankenreiches zu vertreten schien. Nachfolgend richtet sich der Blick auf weitere Dänen, deren Weg sie aus kriegerischen oder politischen Gründen nach Friesland führte und sie damit in Kontakt zu den fränkischen Herrschern treten ließ. Der letzte Däne, der mit Friesland in Verbindung stand, starb im Jahre 885. Damit endet schließlich die für diese Arbeit interessante Periode dänischer Herrschaft im Frankenreich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
Westfälische Wilhelms- Universität Münster
Historisches Seminar
Schriftliche Hausarbeit
Friesland zwischen Franken und Dänen
im 9. Jahrhundert
Page 1
I. Einleitung
„GütigerGott, schütze uns vor der Wut der Nordmänner“- so oder ähnlich klangen die Gebete der fränkischen Küstenbewohner seit dem Beginn des 9. Jahrhunderts. Gruppen dänischer Seefahrer hatten begonnen, mit ihren schnellen, wendigen Schiffen den Norden des mächtigen Frankenreiches heimzusuchen. Siedlungen wurden geplündert und gebrandschatzt, deren Einwohner getötet oder als Geiseln fortgeführt. „Unddie Heiden werden sofort mit einer ungeheuren Anzahl von Schiffen über sie kommen und den größten Teil des christlichen Volkes und Landes nebst allem, was sie besitzen, mit Feuer und Schwert verwüsten.“1Vor allem für die Bewohner Frieslands schien diese Prophezeiung war zu werden. Die Männer aus dem Norden sollten in den folgenden achtzig Jahren die Geschicke dieses Landestriches mitbestimmen.
In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie sich im Laufe des 9. Jahrhunderts der Kontakt zwischen Dänen und Franken in Friesland entwickelte. In dieser Gegend kann seit den 820er Jahren eine längerfristige Ansiedlung dänischer Anführer innerhalb des fränkischen Landes beobachtet werden, wenn auch diese meistens fränkischer Oberhoheit unterworfen waren. Was führte die Dänen in das Frankenreich und gerade nach Friesland? Welche Hintergründe hatte es, dass Mitglieder eines dänischen Königsgeschlechts zu fränkischen Lehnsmännern wurden und damit sogar in das Reichssystem eingegliedert wurden? Warum ließen die fränkischen Herrscher diese Fremden in ihrem Reich zu, d.h. welche Vorteile versprachen sie sich hiervon?
Die kommenden Überlegungen folgen einer chronologischen Gliederung, beginnend mit König Godfrid Anfang des 9. Jahrhundert, welcher als erster bekannter Däne politische Interessen im Norden des Frankenreiches zu vertreten schien. Nachfolgend richtet sich der Blick auf weitere Dänen, deren Weg sie aus kriegerischen oder politischen Gründen nach Friesland führte und sie damit in Kontakt zu den fränkischen Herrschern treten ließ. Der letzte Däne, der mit Friesland in Verbindung stand, starb im Jahre 885. Damit endet schließlich die für diese Arbeit interessante Periode dänischer Herrschaft im Frankenreich.
1Annales Bertiniani, 839, in: Reinhold Rau (Übers.), Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte.
Zweiter Teil (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, FSGA Bd. 6), Darmstadt
1980, S. 43.
Page 2
Im Zuge dieser Überlegungen müssen zudem immer wieder die Geschehnisse in Dänemark selbst betrachtet werden. Hierbei soll vor allem ein möglicher Zusammenhang zwischen den dänischen Königen und den Überfällen auf das Frankenreich, insbesondere Friesland, untersucht werden. Zudem soll der Frage nachgegangen werden, ob es einen Unterschied in der Beurteilung der verschiedenen Dänen in der fränkischen Historiographie gab. Wurden die Dänen in Friesland, die zu fränkischen Lehnsmännern geworden waren, in einer Linie mit den plündernden “Wikingern“ bewertet oder wurden diese in einem anderen Licht betrachtet? Falls es notwendig erscheint, soll auch ein kurzer Blick auf die fränkische Innenpolitik geworfen werden.
Auf die in der Forschung viel diskutierte Frage nach den grundsätzlichen Ursachen der Normannenzüge in das Frankenreich und nach England soll nicht eingegangen werden. Genauso kann und soll nur ansatzweise, sofern es im Bezug auf die Fragestellung und damit auf Friesland sinnvoll erscheint, auf die Plünderungszüge der Normannen an den großen Flüssen im westfränkischen Reich eingegangen werden.
Die Quellenlage zu den Raubzügen der Normannen und ihrem Verhältnis zum Frankenreich ist sehr umfangreich, wenn auch einseitig. Über die so genannte „Wikingerzeit“ sind wir lediglich durch fränkische Quellen informiert, so dass naturgemäß die Gefahr besteht, ein verzerrtes Bild der Geschehnisse zu bekommen. Die schriftlichen, nordischen Quellen, wie Saxo Grammaticus oder auch die isländischen Sagas, stammen frühestens aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Für die Regierungszeit Karls des Großen stellen dieAnnales regni Francorum,die offiziellen fränkischen Reichsannalen, die zentrale historiographische Quelle dar. Schon seit den 770er Jahren, wenn auch verstärkt erst seit 804, zeigen diese Interesse für das benachbarte Dänemark. Berichtet wird stets mit fränkischem Blickwinkel über die politischen Ereignisse, dass meist jedoch sehr gut informiert. Ebenfalls muss für die Politik Karls des Großen EinhardsVita Karoli Magnierwähnt werden, welcher einen guten Einblick in die Verhältnisse am fränkischen Hof gewährt, allerdings sehr parteiisch schreibt. Für die Zeit ab der Mitte des 9. Jahrhunderts sind als offizielle Historiographie des Reiches die ausführlichen ostfränkischenAnnales Fuldenses,welche etliche Passagen den Normannen widmen, sowie dieAnnales Xantenseszu nennen, die besonders gut über die friesischen Verhältnisse informiert sind. Auf westfränkischer Seite entsprechen dem dieAnnales Bertiniani,welche eine Fortsetzung der 829 endenden Reichsannalen
Page 3
darstellen und ebenso viel über Normannen im fränkischen Reich zu berichten wissen. Bis zum Jahre 835 ist deren Verfasser unbekannt, von da an bis 861 ist es Prudentius, ein Kapellan am Hofe Ludwigs des Frommen, und bis zum Ende des Werkes, 882, schreibt der Bischof Hinkmar von Reims. Allein dies spricht schon für die genaue Informiertheit dieser Quelle.
Vor allem für die fränkisch-normannischen Beziehungen im späten 9. Jahrhundert kann dasChroniconeines Mönches namens Regino aus dem Kloster Prüm herangezogen werden, ebenso wie dieAnnales Vedastini,in denen ein Mönch aus dem Kloster St. Vaast bei Arras von 873 bis 899 unter anderem über die Normanneneinfälle schreibt. Neben Annalen und Chroniken sind auch hagiographische Quellen für das Verhältnis zwischen Franken und Normannen hinzuzuziehen. Hierbei spielt vor allem die besondere Gattung der Translationsberichte eine Rolle, auch wenn diese für Friesland eher gering ist. Dabei handelte es sich um Niederschriften von Mönchen über die Rettung der jeweiligen Reliquien aus ihren Klöstern vor den Normannen. Zu nennen ist zudem noch die vom Hamburger Bischof Rimbert verfassteVita Anskarii,in welcher dieser über die Reisen seines Vorgängers Anskar nach Schweden und die damit verbundenen Missionsversuche berichtet. Vor allem aber für die innerdänischen Verhältnisse und die Haltung gegenüber den Christen, die Taufe Harald Klaks sowie den Überfall im Jahre 845 auf Hamburg ist diese Quelle unerlässlich. Eine speziell auf Friesland bezogene Quelle aus diesem Jahrhundert gibt es nicht.
Die Forschungslage über die Zeit der Normanneneinfälle in das Frankenreich ist sehr umfangreich. Sowohl in der älteren als auch in der jüngeren Forschung ist eine Vielzahl von Werken, vor allem über die Normannen an Seine und Loire, geschrieben worden. Die Literatur mit einem Überblickscharakter über die gesamte Normannenzeit überwiegt hierbei. Mit Blick auf die Beziehungen zwischen Friesland und Dänemark reduziert sich diese Menge jedoch um einiges. Für dieses Thema sind besonders zwei Werke erwähnenswert, die umfangreiche Arbeit Vogels sowie ein Aufsatz Couplands über dänische Anführer im Frankenreich, insbesondere in Friesland.2Obwohl Vogel der älteren Literatur zuzurechnen ist und sicherlich einige Thesen zu revidieren sind, ist sein Werk aufgrund der genauen und umfassenden Quellenarbeit für die vorliegende Thematik unverzichtbar.
2Vogel, Walther, Die Normannen und das fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799 -911), Heidelberg 1906. Coupland, Simon, From poachers to gamekeepers: Scandinavian warlords and
Carolingian kings, in: Early Medieval Europe 1998, Volume 7, Issue 1, S. 85 - 114.
Page 4
Die Werke von Zettel und Mohr,3letzteres aus dem Jahr 2003, haben sich das Ziel gesetzt, die Bezeichnungen in den fränkischen Quellen für die Skandinavier zu untersuchen. Diese kennen für die Fremden aus dem Norden ihres Reiches verschiedene Benennungen, von denen einige nur auf bestimmte Gruppen, anderen aber synonym verwendet werden. Die größte Gruppe der Quellen bezeichnet diese alsDanioderNordmanni,wobei die beiden Begriffe meist gleichbedeutend sind und dieselbe Gruppe von Skandinaviern meinen. Andere Quellen sprechen nur von denNortmanni,nutzen diese Bezeichnung also als Sammelbegriff für alle aus dem Norden stammenden Fremden, ohne weitere Differenzierungen zu machen, oder auch vonpaganioderpyrates.Im Folgenden soll nicht explizit auf diese Thematik eingegangen werden, wenn nötig erfolgen Verweise auf die Werke Zettels oder Mohrs. Dennoch muss diese Problematik der unterschiedlichen Bezeichnungen stets im Hinterkopf behalten werden.
II.
1. König Godfrid und Karl der Große 804 - 810
1.1. Die ersten Kontakte
Die erste Nachricht in den Quellen über Dänen, die über die Nordsee nach Friesland kamen und diesen Landstrich, der sonst von großen politischen oder historischen Ereignissen eher unberührt geblieben war, in den Mittelpunkt des fränkischen Interesses setzten, stammt aus dem Jahre 810. Eine Flotte von 200 Schiffen zerstörte laut den fränkischen Reichsannalen die friesischen Inseln sowie das Festland auf Betreiben des dänischen Königs Godfrid hin.4Bevor dieses Ereignis näher untersucht werden soll, muss zuvor auf jenen Dänenkönig und dessen erste Kontakte sowie Konflikte mit den Franken eingegangen werden, um den Kontext zu verstehen, in dem sich dieses abspielte.
3Horst Zettel, Das Bild der Normannen und der Normanneneinfälle in westfränkischen, ostfränkischen
und angelsächsischen Quellen des 8- 11. Jahrhunderts, München 1977. Andreas Mohr, Das Wissen über
die Anderen. Zur Darstellung fremder Völker in den fränkischen Quellen der Karolingerzeit, Münster
2003.
4Vgl. Die Reichsannalen, 810, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte. Erster Teil,
neubearbeitet von Reinhold Rau (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, FSGA
Bd. 5), Darmstadt 1974, S. 94.
Page 5
Durch die Sachsenpolitik Karls des Großen kam es bereits gegen Ende des 8. Jahrhunderts zu Kontakten zwischen Franken und Dänen.5Das fränkische Reich breitete sich seit dem Jahre 772 durch verschiedene Kriegszüge gegen die Sachsen immer mehr in nördlicher Richtung aus, so dass es zwangsläufig zu vermehrten Kontakten kam. Es existierten jedoch zuvor schon durchaus gegenseitige Handelsbeziehungen, die „bis in die Zeit des römischen Galliens“6zurückreichten. Im 8. Jahrhundert hatte sich ein intensiver Handelskontakt zwischen dem Ostseeraum und dem fränkischen Reich entwickelt, so dass Skandinavier wohl unter anderem Dorestad in Friesland, welches seit den 770er Jahren unter fränkischer Herrschaft war, und auch andere fränkische Handelszentren besuchten.7Über die Handelsroute von Ribe nach Dorestad gab es zudem intensiven Kontakt zwischen Dänemark und dem Rheinland, welcher vor allem durch zahlreiche Funde in Ribe von solchen Importen aus dem 8. Jahrhundert bezeugt wird.8Aus den historiographischen Quellen ist jedoch nicht viel über diese Handelsbeziehungen bekannt, da bei den karolingischen Schreibern der Handel noch keine große Beachtung fand. Wirklich geweckt wurde das Interesse der fränkischen Großen an den Geschehnissen auf Jütland erst durch die Eroberung Sachsens. Im Zuge dessen wurde auch erst die fränkische Historiographie auf diesen Bereich aufmerksam, so dass von da an versucht wurde, einen, wenn auch geringen, Einblick in die dänischen Herrschaftsverhältnisse zu geben. Die fränkischen Reichsannalen berichten aus dem Jahre 777, dass Widukind, der Anführer des sächsischen Widerstandes, nicht wie viele andere Sachsen zum fränkischen Reichstag nach Paderborn reiste, sondern „inpartibus Nordmanniae confugium fecit una cum sociis suis“9. Jankuhn folgert daraus, dass eine Gruppe von
5Unter Dänemark im 8. und 9. Jahrhundert ist das Gebiet des heutigen Dänemarks, sowie das heute
deutsche Südschleswig und die schwedischen Provinzen Skane bzw. Schonen und Halland zu verstehen.
Vgl. Else Roesdahl, David Wilson (Hrsg.), From Viking to Crusader. The Scandinavians and Europe
800-1200, New York 1992.
6Horst Zettel, Karl der Große, Siegfried von Dänemark und Gottfried von Dänemark. Ein Beitrag zur
karolingischen Nordpolitik im 8. und 9. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Schleswig - Holsteinische
Geschichte 110 (1985), S. 11 ff, hier: S. 11.
7Vgl. Janet Nelson, Das Frankenreich, in: Sawyer, Peter (Hrsg.), Die Wikinger. Geschichte und Kultur
eines Seefahrervolkes, Stuttgart 2000. Dazu auch Walther Vogel, Die Normannen und das fränkische
Reich bis zur Gründung der Normandie (799 - 911), Heidelberg 1906, S. 45.
8Vgl. Else Roesdahl, Viking Age Denmark, translatet by Susan Margeson and Kirsten Williams, London
1982, S. 206.
9Reichsannalen, 777, S. 37. DieAnnales Mettenses priores,herausgegeben von Bernhard von Simson,
MGH SS rer. Germ., 1905. Nachdruck 2003 bestätigen dies:Ad quod placitum omnes Saxones venerunt,
exceptis paucis rebellibus, quorum princeps Witing erat, qui ad Nordomannos confugium fecerunt.
Page 6
Sachsen in ihrem Konflikt mit Karl „Rückhalt bei den Dänen“10suchte und auch fand, so dass diese dadurch in einen offenen Gegensatz zu dem großen Nachbarreich gerieten. Warum die Dänen diese Art der Hilfe anboten, lässt sich aus den Quellen nicht erschließen. Sie gerieten dadurch in, wenn auch nicht unmittelbar bedrohliche, Gefahr, den Unmut Karls des Großen auf sich zu ziehen. Der einzige Vorteil, den die Dänen dadurch gewonnen haben könnten, waren detaillierte Informationen, welche Widukind ihnen über die fränkischen Verhältnisse geben konnte. Von einer aktiven Unterstützung der sächsischen Widerstandsgruppe durch die Dänen wird jedoch nichts berichtet.
Die nächste Nachricht über Dänemark aus den Reichsannalen stammt aus dem Jahr 782. Zum ersten Mal wird hier auch eine Art politischer Struktur der Nordmänner erwähnt. Es wird von einemrex Sigifridberichtet, der seine Boten zu einer Versammlung Karls in Lippspringe geschickt hatte. Der Anführer dermissi,Halptani bzw. Halfdan, wird sogar namentlich erwähnt.11Mit welchem Anliegen diese Boten gekommen waren, ist unbekannt, jedoch vermutet Zettel, dass höchstwahrscheinlich über die aufgenommenen sächsischen Flüchtlinge verhandelt wurde.12Dazu passt die Nachricht, dass Widukind aus seinem Exil in Dänemark in seine Heimat zurückkehrte und nun wieder Aufruhr unter den Sachsen stiftete.13Möglicherweise befürchtete der Däne Sigfrid, dass Karl es nicht weiter tolerieren würde, dass der gesuchte Sachsenanführer Widukind bei ihm Unterschlupf findet, und dies als einen Vorwand für eine Militäraktion nehmen könnte. Ob Karl dies jedoch im Sinn hatte oder auch nur mit dem Gedanken gespielt hat, bleibt reine Spekulation und ist wohl aufgrund der Tatsache, dass er neben Sachsen noch weitere politische Brandherde im Auge behalten musste, zu diesem Zeitpunkt nicht sehr wahrscheinlich.
Über Widukind wird im Folgenden im Jahre 785 berichtet, dass Karl ihm die Nachricht überbringen ließ, sich zu ihm zu begeben, ansonsten bestehe keine Rettung mehr für ihn.14Zettel deutet die Nachricht so, dass sie für den Fall, dass Widukind zu dem Zeitpunkt bei den Dänen weilte, auch als eine Drohung für Sigfrid verstanden werden könne. So hätten die Dänen seiner Meinung nach sicherlich „mit Erleichterung“15
10Herbert Jankuhn, Karl der Große und der Norden, in: Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben. Bd.
1: Persönlichkeit und Geschichte, herausgegeben von Helmut Beumann, Düsseldorf 1965, S. 699 - 708,
hier: S. 699.
11Vgl. Reichsannalen, 782, S. 43.
12Vgl. Zettel, Karl der Große, Siegfried von Dänemark und Gottfried von Dänemark, 1985, S. 15.
13Vgl. Reichsannalen, 783, S. 43.
14Vgl. Reichsannalen, 785, S. 49.
15Vgl. Zettel, Karl der Große, Siegfried von Dänemark und Gottfried von Dänemark, 1985, S.16.
Page 7
reagiert, als Widukind sich letztendlich Karl stellte, da Sigfrid keine Auseinandersetzung mit diesem hätte riskieren wollen. Eine letzte Nachricht über den Dänenkönig Sigfrid stammt aus den so genannten Einhardsannalen, in denen von einem Gesandten Karls berichtet wird, welcher im Jahre 798ad Sigifridum regem Danorumgeschickt worden war, jedoch auf seiner Reise von Sachsen getötet wurde.16Hiernach bestanden also auch nach der Unterwerfung Widukinds noch Verbindungen zwischen dem Hofe Karls und Sigfrid, auch wenn der noch nicht beendete Sachsenkonflikt sicherlich ein Thema der Gesandtschaft gewesen sein wird.
Fasst man die Aussagen der Quellen über den alsrexbezeichneten Dänen Sigfrid zusammen, so lässt sich feststellen, dass Karl in diesem einen fähigen und vor allem für die Flüchtlingsfrage zuständigen Verhandlungspartner sah, an den er sich mit seinen Forderungen wenden konnte. Boten wurden zwischen beiden Reichen gesendet und Verhandlungen geführt. Welche Stellung Sigfrid aber tatsächlich innehatte, wird nicht ersichtlich. Regierte er über die komplette dänische Halbinsel oder war er lediglich der Anführer einer Gruppe von Nordmännern, bei der die sächsischen Flüchtlinge Unterschlupf gefunden hatten? Ähnliche Fragen werden sich im weiteren Verlauf der Arbeit auch bei anderen dänischen Herrschern stellen und an den jeweiligen Stellen nochmals in einer separaten Überlegung aufgegriffen.