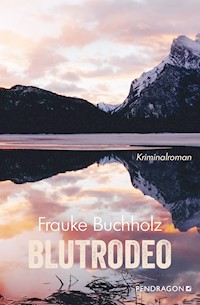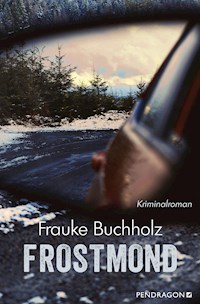
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ted-Garner-Reihe
- Sprache: Deutsch
In den Tiefen Kanadas werden Verbrechen an indigenen Frauen aufgedeckt. Seit Jahren verschwinden junge Frauen indigener Herkunft spurlos entlang des Transcanada-Highways. Für die Polizei scheinen diese Verbrechen keine Priorität zu haben. Doch als die 15-jährige Jeanette Maskisin in Montreal tot aufgefunden wird und die Medien darüber groß berichten, werden die Ermittler LeRoux und Garner auf den Fall angesetzt. Ihre erste Anlaufstelle ist ein Cree-Reservat im hohen Norden Quebecs, aus dem Jeanette stammt. Dort stoßen die Polizisten auf Ablehnung, denn aus Sicht der First-Nation-Familien hat sich die Polizei nie für die vermissten Frauen interessiert. Die Ermittler kommen immer mehr in Bedrängnis, denn es werden weitere Opfer befürchtet und auch der Täter wird zur Zielscheibe - jemand hat blutige Rache geschworen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frauke Buchholz • Frostmond
Frauke Buchholz
Dieses Buch ist den vielen ermordeten indigenen Frauen und Mädchen in Kanada gewidmet, deren Fälle niemals aufgeklärt wurden.
Ein besonderer Dank geht an meinen inzwischen verstorbenen Freund Peter Cardinal Jr., der mir unvergessliche Einblicke in die Schönheit und Lebendigkeit der Kultur der Cree ermöglichte.
Prolog
Eines Tages, als Wesakechak von einer langen Reise heimkehrte, fand er sein Haus verlassen vor. Er rief den Namen seiner jungen Cousine, die bei ihm lebte, doch niemand antwortete. Als er den Strand nach ihr absuchte, fand er Spuren der Großen Schlange im Sand. Da wusste er, dass sie in die Hände von Misiginebiq-Manitu gefallen war.
Der Nebel über dem St. Lawrence River löste sich nur langsam auf und die Morgenluft war kühl und feucht. Die Umrisse der Schiffe im Vieux-Port de Montreal konnte man kaum erahnen, und die Häuser am gegenüberliegenden Ufer waren unsichtbar, sodass der Fluss dazuliegen schien wie vor 400 Jahren, als französische Pelzhändler im Jahre 1611 am Fuße des Mont Royal den ersten Handelsposten errichteten. Damals fuhren sie in hölzernen Kanus stromabwärts, vollbeladen mit den Fellen von Bibern, Silberfüchsen, Mardern, Luchsen und Wölfen. Genau wie eines dieser geplünderten und gehäuteten Tiere, die die Voyageurs gegen Äxte, Kupferkessel, Perlen und Pocken eingetauscht hatten, trieb Jeanette Maskisin mit der Strömung den St. Lawrence River hinab, die Arme ausgebreitet, als wolle sie sich frei schwimmen oder den Himmel betrachten, doch ihre Augenhöhlen waren weiß und leer wie die von gekochtem Fisch. Niemand würde jemals wissen, was sich als Letztes in ihren dunklen Augen gespiegelt hatte.
Wesakechak nahm seinen Bogen und seine Pfeile und folgte der Spur der Großen Schlange, bis er an das Ufer eines tiefen, dunklen Sees kam. Der See wird Manitou Lake, Spirit Lake oder auch Lake of Devils genannt. Die Spur der Großen Schlange führte zum Rand des Wassers.
Es war der Morgen des 15. Oktober, und es war Chris Ballandines letzter Arbeitstag. Auch wenn der Indian Summer noch einmal ein paar warme Herbsttage beschert hatte, ging die Saison endgültig zu Ende. Das Wetter konnte jetzt jeden Tag umschlagen, und die Winde, die vom Polarkreis heranfegten, würden bald die ersten Schneefälle bringen. Dann würde der endlose kanadische Winter einsetzen und die Stadt unter Tonnen von Schnee begraben. Während Chris die Sonnenschirme und Deckchairs aus Teakholz zusammenklappte und in den Schuppen trug, dachte er daran, dass das Trimester vor sechs Wochen begonnen hatte. Der Sommerjob am Urban Beach hatte ihm Spaß gemacht und er hatte ganz gut verdient. Wenn er sparsam war, würde das Geld reichen, um die Studiengebühren und den Lebensunterhalt für die nächsten zwei Monate zu bezahlen. Dann bräuchte er einen neuen Job. Vielleicht in einer Bar oder einem Musikclub.
Die Holzbar am Urban Beach würde gegen Mittag abgebaut, auf einen LKW verladen und zu einem Container am Stadtrand gefahren werden, doch dabei würden ihm Arbeiter der Transportgesellschaft zur Hand gehen. Das Wasser der Duschen war bereits abgestellt, und während sich der aufgeschüttete Sand am Ufer des St. Lawrence mehr und mehr leerte, beschlich Chris die leise Melancholie dieser grauen Herbstmorgen, die bereits die ganze Trübsal des Winters in sich tragen und die an die Starre von Echsen und Schildkröten denken lassen oder auch an den Tod der Insekten. Der Tour de l’Horloge ragte wie ein Schatten aus dem Dunst heraus, und der Jacques Cartier Pier am anderen Ende war ganz im Nebel verschwunden. Chris beschloss, eine kurze Pause einzulegen, bevor er die restlichen Stühle einräumen würde, um einen Joint zu rauchen. Einen allerletzten Joint. Er würde das Kiffen einstellen. Adieu, Sommer, adieu, Dolce Vita. Oder zumindest einschränken. Er grinste. Ab morgen wäre er wieder ein braver Student der Geschichte und Sozialwissenschaften an der Mac Gill University. Er trat auf den Holzsteg, der von dem künstlichen Strand ein paar Meter in den St. Lawrence River hinausragte, drehte eine Tüte und blickte auf die Strömung. Obwohl der Fluss in der Millionenmetropole in ein befestigtes Betonbett eingezwängt war, wirkte er an diesem Morgen ungezähmt und wild. Die Nebelschwaden hingen wie Wattebällchen über dem Wasser und Chris fröstelte.
Wesakechak stand am Ufer des Sees und blickte in das klare Wasser. Am Grunde des Sees sah er das Haus der Großen Schlange. Es war voll mit furchteinflößenden und grauenhaften Gestalten, die ihre Diener und Gefährten waren. Die meisten glichen, genau wie ihr Meister, Geistern.
Chris nahm noch ein paar tiefe Züge, dann schnippte er die Kippe in die Strömung und beobachtete, wie sie abgetrieben wurde. Wie immer nach einem Joint fühlte er sich leicht und frei. So ungezähmt und wild wie der St. Lawrence. Er wäre gerne ein Abenteurer wie Jacques Cartier gewesen, der 1535 als erster Weißer den St. Lawrence erkundet hatte, doch die Zeit der furchtlosen Entdecker war vorbei. In dem alten Irokesendorf wohnten jetzt 1,6 Millionen Menschen, und Chris’ Abenteuer bestanden aus Erinnerungen an Boyscouts-Ausflüge in kartierte Provinzparks und ausgelassene Partynächte in Clubs oder hier am Urban Beach. Er stieß einen lauten Schrei aus, eine Art Irokesengeheul, vollführte dabei einen Kriegstanz und reckte die Fäuste in den Himmel. Heja heja ho. Niemand sah ihn. Er war so frei wie ein Adler.
In dem dunklen Wasser des Flusses schwamm eine Indianerin, das lange schwarze Haar wie Seetang ausgebreitet. Chris kniff die Augen zusammen. Eine Fata Morgana. Er war bekifft. Es war nebelig. Er war nicht ausgeschlafen. Die Indianerin schwamm direkt auf ihn zu. Sie verhakte sich in einem der Holzpfosten, und während die Strömung an ihr zerrte, tauchte ihr Körper auf und ab und ihr Kopf prallte dumpf gegen die Planken. Chris beugte sich über den Steg und blickte auf sie hinab. Ihr Gesicht war bleich und aufgedunsen wie kranker Fisch. Sie hatte keine Augen. Sie war tot. Chris schrie und schrie und schrie.
In der Mitte dieser schrecklichen Gruppe war die Große Schlange, die sich in ihrer ganzen Länge um Wesakechaks Cousine eingerollt hatte. Der Kopf der Schlange war blutrot, und ihre wilden Augen leuchteten wie Feuer. Ihr ganzer Körperwar gepanzert mit harten, glänzenden Schuppen. Während Wesakechak hinabsah auf diese sich windenden Geister des Bösen, fasste er den Entschluss, dass er sich an ihnen für den Tod seiner Cousine rächen würde.
Jean-Baptiste LeRoux
15. Oktober
Das Klingeln drang wie durch Watte an sein Ohr. Es war schrill und durchdringend, ein altmodisches amerikanisches Telefonklingeln, und es dauerte lange, bis er begriff, dass es sein eigenes Handy war. Er öffnete vorsichtig die Augen und erschrak. Der riesige Spiegel an der Decke reflektierte seinen nackten Körper mit dem zerknautschten Gesicht und das zerwühlte Bett. Von Céline sah er nur das linke Bein und einen Teil der linken Brust. Was ihn in der Nacht erregt hatte, warf im trüben Licht des Morgens Fragen auf: Wer und was hatte sich hier schon alles gespiegelt? Er spürte ihren warmen Körper neben sich und hatte eine leichte Erektion. Er beugte sich über sie und leckte über ihre Brustwarze. Sie seufzte im Halbschlaf und drehte sich zur Seite.
Er blinzelte gegen die Helligkeit an und fluchte. Merde! Das Klingeln hörte nicht auf. Sein Kopf schmerzte. Als er dranging, meldete sich Bruno.
„Wo steckst du? Du musst sofort kommen. Unten am Urban Beach ist eine Leiche gefunden worden.“
Er murmelte etwas, ließ sich die genaue Stelle beschreiben, drückte Bruno weg und zündete eine Zigarette an. Merde, merde, merde. Er scheuchte Flaubert, Célines fetten Perserkater, der sich am Fußende zusammengerollt hatte, aus dem Bett und empfand Genugtuung, als dieser die bösen grünen Augen zu Schlitzen verengte, die Nackenhaare sträubte und ihn anfauchte. Er hasste Katzen. Das Zimmer sah aus wie ein Bordell. Leere Gläser und Flaschen, überquellende Aschenbecher, Strümpfe, Schuhe, Célines Slip und BH, verstreute Kleidungsstücke. Es war heiß hergegangen. Er hatte einen Mordskater. Hoffentlich hatte Bruno nicht bei ihm zu Hause angerufen. Er hatte Sophie gesagt, dass er eine nächtliche Ermittlung durchführen müsste, ein Mordfall im Clubmilieu, blablabla. Sophies Blick war kalt gewesen. Er musste die Sache in den Griff bekommen. Nicht die Sache, sondern seinen Schwanz. Es war Zeit, das Ganze zu beenden. Bevor es aus dem Ruder lief.
Er suchte seine Kleidungsstücke zusammen und zog sich an. Das Hemd war zerknittert und roch nach Schweiß. Er ging ins Bad, pinkelte, warf die Zigarettenkippe ins Klo, spritzte sich etwas kaltes Wasser ins Gesicht und strich die Haare glatt. Er sah aus wie ein Penner. Es war Montagmorgen, 9:23 Uhr. Er hätte vor einer knappen Stunde im Büro sein müssen. Scheiß drauf, dachte er. Er hätte dringend einen Kaffee und eine Dusche gebraucht, aber das musste er sich verkneifen. Céline war anscheinend wieder eingeschlafen, und er zog leise die Tür hinter sich zu.
Sein Auto stand unten vor dem Haus. Die Luft war kühl und ihm schwindelte ein wenig. Er hatte noch ordentlich Restalkohol im Blut, doch falls ihn jemand anhielt, würde sein Ausweis ihn retten. Jean-Baptiste LeRoux. Sergeant. Sûreté du Québec. Eine Krähe hackte der anderen kein Auge aus.
Der Urban Beach lag in der Nähe des Jacques Cartier Pier, keine 13 Kilometer von hier, doch der Verkehr in der City war dicht und er kam nur langsam voran. Er zündete noch eine Zigarette an und kurbelte die Scheibe herunter. Er hätte Céline einen Zettel schreiben sollen. „Danke für alles. Mach’s gut.“ Vielleicht würde er sie anrufen. Sie würde ihm die Augen auskratzen. Er hasste Szenen.
Der St. Lawrence führte Hochwasser. Die starken Regenfälle der letzten Wochen hatten den Strom anschwellen lassen und die Schiffe im Vieux Port schaukelten im Wellengang. Die Uhr am Tour de l’Horloge zeigte 10:13 Uhr. Was für eine Scheißzeit für eine Leiche. Hoffentlich war Morel nicht vor Ort. Bruno war ganz okay. Der Urban Beach, an dem sich im Sommer die Touristen tummelten, lag verlassen da, die bunten Deckchairs und Sonnenschirme waren verschwunden, der künstlich aufgeschüttete Sand grau und feucht. Am Straßenrand stand ein Polizeiwagen mit Blaulicht, daneben ein Krankenwagen. Er parkte vor dem Absperrband, das irgendjemand bereits befestigt hatte. Es flatterte leise im Wind. Ein Gefühl von Trostlosigkeit überfiel ihn. Er hoffte, dass es nicht allzu schlimm werden würde. Bruno hatte ihn bereits erspäht und winkte wie ein Irrer. Neben ihm hantierten zwei Typen in weißen Plastikanzügen. SpuSi-Leute. Jemand machte Fotos. Auf einem Klappstuhl saß ein junger Mann, der in Decken eingewickelt war. Ein Sanitäter reichte ihm eine Tasse Tee, doch seine Hände zitterten so stark, dass er die Hälfte verschüttete.
„Ah, Jean-Baptiste. Ça va?“
Die Lamartine. Zuckersüße Stimme. Einladendes Lächeln. Harter Blick. Die hatte ihm gerade noch gefehlt. Küsschen links, Küsschen rechts. Teures Parfum, wahrscheinlich Chanel. War mindestens 50, die alte Schachtel.
Staatlich geprüfte Leichenfledderin. Machte ihm jedes Mal schöne Augen. Ekelhaft. Morel war nicht in Sicht.
„Bonjour, LeRoux! Ausgeschlafen?“ Bruno grinste breit. „Hoffentlich hast du gut gefrühstückt. Wir haben eine angeschwemmte Pocahontas. Schön durchweicht.“
Wenn Bruno blöde Witze riss, würde es schlimm sein. In letzter Zeit hasste LeRoux seinen Job. Die Leiche lag auf einer schwarzen Plastikfolie. Sie sah aus wie aus einem Zombie-Film. Es war eine Frau. Wahrscheinlich Indianerin. Viel mehr konnte man nicht erkennen. Lange schwarze Haare, die wie krautige Algen ein grotesk aufgedunsenes Gesicht umrahmten. Die Augen waren von Vögeln ausgepickt worden, sodass man nur die Höhlen sah. Der Kieferknochen der linken Wange lag frei, die obere Zahnreihe grinste ihn an wie bei einem Skelett. Sie trug einen Minirock, Stiefeletten und ein Shirt. Die Kleidung war zerfetzt, die Haut verschrumpelt wie eine faulige Apfelsine, Arme und Beine so aufgequollen, dass man die Gelenke nicht mehr erkennen konnte. Sie stank nach verwestem Fisch.
Die Übelkeit überwältigte ihn und ein Kotzeschwall schoss in einer bröckeligen bräunlichen Flut über seine Jacke und Lamartines Lederpumps.
„Mon Dieu!“ Die Lamartine sprang zur Seite, zog ein Taschentuch hervor und wischte an ihren Schuhen herum. Während er versuchte, seine Jacke ein wenig zu säubern, entschuldigte er sich bei ihr.
„Hätte gar nicht gedacht, dass Sie so zart besaitet sind, Jean-Baptiste. Ich glaube, Sie schulden mir einen Kaffee. Wenn nicht mehr.“ Sie lächelte vielsagend.
Er musste aufstoßen. Außerdem hatte er einen Höllendurst. „Wir sind fertig“, sagte einer der beiden Typen von der SpuSi.
„Dann bringt die Kleine mal ins Bettchen. Ziemlich frisch hier draußen. Erkältet sich sonst.“ Bruno wieherte wie ein Pferd. Er hasste Brunos Witze. Der Fotograf packte sein Stativ zusammen.
„Können Sie schon etwas sagen, Bernadette?“ LeRoux sah der Lamartine in die Augen und bemühte sich, geschäftsmäßig zu klingen.
„Todeszeitpunkt? Todesursache?“
„Geben Sie mir etwas Zeit, Jean-Baptiste“, flötete sie. „Wenn Sie morgen ins Labor kommen, weiß ich sicherlich schon mehr.“ Das klang wie ein erotisches Versprechen. Er kramte die Schachtel Zigaretten aus der Jackentasche und zündete sich eine an.
„Meinen Sie, es war ein Unfall?“, fragte er. „Nein“, sagte sie. „Mit Sicherheit nicht.“
Sie zeigte mit der Schuhspitze auf den offenen Kieferknochen. Er musste sich zwingen hinzuschauen. „Sehen Sie den kleinen dunklen Fleck an der Schläfe?“
Er nickte und spürte wieder ein Würgen im Hals.
„Das ist eine Einschussstelle. Ich muss die Haare abrasieren und den Schädel aufsägen. Wenn wir Glück haben, steckt die Kugel noch im Kopf.“
„Okay“, sagte er und wandte sich zur Seite. Diesmal kam nur grünlicher Schleim.
Die SpuSi-Leute wickelten die Leiche in die Plastikfolie, hoben sie in einen Zinksarg und trugen sie zu ihrem Wagen. Auch die Lamartine setzte Segel. Er wischte die Mundwinkel ab und nahm einen tiefen Atemzug. Ihm war noch immer übel. Das Wasser des St. Lawrence roch faulig. Herbstlaub hatte sich unter dem Holzsteg gesammelt und moderte vor sich hin. Er warf die nur halb gerauchte Zigarette ins Wasser. Bruno hatte den Studenten, der die Leiche entdeckt hatte, bereits interviewt und seine Personalien aufgenommen. Bekifft, aber ansonsten ein unbeschriebenes Blatt. Hatte brav die Polizei gerufen. Stand noch unter Schock. Die Sanitäter würden sich um ihn kümmern.
Jean-Baptiste fror. Er gab Bruno das Zeichen zum Aufbruch. Wenn er nicht bald einen Kaffee bekam, würde er sterben. Er beschloss, sein Auto besser hier stehen zu lassen und mit dem Polizeiwagen ins Büro zu fahren. Es war noch keine 11:00 Uhr. Was für ein beschissener Tag.
„Wo warst du eigentlich heute Morgen? Sophie meinte, du würdest Nachtschicht machen.“
Bruno grinste schief. Scheiße. Also hatte er bei ihm zu Hause angerufen.
„Hab ich auch“, sagte er. Bruno grinste noch breiter.
„Standst aber nicht auf dem Einsatzplan“, sagte er. „War bestimmt undercover.“
„Genau“, sagte er und schoss Bruno seinen Don’t-fuck-with-me-Blick zu. Es wirkte. Bruno runzelte die Stirn und schwieg den Rest der Fahrt.
Der große graue Kasten der Sûreté du Québec in der Rue de Parthenais trug nichts dazu bei, seine Stimmung zu heben. Das Morddezernat lag in der fünften Etage. Im Aufzug spürte er wieder das flaue Gefühl im Magen. Er würde Marie bitten, ihm einen Kaffee zu machen und ein Sandwich zu kaufen. Bevor die Lamartine fertig war, konnten sie eh nicht viel machen. Protokoll anfertigen, Vermisstenanzeigen sichten, den üblichen Papierkram erledigen. Er würde früh Feierabend machen und dann ab nach Hause, duschen und ins Bett. Er wollte lieber nicht an Sophie denken. Bloß keine Szene heute. Doch kaum waren sie im Büro, tauchte Morel auf. Er blickte ihn an wie ein verfetteter Basset-Hound, der Witterung aufnimmt.
„Sind Sie krank, LeRoux?“
Typisch Morel, dem Alten entging nichts. „Magenverstimmung“, sagte er. „Nicht so wild.“
Schon wieder Brunos dämliches Grinsen. Die trägen Augen des Alten durchdrangen ihn wie Röntgenstrahlen. Gleichgültig. Gnadenlos.
„Waren Sie deshalb nicht im Büro, als die Meldung kam?“ LeRoux nickte.
„Rufen Sie gefälligst an, wenn Sie krank sind“, sagte Morel. „Oder später kommen.“
Morel war ein Pedant. „Okay“, sagte LeRoux.
Er fühlte sich wie ein gescholtener Pennäler. Er stank nach Kotze und Schweiß. Er brauchte einen Kaffee.
„Kommen Sie mit in mein Büro. Ich brauche ein genaues Briefing.“
Bruno und er folgten dem Alten. Scheißtage sind Scheißtage. Und sie sind endlos. Morel löcherte sie mit Fragen. LeRoux überließ die Antworten Bruno und konzentrierte sich darauf, nicht einzunicken.
„Eine Indianerin? Sind Sie sicher?“
Morels Stirnfalten waren noch tiefer als gewöhnlich.
„Wie alt?“
„Schwer zu sagen“, sagte Bruno. „Der Kleidung nach eher jung.“
„Kennen Sie schon die Todesursache?“, fragte Morel.
„Wahrscheinlich erschossen.“
„Gibt es eine Vermisstenanzeige?“
„Keine Ahnung.“
„Wer macht die Obduktion?“
„Docteur Lamartine.“
Morel schwieg. LeRoux unterdrückte ein Gähnen.
„Morgen wissen wir mehr“, fügte Bruno beschwichtigend hinzu. LeRoux hoffte, dass sie jetzt endlich gehen konnten, doch Morel hüllte sich weiter in brütendes Schweigen. Die Zeit schien stillzustehen. Wenn er nicht sofort einen Kaffee bekäme, würde sein Schädel platzen. Endlich hob Morel den Blick und sah sie aus traurigen Hundeaugen an.
„Sie kennen die Fälle verschwundener Indianerinnen entlang des Transcanada-Highways?“
Bruno und Jean-Baptiste nickten.
„18 Frauen spurlos verschwunden in den letzten fünf Jahren, 17 davon indianischer Herkunft. Und kein einziger Fall aufgeklärt.“ Morels Augen sahen jetzt vorwurfsvoll aus.
„Interessenverbände der First Nations nennen einen Abschnitt des Highways bereits ‚Highway of Tears‘ und werfen den Behörden schlampige Ermittlungen vor.“
LeRoux verstand nicht, was das mit ihnen zu tun haben sollte. Soweit er wusste, waren alle Fälle im Westen passiert. Angloland. Royal Canadian Mounted Police-Gebiet. Er war weiß Gott kein Anhänger der Separatisten, doch Québec war anders. Friedlicher. Kultivierter. Keine Roughnecks, keine Cowboys.
„Es gab auch zwei Fälle in Ontario“, fuhr Morel fort. „Einen in Deep River und einen in der Nähe von Sault Ste. Marie. Und jetzt eine tote Indianerin hier bei uns.“
Seine Stimme klang aufgekratzt und er hatte Schweißränder unter den Achseln. Obwohl sein Kopf nur auf zwei Zylindern arbeitete, dachte LeRoux, dass es viel zu früh für voreilige Schlüsse war, doch er hatte keine Lust, sich mit Morel anzulegen. Schon gar nicht heute.
„Der CNG, die nationale Regierung der Cree in Nemaska, macht ordentlich Druck“, sagte Morel. „Wenn wir Pech haben, wird uns der Grand Chief persönlich auf die Zehen treten. Von der linken Presse ganz zu schweigen. Und die Royal Canadian Mounted Police wünscht ausdrücklich eine stärkere Zusammenarbeit mit der Sûreté du Québec.“
LeRoux stöhnte innerlich. Es gab nichts Schlimmeres als Kompetenzgerangel.
„Sagen Sie sofort Bescheid, wenn der Obduktionsbericht da ist“, sagte Morel. „Und erscheinen Sie morgen pünktlich zum Dienst, LeRoux.“
Arschloch, dachte Jean-Baptiste. Er schaute auf die Uhr.
12:23 Uhr. Zeit für die Mittagspause. Gott sei Dank. Sein Handy beepte. Zwei neue Nachrichten.
Wo steckst du? Sophie.
Bis bald? Céline.
Ted Garner
21. Oktober
„Jesus Christ“, fluchte Ted Garner und trat scharf auf die Bremse. Der silberfarbene BMW schlitterte und kam dann zum Stillstand. Ted war wie immer mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, auf dem einsamen Highway 17 und einer Gesamtstrecke von knapp 3000 Kilometern war es einfach lächerlich, sich an das Speedlimit von 80 km / h zu halten. Ted war in Eile. Wenn alles nach Plan ging, könnte er vor Mitternacht in Montreal sein. Fuck. Dieses Scheißgesetz, das jeden Autofahrer in Kanada verpflichtete, bei einer Panne oder einem Unfall anzuhalten und Hilfe zu leisten. Ted stieg aus und ging zurück zu dem Wagen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite halb im Graben lag. Es war ein uralter, zerbeulter Dodge mit abgefahrenen Reifen und einem Nummernschild aus Ontario. An der hinteren Ladefläche war ein Aufkleber mit dem Schriftzug nehiyawake und zwei Federn. Ted beugte sich zu der Fahrertür hinunter und klopfte gegen die Scheibe. Am Steuer saß ein junger Mann, der wie weggetreten vor sich hinstarrte. Dunkelhaarig. Langhaarig. Ungepflegt. Wahrscheinlich Indianer.
Wahrscheinlich betrunken. Oder stoned. Ted stöhnte innerlich.
„Alles okay, Chief?“, fragte er, während er die Tür öffnete.
„Ich bin kein Chief “, sagte der Bursche.
Er war höchstens 18, und als er seine schwarzen Augen auf ihn heftete, fühlte Ted eine vage Bedrohung. Bestimmt hatte der Kerl eine Waffe, Rothäute hatten immer eine Waffe, eine Jagdflinte, einen Revolver, auf jeden Fall ein Messer. Sie hatten ja ganzjährig Jagdrechte. Ted spürte, wie der Ärger in ihm hochstieg. Er war selbst ein leidenschaftlicher Jäger, doch er musste seine Jagdlizenz jedes Jahr für teuer Geld erneuern lassen und sich natürlich an die Schonzeiten für das Wild halten, während die Rothäute …
„Der Motor streikt. Können Sie mich abschleppen?“, fragte der Indianer.
Natürlich konnte er, er hatte ein Abschleppseil im Kofferraum, wie es sich gehörte, und der nagelneue BMW, den er noch ein paar Jährchen würde abstottern müssen, hatte schließlich ordentlich PS.
„Wie weit?“
„Whitefish“, sagte der Indianer.
Ted hatte keine Ahnung, wie weit das war, doch er sagte okay. Der Indianer stieg aus. Klein, schmächtig, abgetragene Blue Jeans, Cowboystiefel, kariertes Holzfällerhemd. Etwas pockennarbige Gesichtshaut, stumpfer Ausdruck. Keine Waffe. Zumindest keine, die er sehen konnte. Ted wendete seinen Wagen und stellte ihn an den Straßenrand direkt vor den Dodge. Er holte das Abschleppseil aus dem Kofferraum, und schweigend machten sie sich daran, den Dodge zu vertäuen.
„Schönes Auto“, sagte der Indianer. „Kostet bestimmt ’ne Stange Geld.“
Ted brummte etwas. Steuern zahlten die Rothäute auch nicht. Wenn sie überhaupt jemals einen Job hatten.
„Sind Sie allein unterwegs?“ Der Bursche war ja richtig gesprächig.
„Nee, meine Oma liegt im Kofferraum“, sagte Ted.
Der Indianer lachte. Er hatte schiefe Zähne und eine Zahnlücke im Oberkiefer. Sollte besser nicht den Mund aufreißen. Hoffentlich schaffte er es, den Dodge einigermaßen sicher zu lenken, ohne ihm hinten drauf zu fahren.
„Nett, dass Sie mir helfen“, sagte der Indianer.
„Schon okay“, sagte Ted.
„Macht nicht jeder. Manche haben Vorurteile“, sagte der Indianer.
„Tatsächlich?“, sagte Ted. Er war überzeugt, dass es kein einziges Vorurteil gab, das nicht zu 90 Prozent stimmte. Wenn nicht 100.
„Sind Sie aus Saskatchewan?“, fragte der Indianer.
„Yep“, sagte Ted. Stand schließlich auf dem Nummernschild des BMW.
„Aus Regina?“
„Nein“, log Ted. Zum Glück waren sie fertig, sonst würde der Indsman ihm noch Löcher in den Bauch fragen. Ging niemanden was an, woher er kam und wohin er wollte. Er stieg in den BMW, der Indianer setzte sich ans Steuer des Dodge, Ted gab Gas und mit einem Ruck, bei dem er fast auf den Kofferraum des BMW geknallt wäre, landete der Dodge auf der Straße. Ted fuhr langsam den Highway entlang, den Indianer im Schlepptau. Hin und wieder schaute er in den Rückspiegel. Er hoffte, dass der Indsman keine Mätzchen machen würde.
Vorsichtshalber hatte er seinen Revolver aus dem Handschuhfach geholt, entsichert und griffbereit neben sich. Whitefish 27 Kilometer, zeigte das GPS an. Gott sei Dank. Wenn er ordentlich auf die Tube drücken und auf eine Pause verzichten würde, könnte er die verlorene Zeit wieder aufholen. Während er auf dem Highway dahinzockelte, dachte Ted an das tote Indianermädchen. Er versuchte, das Bild wegzudrängen, doch das entstellte Gesicht mit den leeren Augenhöhlen, der geschundene, aufgedunsene Körper und das verfilzte schwarze Haar verfolgten ihn wie ein böser Geist. Seit er die offene Prärie Saskatchewans und Manitobas hinter sich gelassen hatte, säumte ein undurchdringlicher Föhrenwald den Transcanada-Highway. Der Himmel war grau und verhangen, ein leichter Schneeregen hatte eingesetzt, und obgleich es erst früher Nachmittag war, lauerte bereits die Dunkelheit der Spätherbstnächte in dem dichten Gehölz. Das schmale Asphaltband war das einzige Bindeglied zur Zivilisation. Seit er auf den Indianer gestoßen war, war ihnen kein einziges Auto begegnet. Ted schaute wieder in den Rückspiegel. Alles ruhig. Das Ortseingangsschild Whitefish war zerbeult und hatte mehrere Einschusslöcher. Es war eins dieser gottverlassenen Nester, die aus einem Supermarkt, einer Tankstelle, einem Waschsalon und einem Burger-Restaurant bestanden. Ted bremste vor der Tankstelle, die auch eine Mini-Werkstatt zu sein schien, und stieg aus. Der Indianer kletterte aus dem Dodge, Ted löste das Abschleppseil, warf es in den Kofferraum, stieg wortlos wieder ein und preschte los. Aus den Augenwinkeln sah er den Indianer, der ihm hinterherstarrte. Er hatte seine Pflicht getan. Good-bye, Whitefish. Das Fleisch des Indianermädchens hatte ausgesehen wie kranker weißer Fisch. Um sich abzulenken, legte Ted eine CD ein. Französisch für Anfänger mit Vorkenntnissen. Bonjour, je m’appelle Marie-Christine.
Comment allez-vous? Vous êtes d’ici? Ted versuchte, die Dialoge mitzusprechen, doch er hatte das Gefühl, sich dabei die Zunge zu verrenken. Sein Schulfranzösisch lag seit über 20 Jahren brach. Marie-Christine hatte eine sexy Stimme. Voulez-vous coucher avec moi?
Ted grinste. Das hatte er behalten. Stammte aber nicht aus dem Unterricht. Er war gespannt, wie es ihm bei den Froschfressern ergehen würde.
Er hatte Patty und den Kindern gesagt, dass er in spätestens zwei Wochen zurück wäre. Dieser Scheißwald nahm einfach kein Ende. Ted hatte Hunger. Vielleicht hätte er in dem Kaff doch einen Burger essen sollen. Er beschloss, in North Bay eine kurze Rast einzulegen. Danach würde er dem Ottawa River folgen, weiter und weiter durch endlose Wälder, bis der Strom sich in Montreal in den St. Lawrence ergoss. Jenseits des Flusses lag die Wildnis Québecs, eine Welt ohne Straßen, die sich über Tausende von Kilometern bis zum Polarkreis erstreckte, und in der Wölfe, Schwarzbären und Elche umherstreiften wie schon seit ewigen Zeiten. Menschenleer. Bis auf ein paar Inuit und Cree. Das Gesicht des toten Mädchens wies Bissspuren von Füchsen oder Hermelinen auf. Die Augen hatten Krähen oder Raben ausgepickt. Fuck Mutter Erde, dachte Ted und drückte aufs Gaspedal. Der BMW flog dahin wie ein Pfeil.
Jean-Baptiste LeRoux
22. Oktober
„Willkommen in Montreal, Monsieur Garner. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt.“
Morels Stimme klang ölig und seine schläfrigen Augen hatten etwas Lauerndes. Doch Garner nickte nur und verzog keine Miene. Er war um die 40, mittelgroß und drahtig, hatte kalte graue Augen, ein hageres Gesicht und schütteres blondes Haar. Morel stellte Bruno und LeRoux vor, und sie schüttelten einander die Hand. Garner trug einen teuer aussehenden grauen Anzug und ein blütenweißes Hemd mit Krawatte. Außer bonjour schien er kein Französisch zu sprechen, erwartete aber, dass alle Englisch mit ihm sprachen. Er kam aus Regina, einer dieser trostlosen Städte im Westen, in denen die Leute die Wörter Kunst, Theater und Literatur für anrüchig halten und am Wochenende lieber auf Murmeltiere und Bierflaschen schießen.
Morel blätterte in dem Obduktionsbericht, den die Lamartine vor einer knappen Woche abgeliefert und LeRoux bei einem Kaffee unter einer Parfumwolke und vielen Augenaufschlägen ausführlich erläutert hatte.
„Sie haben die Fotos ja bereits bekommen, Monsieur Garner. Die Tote ist eine etwa 15-jährige Indianerin, schwanger im 4. Monat. Schwere Misshandlungsspuren am ganzen Körper, Hämatome, Narben, Verbrennungen von Zigarettenkippen, Würgemale am Hals, außerdem Einstichstellen an beiden Unterarmen und Reste von Halluzinogenen im Blut.“
Morel hatte Schweißperlen auf der Stirn. Sein Englisch war so katastrophal, dass sich LeRoux nur mühsam sein Grinsen verkneifen konnte.
„Die Todesursache war ein aufgesetzter Schuss in die Schläfe, und sie hat circa zehn Tage im Wasser gelegen, bevor sie angeschwemmt wurde.“
„Kennen Sie das Kaliber?“, unterbrach Garner.
„Nein“, sagte Morel. „Kopfdurchschuss. Ein Projektil wurde nicht gefunden.“
Es wurde leider auch kein Ausweis oder ein Handy oder sonst irgendetwas, was eine Identifizierung möglich gemacht hätte, gefunden, dachte LeRoux. Bruno und er hatten sämtliche Vermisstenanzeigen gründlich geprüft, aber es gab keine, die passte. Es war einer dieser Fälle, auf die niemand wirklich Lust hat und die meist unaufgeklärt bleiben. Doch Morel hatte recht behalten. Diesmal gab es Druck. Und zwar erheblichen. Vielleicht war es der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wieder eine tote Indianerin.
Polizei bleibt untätig. Das war noch eine der harmloseren Schlagzeilen in der Montréal Gazette. Rassismusvorwürfe, Korruptionsvorwürfe, das Übliche. Pressekonferenz. Gespräche mit dem CNG. Proteste diverser Friends-of-the-Indian-Gruppen. Ein Serienmörder, der es auf Indianerinnen abgesehen hatte. Anforderung eines Profilers. Ted Garner, RCMP-Karriere-Hengst aus Saskatchewan.
Es klopfte, und Marie brachte Kaffee. Sie trug einen kurzen Rock und einen eng anliegenden Pullover. LeRoux zwinkerte ihr zu und sie lächelte. Während Morel lang und breit den Stand der bisherigen Ermittlungen erläuterte, machte Garner weiter sein Pokerface und schwieg. LeRoux schlürfte dankbar den heißen Kaffee und blickte Marie hinterher, als sie das leere Tablett hinaustrug. Sie hatte einen sexy Hintern. Als Morel endlich fertig war, verzog Garner die Lippen zu einem ironischen Lächeln und sagte nur: „Merci beaucoup pour les informations“. Anscheinend hatte er keine weiteren Fragen.
Seine Aussprache war noch schlechter als Morels Englisch. „Pardon, Monsieur?“, fragte LeRoux, doch entweder verstand Garner die Spitze nicht oder es kratzte ihn nicht.
Sie trotteten zurück in LeRouxs Büro. Morel hatte ihn angewiesen, eng mit Garner zusammenzuarbeiten und ihn ständig auf dem Laufenden zu halten. Das erste, was Garner tat, war, ihm die Hand hinzustrecken und zu sagen: „Ted“. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu sagen: „Jean-Baptiste“.
Sollte er sich die Zunge daran verrenken. Doch er blickte nur cool und fragte, ob es okay sei, J. B. zu sagen. J. B., sacrebleu.
Ohne eine Antwort abzuwarten, zog Garner eine Mappe aus seiner Aktentasche und begann, die Wände von Le-Rouxs Büro mit Fotos der verschwundenen Frauen zu verschönern. Er fragte noch nicht einmal um Erlaubnis. Darunter klebte er Zettel mit Fundstelle, Datum, Zustand der Leiche und Beschreibung der Todesursache. Nur fünf Namen, der Rest nicht identifiziert.
Audrey Cardinal, 23 Jahre, Cree Indianerin, zuletzt gesehen in Fort Fraser, B.C., von Jägern gefunden am 31. Oktober letzten Jahres in der Nähe von Burns Lake, vergewaltigt und erschlagen.
Martha Loon, 31, Cree Indianerin, hatte als Prostituierte in Sault Ste. Marie gearbeitet, zuletzt am Transcanada-Highway gesehen, wie sie in einen Truck einstieg. Ihre Leiche wurde am 23. März von einem Eisangler im Ranger Lake gefunden. Musste aus dem Eis geschnitten werden. Aufgesetzter Kopfschuss. Die Augen fehlten.
Vicki Hunter, Métis, 36, zuletzt gesehen am 19. Mai in Jasper, Alberta. Sie war getrampt, eine Familie aus Calgary hatte sie mitgenommen bis Red Pass. Wollte weiter nach Prince Rupert, Verwandte besuchen. Ihre Leiche wurde drei Wochen später bei Tête Jaune Cache gefunden. Misshandlungsspuren, vergewaltigt. Erwürgt. Täter nie gefasst.
LeRoux spürte, wie ihn eine große Müdigkeit überkam. Er musste sich zwingen, Garners Ausführungen zu folgen. Während seiner Ausbildung an der Polizeiakademie in Montreal war er voller Idealismus gewesen, hatte davon geträumt, die Welt sicherer und gerechter zu machen, doch je länger er bei der Sûreté war, desto sinnloser erschien ihm seine Arbeit.
Teresa St. Clair, Cree Indianerin, 17, zuletzt gesehen am 16. Juli in Medicine Hat, Alberta. Stammte aus dem Indianer-Reservat Blue Quills, nördlich von Edmonton. War unterwegs zu einem Powwow in Rocky Hill Montana, USA. Ihre Leiche wurde von einem Ranger in den Cypress Hills entdeckt. Mehrfach vergewaltigt, Messerstiche. Verblutet. Vermutlich mehrere Täter. Eine Festnahme, Peter McMillan, 19, freigelassen wegen Mangels an Beweisen.
Die Bilder der Ermordeten überfluteten sein Hirn wie Wellen eines verseuchten Meeres. Wieder überfiel ihn das Gefühl der Trostlosigkeit, das er in letzter Zeit immer häufiger spürte. Vielleicht hätte er Dichter werden sollen. Trinken, rumhuren und traurige Verse drechseln. Er dachte an Céline. 13:00 Uhr. Hotel de Paris. Er spürte Angst und gleichzeitig eine wilde Erregung. Er musste aufpassen, dass ihm sein Leben nicht entglitt.
Sandra Moses, 29, Cree Indianerin. Zuletzt gesehen am 18. September in Moose Jaw. Leiche im Ufergebüsch des Old Wives Lake gefunden. Misshandlungsspuren. Todesursache: ertrunken. Noch zwölf weitere Fotos, namenlos, als letztes die Leiche aus dem St. Lawrence. Erwürgt, erschlagen, erstickt, erschossen, ertrunken. Fast alle vergewaltigt. Sein Büro sah aus wie ein Gruselkabinett. Gleich müsste er kotzen. Sein Kopf schwirrte.
Garner trat einen Schritt zurück und betrachtete sein Werk mit der Zufriedenheit eines Galeristen, der eine vielversprechende Ausstellung eröffnet.
„Meinen Sie, es gibt da überhaupt einen Zusammenhang?“, fragte LeRoux.
„Vielleicht“, sagte Garner. „Vielleicht auch nicht. Vielleicht bei einigen.“
Er deutete auf zwei der Fälle, beide aus Ontario.
„Die zweite Leiche wurde am 3. Juni am Ufer des Ottawa River nicht weit vom Transcanada-Highway auf der Höhe von Deep River gefunden. Seltsamerweise fehlten auch hier die Augen. Aufgesetzter Kopfschuss, und“ – er machte eine vielsagende Pause – „selbes Kaliber wie bei Martha Loon.“ Garner kniff die Augen zusammen, näherte sich den beiden Fotos der Montreal-Leiche und vertiefte sich darin als mache er eine Zen-Meditation.
„Das Mädchen wurde in der City angespült?“
LeRoux nickte.
„Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, wo sie getötet wurde?“
„Nein“, sagte LeRoux.
Garner heftete seine grauen Augen auf ihn.
„Wenn sie zehn Tage im Wasser lag und wir die Strömungsgeschwindigkeit berechnen, könnte sie natürlich ebenfalls irgendwo in Ontario in der Nähe des Highways ermordet und in den Ottawa River geworfen worden sein. Ottawa und St. Lawrence fließen kurz vor Montreal zusammen. Doch genauso gut könnte sie auch jemand am Stadtrand von Montreal in Ufernähe versteckt haben und sie wurde vom Hochwasser mitgerissen.“
LeRoux nickte.
Garners Blick erinnerte ihn an ein Reptil.
„19 Morde in fünf Jahren auf einer Strecke von über 4 500 Kilometern. Es gibt keinerlei logische Verknüpfung.“
Außer, dass 18 Frauen Indianerinnen waren, fast alle getrampt sind, vergewaltigt und brutal ermordet wurden und kein einziger Fall aufgeklärt ist“, sagte LeRoux. Er fand selbst, dass seine Stimme pathetisch klang.
„Sie glauben nicht an den Zufall, J. B.?“
Garner fixierte ihn wie ein Hypnotiseur. Das Grau seiner Augen changierte in ein dunkles Meergrün, doch vielleicht war das nur das Lampenlicht.
„Keine Ahnung“, sagte LeRoux.
Garners Stimme war plötzlich von einer sonderbaren Intensität.
„Jede zufällige Begegnung ist eine Verabredung, jede Demütigung eine Buße, jeder Zusammenbruch ein geheimnisvoller Sieg, jeder Tod ein Selbstmord. Arthur Schopenhauer. Interessanter Gedanke, finden Sie nicht, J. B.?“
LeRoux zuckte mit den Achseln und schwieg. Was für ein Spinner, dachte er. Er fühlte sich wie in einem seltsamen Albtraum, in dem man mit einem fremden Menschen in einem engen Raum gefangen ist, aus dem es kein Entrinnen gibt. Er zündete eine Zigarette an und hielt Garner die Schachtel hin. Garner schüttelte den Kopf.
„Auf dem Transcanada fährt man stundenlang durch die Wildnis, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen“, fuhr er fort. „In Ontario und Alberta ist Hitchhiking verboten. Diese Squaws hatten eine Verabredung mit dem Schicksal. Und niemand scheint sie zu vermissen. Komisches Volk.“
LeRoux zog an seiner Zigarette und inhalierte tief. Er musste aufpassen, dass ihm nicht der Kragen platzte. Diese Frauen waren getrampt, weil sie kein Geld für den Bus oder für Benzin hatten. Weil sie ihre Familie besuchen oder zu einem Powwow oder sonst wohin wollten. Und es gab jede Menge Scheißkerle da draußen. Und das Schlimme war, dass die meisten ungeschoren davonkamen. Das Allerschlimmste jedoch war, dass es ihm mehr und mehr egal wurde. Er wünschte, Garner würde dahin zurückkehren, wo er hergekommen war, und sie könnten die Akte schließen. Doch Morel würde keine Ruhe geben. Er schien sich in die Sache mit den Highway-Morden festgebissen zu haben wie ein Terrier. Wenn die Sûreté einen Serienmörder stellen würde, wäre er die ganz große Nummer.
Wie es aussah, gab es jedoch nicht eine einzige brauchbare Spur. Drei Mal aufgesetzter Kopfschuss, zwei Mal dasselbe Kaliber. Das war’s. Er zwang sich, noch einmal an die Wand zu schauen und die Fälle der beiden Ontario-Morde zu studieren. Martha Loon. Sault Ste. Marie. Zuletzt gesehen, wie sie in einen Truck am Transcanada-Highway einstieg.
„Was ist mit dem LKW?“, fragte LeRoux. Garner runzelte die Stirn.
„Ein Grund, weshalb ich die ganze Strecke mit dem Auto gefahren bin, war, die Zeugin noch einmal zu befragen.“
„Und?“, fragte LeRoux.
„Die Zeugin war eine gewisse Lorraine Buffalo. Ebenfalls Indianerin, ebenfalls Prostituierte.“
Garner schwieg, LeRoux auch. Von ihm aus konnte Garner sich totschweigen. Er rauchte die Zigarette zu Ende und starrte aus dem Fenster. Der Himmel war von einem schmutzigen Wintergrau.
„Lorraine Buffalo ist verschwunden“, sagte Garner. „Niemand konnte mir sagen, wo sie ist.“
Er wäre auch gerne verschwunden, dachte LeRoux. Höchste Zeit, Garner loszuwerden. Er musste in einer Viertelstunde im Hotel sein. Céline war keine Frau, die man warten ließ.
„In dem Zeugenbericht steht, dass Martha Loon gegen 22:15 Uhr an der Esso Gas Station 436 Frontenac Street am Transcanada-Highway Richtung Sudbury in einen Truck gestiegen ist.
Schwer beladener Truck für den Holztransport. Fahrer männlich, weiß, 25 bis 30 Jahre alt. Trug eine Sonnenbrille. Sonst keine Hinweise.“
LeRoux stöhnte innerlich. Hoffentlich verlangte Morel nicht, dass sie die Fahrtenschreiber aller Holztransporter in Kanada mit weißen männlichen Fahrern zwischen 25 und 30 überprüften, denn dann würden sie bis zur Pensionierung an dem dämlichen Fall sitzen. Und das wegen einer indianischen Prostituierten, nach der eh kein Hahn mehr krähte. Außerdem war Ontario RCMP-Gebiet. Er musste los. Dringend. Garner starrte an die Wand und schien völlig in sich selbst versunken.
„Hören Sie, Ted“, fing LeRoux an. Er fand selbst, dass sich seine Stimme so schleimig anhörte wie die einer Kurtisane. „Ich habe noch einen wichtigen Termin. Bruno wird Sie mitnehmen in unsere Kantine. Wir sehen uns um zwei.“
Garner blickte kurz auf und lächelte sein kaltes Lächeln.
„Lassen Sie sich ruhig Zeit, J. B.“, sagte er.
Fuck you, dachte LeRoux.