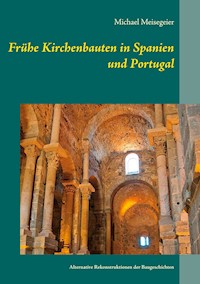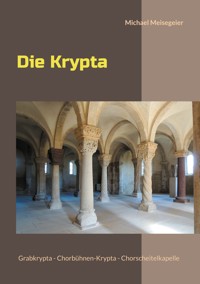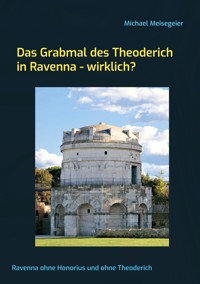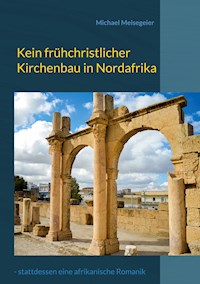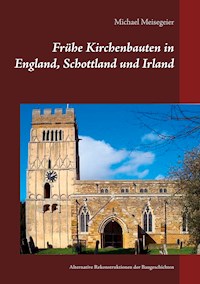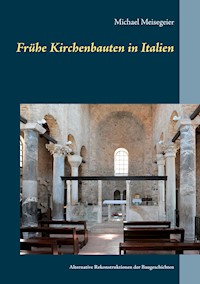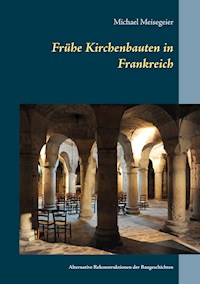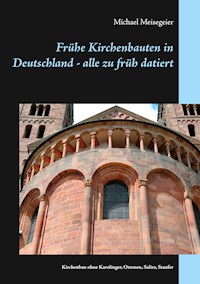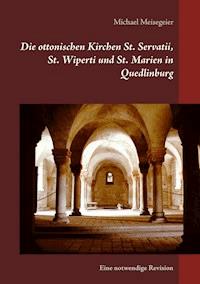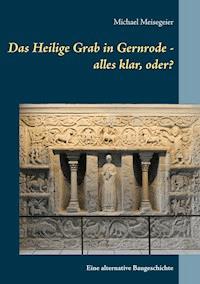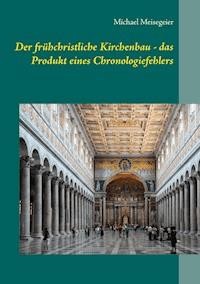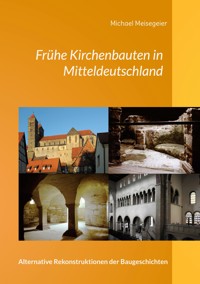
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die aktuellen Rekonstruktionen der Baugeschichten der frühen Kirchen basieren großenteils auf vermeintlich zeitgenössischen Schriftquellen, die real aber erst viel später, im späten Hochmittelalter oder sogar erst im Spätmittelalter entstanden sind. Die dort enthaltenen Informationen zum frühen Kirchenbau sind konstruiert. Genauso ist das früh- und hochmittelalterliche Geschichtsbild, das auf diesen Schriftquellen basiert, ein Konstrukt. Der Autor versucht, die Zusammenhänge diesbezüglich aufzudecken, und bietet für die wichtigsten Bauten Mitteldeutschlands, u. a. zu St. Servatius in Quedlinburg, dem Dom zu Halberstadt, St. Cyriakus in Gernrode, St. Maria in Memleben, dem Dom zu Magdeburg, alternative Rekonstruktionen der Baugeschichten an. Die vorliegende 4. Auflage beinhaltet gegenüber der vorherigen Auflage eine notwendige Korrektur der Konvertierung der traditionellen Datierungen und damit eine zeitliche Neueinordnung der Kirchenbauten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor wurde 1950 in Erfurt geboren. Er studierte in Weimar Bauingenieurwesen und schloss das Studium 1977 mit der Promotion ab. Danach war der Autor bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2015 in einem Erfurter Planungsbüro tätig.
Seit fast 50 Jahren beschäftigt sich der Autor mit romanischer und vorromanischer Kunst sowie mit der Geschichte des frühen Kirchenbaus vom frühchristlichen Kirchenbau bis zum Kirchenbau des 13. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 4. Auflage
Vorbemerkungen
Vorarbeiten
„Wie lange währte das erste Jahrtausend?“ - die HEINSOHN-These und die Rekonstruktion der Antike nach BEAUFORT
Das wohlstrukturierte Mittelalter von 911 bis 1313
Kirche, Papsttum, Kirchenbau
Expansion der römischen Kirche
König- und Kaisertum
Die christliche bzw. A.D.-Zeitrechnung
Die Ostertafeln
Phantomzeiten in der Chronologie
Die Konvertierung der traditionellen Datierungen
Bischöfe, Bistümer, Erzbistümer
Erfurt, der Dom Beatae Mariae Virginis, Stiftskirche St. Severi und Peterskirche
Peterskirche
Nonnenklosterkirche St. Paul und die Kirche St. Severi
Stiftskirche Beatae Mariae Virginis (Dom)
Versuch einer geschichtlichen Einordnung
Ohrdruf, St. Peter
Rohr, St. Michael
Göllingen, Kloster St. Wigbert
Memleben, St. Maria
Quedlinburg, Stiftskirche St. Servatius, Wipertikirche und St. Marien auf dem Münzenberg
Die Stiftskirche St. Servatius
Die Kirche St. Wiperti
St. Marien auf dem Münzenberg
Gernrode, St. Cyriakus
Goseck, Klosterkirche
Halberstadt, Dom St. Stephan und St. Sixtus
Magdeburg, Dom St. Mauritius und St. Katharina und Kloster Unser Lieben Frauen
Dom St. Mauritius und St. Katharina
Das Kloster Unser Lieben Frauen und die Liebfrauenkirche
Merseburg, Dom St. Johannes d. T. und St. Laurentius
Die Stiftskirche St. Johannes d. T.
Der Dom St. Johannes d. T. und St. Laurentius
Naumburg, Dom St. Peter und Paul
Zeitz, Dom St. Peter und Paul
Meißen, Dom St. Johannis und St. Donati
Weitere Veröffentlichungen des Autors zum frühen Kirchenbau (Auswahl)
Vorwort zur 4. Auflage
Bei meiner inzwischen etwa 50jährigen Beschäftigung mit dem Kirchenbau galt den frühen Kirchen in Mitteldeutschland immer mein besonderes Interesse. Zwei kleinere Publikationen im Jahr 2018 waren St. Cyriakus in Gernrode und dem dortigen Heiligen Grab sowie den drei, angeblich ottonischen Kirchen in Quedlinburg gewidmet. Folgerichtig musste ich mich mit weiteren mitteldeutschen Kirchenbauten befassen, die die Anfänge ihrer Baugeschichte ebenso wie Gernrode und Quedlinburg in frühmittelalterliche Zeit verorten. Seit meiner letzten diesbezüglichen Arbeit sind wieder fünf Jahre vergangen.
Obwohl ich in diesem Jahr bereits eine überarbeitete Neuauflage (3. Auflage) veröffentlicht habe, hat der weitere Fortschritt meiner Arbeit die Notwendigkeit einer erneuten Überarbeitung ergeben.
Wesentlicher Anlass für die vorangegangene Auflage war meine These zur Konvertierung der traditionellen Datierungen. Inzwischen musste ich feststellen, dass mein erster Ansatz dazu noch nicht ausreichend war und zu irrigen Ergebnissen geführt hat. Auch musste ich mich bezüglich der A.D.-Datierung korrigieren. Da auch ich mich bei meiner Arbeit auf Neuland bewege, sind Irrtümer nicht immer auszuschließen. Ich bitte im Voraus um Nachsicht.
In der vorliegenden 4. Auflage versuche ich, diese Unstimmigkeiten entsprechend dem aktuellen Stand zu beheben.
Meinen Ausführungen muss ich einen Abschnitt Vorarbeiten voranstellen, damit der Leser die Grundlagen und meine Herangehensweise einigermaßen nachvollziehen kann.
Ich muss den Leser vorwarnen. Aufgrund meiner von der traditionellen Sichtweise grundsätzlich abweichenden Auffassung zur tatsächlichen Ereignisgeschichte haben meine Ausführungen zwangsläufig teils spekulativen Charakter. Genauso sind diesbezügliche Zirkelschlüsse unvermeidlich.
Ich sehe das nicht als Nachteil. Gegenüber der großflächigen Konstruktion (Fälschung) der antiken und mittelalterlichen Geschichte sehe ich das als vernachlässigbare Sünde.
Fremdsprachige Zitate werden - entgegen den akademischen Regeln - in der Übersetzung wiedergegeben, um die Verständlichkeit des Textes beizubehalten.
Für die Übersetzung der fremdsprachiger Texte habe ich vorwiegend die kostenlose Version von www.DeepL.com/Translater verwendet. In den Zitaten evtl. vorhandene Quellenangaben habe ich weggelassen. Interessenten mögen diese bei Bedarf aus den von mir zitierten Quellen entnehmen.
Auf die Wiedergabe von Fotos der Kirchenbauten habe ich (bis auf Ausnahmen) verzichtet. Im Internet stehen zu jedem besprochenen Bau wesentlich mehr Fotos zur Verfügung als ich hier je veröffentlichen könnte. Zum anderen möchte ich keine Urheberrechte verletzen. Die wenigen Fotos, die in diesem Buch enthalten sind, sind eigene Aufnahmen.
Vorbemerkungen
Mitteldeutschland, das sind heute die Bundesländer Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, hat eine Reihe von sehr alten Kirchenbauten aufzuweisen, deren angebliche Gründungen z. T. bis in das 8. Jh. zurückreichen.
So wird z. B. die Gründung des Doms zu Erfurt, richtiger der Stiftskirche Maria Beatae Virginis, mit Bonifatius in Verbindung gebracht, wobei die Archäologie bisher keine Spuren des 8. Jh. nachweisen konnte. Die frühesten baulichen Reste, die ergraben wurden, gehören - so die Archäologen - dem 12. Jh. an.
Dagegen gibt es Grabungsergebnisse im Halberstädter Dom, die vermeintlich einen Kirchenbau um 800 "belegen".
Hauptsächliche Grundlage für die Rekonstruktion der Baugeschichten eigentlich aller frühen Kirchen in Mitteldeutschland als auch andernorts war bisher die schriftliche Überlieferung - die so genannten zeitgenössischen Schriftquellen. Geschichte wie auch Baugeschichte beruhte zum größten Teil auf den Informationen der Schriftquellen.
Die Archäologie wurde nur ergänzend zu Rate gezogen, sozusagen zur Bestätigung der schriftlichen Quellen. Wenn sich die archäologischen Ergebnisse mit der schriftlichen Überlieferung nicht decken, wie z. B. in Magdeburg, tritt großes Rätselraten ein. Es gibt natürlich auch den anderen Fall, wo bedeutende archäologische Befunde vorliegen und dazu keine Schriftzeugnisse existieren, wie in Unterregenbach, weswegen noch heute vom "Rätsel von Regenbach" gesprochen wird.
Eine scheinbare Deckung von schriftlicher Überlieferung und baulichen Zeugen ist natürlich noch kein Beleg für eine richtige Rekonstruktion der Baugeschichte, da selbstverständlich auch eine Fehlinterpretation der archäologischen Befunde vorliegen kann.
Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass die von den Experten manchmal mit großer Selbstsicherheit dargebotenen Rekonstruktionen der Baugeschichten dieser frühen Kirchenbauten immer nur Interpretationen der den Rekonstruktionen zugrunde liegenden Quellen sind, ob Schriftquellen und/oder Quellen materieller Art wie Grabungsbefunde. Damit sind sie naturgemäß erst einmal rein subjektive Auslegungen und potentiell fehlerbehaftet (Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass das auch für meine Ausführungen gilt).
Gerade die sehr unterschiedlichen Rekonstruktionen z. B. der Baugeschichte der Stiftskirche St. Servatius in Quedlinburg - obwohl alle auf denselben bauarchäologischen Untersuchungen fußen - belegen die große Unsicherheit bei den Experten zum Thema des frühesten Kirchenbaus in Mitteldeutschland.
Der Blick auf die anderen frühen, mitteldeutschen Kirchenbauten zeigt ein ähnliches Bild.