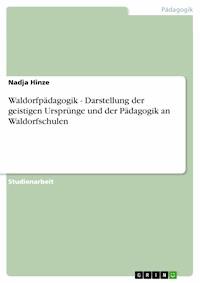15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 1,0, Universität Leipzig (Förderpädagogik), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Methode der Heilpädagogischen Übungsbehandlung wurde von Clara Maria von OY und Alexander Sagi konzipiert. Im Jahre 1975 erschien dazu in erster Auflage das „Lehrbuch der heilpädagogischen Übungsbehandlung“. Mittlerweile existiert es bereits in seiner 10. Auflage. In ihm werden Erfahrungen und Überlegungen aufgezeigt, wie das Spiel des Kindes als methodische Hilfe für das entwicklungsverzögerte und geistig behinderte Kind eingesetzt werden kann. OY selbst bezeichnet ihre Methode als „Methode mit Herz“, mittels derer bei den Kindern neue Kenntnisse, Fähigkeiten und sinnvolle Verhaltensweisen in Einzel- und Gruppensituationen geweckt, entwickelt und gefestigt werden. Im konzentrierten aufeinander Hören soll unter Berücksichtigung der individuell verschiedenen Möglichkeiten – so wie es die Persönlichkeit des behinderten Menschen unter den gegebenen Umständen verlangt – eine systematische ganzheitliche Förderung erreicht werden. Ein wichtiger Bestandteil ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. In meinen Ausführungen möchte ich das Konzept der Heilpädagogischen Übungsbehandlung nach C.M. Oy und A. Sagi vorstellen. Nach einer allgemeinen Definition gehe ich auf das wesentliche Merkmal ein, dem Spiel. Anschließend wird die Methode der HPÜ differenzierter beschrieben und durch Überlegungen für die Praxis näher beleuchtet. Zum Schluss nehme ich persönlich Stellung zur konzipierten Methode der beiden Autoren des oben aufgeführten Buches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
1 Was ist HPÜ? - Definition der Heilpädagogischen Übungsbehandlung
2 Wesen und Bedeutung des Spiels für das behinderte und das nichtbehinderte Kind
2.1 Was macht das Spiel zum Spiel? - Definition Spiel
2.2 Für das nichtbehinderte Kind
2.3 Für das behinderte Kind
2.4 Spiel und Übung
2.5 Spiel und Lernen
2.6 Spielformen (nach Schenk-Danzinger)
3 Methode der heilpädagogischen Übungsbehandlung
3.1 Voraussetzungen
3.2 Bedingungen für alle Begegnungen in der HPÜ
3.3 Durchführung
4 Praxis der Heilpädagogischen Übungsbehandlung
4.1 Raum - Material - Person - Orientierung
4.2 Methodisch-didaktische Überlegungen
4.3 Auswahl und Einsatz von Spielzeug und Spieltätigkeiten
5 Kritische Überlegungen
6 Literatur
Einleitung
„Spielend spielen lernen“
C.M. Oy / A. Sagi
Die Methode der Heilpädagogischen Übungsbehandlung wurde von Clara Maria von OY und Alexander Sagi konzipiert. Im Jahre 1975 erschien dazu in erster Auflage das „Lehrbuch der heilpädagogischen Übungsbehandlung". Mittlerweile existiert es bereits in seiner 10. Auflage. In ihm werden Erfahrungen und Überlegungen aufgezeigt, wie das Spiel des Kindes als methodische Hilfe für das entwicklungsverzögerte und geistig behinderte Kind eingesetzt werden kann. OY selbst bezeichnet ihre Methode als „Methode mit Herz", mittels derer bei den Kindern neue Kenntnisse, Fähigkeiten und sinnvolle Verhaltensweisen in Einzel- und Gruppensituationen geweckt, entwickelt und gefestigt werden. Im konzentrierten aufeinander Hören soll unter Berücksichtigung der individuell verschiedenen Möglichkeiten - so wie es die Persönlichkeit des behinderten Menschen unter den gegebenen Umständen verlangt - eine systematische ganzheitliche Förderung erreicht werden. Ein wichtiger Bestandteil ist die Zusammenarbeit mit den Eltern.
1 Was ist HPÜ? - Definition der Heilpädagogischen Übungsbehandlung
Die Heilpädagogische Übungsbehandlung, kurz auch HPÜ genannt, ist nach Clara Maria von OY und Alexander SAGI eine, Methode der systematischen Hilfe für entwicklungsgestörte und geistig behinderte Menschen, vor allem für Kinder und Jugendliche. Im Spiel und durch das Spiel werden bei den Kindern neue Kenntnisse, Fähigkeiten und sinnvolle Verhaltensweisen angeregt. Dies geschieht durch ein ausgewogenes Angebot von Übungseinheiten und unter Beachtung der individuellen Möglichkeiten. In Einzel- und Gruppensituationen werden die geweckten Prozesse weiterentwickelt und gefestigt.
Bei der HPÜ werden alle Fähigkeiten gefördert: also emotionale, sensorische, motorische, soziale und kognitive Fähigkeiten. Somit ist das Konzept der Heilpädagogischen Übungsbehandlung grundsätzlich auf die Gesamtförderung des Kindes ausgerichtet.
Betrifft die Störung nur Teilbereiche (Teilleistungsschwächen unterschiedlicher Ursachen) sollen diese durch ein vielfältiges Angebot an Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten in der optischen, akustischen sowie taktilen Erfassung und Differenzierung der Umwelt ausgeglichen werden.
2 Wesen und Bedeutung des Spiels für das behinderte und das nichtbehinderte Kind
2.1 Was macht das Spiel zum Spiel? - Definition Spiel
Entwicklungspsychologisch betrachtet zeichnet sich das Spiel des Kindes durch folgende Merkmale aus: Der Sinn des Spiels liegt in sich selbst. Eigene Ideen werden kreativ umgesetzt, was den Spielenden Spaß und Freude bereitet. Kinder spielen von sich aus, d.h. sie sind intrinsisch motiviert. Das Spiel ist jede Tätigkeit, die um ihrer selbst willen getan wird. Es ist dem Entwicklungstand des Kindes entsprechend und ein spontanes und angeborenes Verhalten, was nicht unmittelbar zweckmäßig und lebenserhaltend erscheint. Beim Spielen werden alle Sinne angeregt, das Sozialverhalten geschult wie auch der Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Äußerst wichtige Merkmale sind die Zweckfreiheit, die Folgenlosigkeit und der fehlende Leistungsdruck.
Für die Entwicklung des Kindes ist das Spiel von besonderer Bedeutung. Funktionen (motorische, sprachliche, soziale, kognitive) werden entwickelt, Handlungskompetenzen aufgebaut, das Erkennen des Sinns von Erlebnissen und die Verarbeitung von Situationen, Ängsten u.v.m. wird unterstützt.
Wird das Kind aber ganz oder teilweise längere Zeit am Spielen gehindert, so weist es nachher schwere Entwicklungsschäden auf.
2.2 Für das nichtbehinderte Kind
Die Aktivität und die Initiative zum Spiel entwickeln sich beim nichtbehinderten Kind gleichsam von selbst. Dabei muss Raum, Spielmaterial, Zeit, Ruhe, eine spannungsfreie Atmosphäre und zeitweise die Bereitschaft zum Mitspielen gewährt werden.
Durch Beobachtung, Nachahmung undÜbunglernt das Kind spielend den Umgang mit den Dingen seiner erreichbaren Umgebung und entwickelt so einVerhältniszur Umwelt.
Spiel hat keinen materiellen Zweck, keinen Leistungs- oder Erfolgszwang. Sein Wert besteht in der spielerischenTätigkeitan sich.Für spätere Fähigkeitenhat das Spiel eine enorme Bedeutung:KörperlicheGeschicklichkeit, die Beherrschung der Sprache als Ausdrucks- und Informationsmittel, dieEinübungvon sozialen Verhaltensweisen, die Entwicklung von Verhaltensstrategien beimproblemlösendenDenken und Handeln werden geschult. Das Spiel ist keine Lehre, sondern eine Erprobung. Nichtsdestotrotz lernt das Kind im Spiel, erwirbt mit seinerTätigkeit Fähigkeitenund Fertigkeiten, macht neue Erfahrungen und wird gleichzeitig auf Erwachsenenalter vorbereitet.