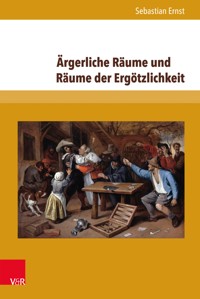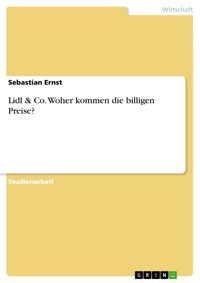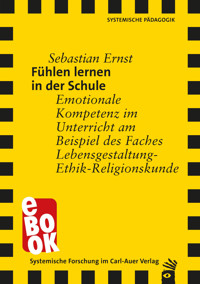
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: Verlag für systemische Forschung
- Sprache: Deutsch
Emotionen beeinflussen in notwendiger Hinsicht und tiefgreifender Weise unser Leben. Sie wirken beträchtlich auf unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser Handeln ein. Das gilt für alle Bereiche des Alltags. Hinzu kommt, dass sie seitens verschiedenster Akteur:innen dazu genutzt werden, uns zu überzeugen, zu interessieren und zu manipulieren. Wenn unsere Emotionen derart entscheidend unser Leben bestimmen, derart tiefgreifend unsere politischen Handlungen, unser soziales Miteinander und letztlich auch unser individuelles Glück beeinflussen, dann kommen wir nicht umhin, den kompetenten Umgang mit ihnen zum Ziel schulischer Bildung zu machen, denn immerhin sollte Bildung darauf abzielen, die Lernenden fit für die Lebenswelt zu machen bzw. sie darauf vorzubereiten, sich in dieser selbstbestimmt, autonom und reflektiert bewegen zu können. Die eigenen Emotionen (er)kennen und bewältigen zu können sowie mit den Emotionen anderer umzugehen, ist Voraussetzung dafür. Damit emotionale Kompetenz sich im Unterricht fördern lässt, muss jedoch zunächst geklärt werden, was genau darunter verstanden werden kann. Das ist ein Ziel dieses Buches. Darüber hinaus geht es darum, am Beispiel des Faches Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde, wie es im Bundesland Brandenburg unterrichtet wird, eine fachspezifische Ausprägung dessen zu entwickeln. Da sich emotionale Kompetenz nicht mal eben nebenbei und als Ganzes fördern lässt, muss sie entsprechend kleingearbeitet werden, um für den Unterricht handhabbar zu werden. Auch dafür möchte dieses Buch ein Beispiel liefern, an dem sich Lehrkräfte orientieren können. Der Autor: Sebastian Ernst, Dr., studierte Geschichte und Philosophie und promovierte an der Universität Potsdam im Bereich der Sozialgeschichte. Anschließend arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam in der Fachdidaktik des interdisziplinären Faches Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Digital-Game-Based-Learning, Emotionen in Bildungsprozessen, Geschichtsphilosophie und -theorie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Verlag für Systemische Forschung
im Carl-Auer Verlag
Sebastian Ernst
Fühlen lernen in derSchule
Emotionale Kompetenz im Unterricht am Beispiel des Faches Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde
2025
Carl-Auer im Internet: www.carl-auer.de
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Carl-Auer Verlag
Vangerowstr. 14
69115 Heidelberg
Über alle Rechte der deutschen Ausgabe verfügt der Verlag für Systemische Forschung im Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg
Fotomechanische Wiedergabe nur mit Genehmigung des Verlages
Reihengestaltung nach Entwürfen von Uwe Göbel
Printed in Germany 2025
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-9088-2 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-9089-9 (ePub)
DOI: 10.55301/9783849790882
© 2025 Carl-Auer-Systeme, Heidelberg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Die Verantwortung für Inhalt und Orthografie liegt beim Autor.
Für Dany
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Einleitung
Grundlagen
Theoretische Grundlagen
Persönliche Grundlagen
Emotionale Kompetenz als Bildungsziel?
Emotionen – ein Bestimmungsversuch
Folgen mangelnder Emotionale Kompetenz
Schule als emotionaler Raum
Wirkung von Emotionen auf Lehr-Lern-Prozesse
Emotionale Kompetenz als Mittel zur Beseitigung von Störungen
Emotionen und Wissenschaft
Emotionale Kompetenz als Metakompetenz
Emotionale Kompetenz bisher
Allgemeine Modelle
Fachspezifische Modelle
Emotionale Kompetenz im Fach LER
Das Fach LER
Lebenswelt(en)orientierung
Eine fachspezifische Emotionale Kompetenz
Wahrnehmen und Beschreiben
Deuten
Argumentieren und urteilen
Kommunizieren und Interagieren
Emotionale Kompetenz in Kurzform
Emotionale Kompetenz „unterrichten“ und LER als Vorreiterin – ein vorläufiger Abschluss
Literaturverzeichnis
Danksagung
Ein Buch, ganz gleich, ob es sich dabei um einen Roman oder eine wissenschaftliche Abhandlung handelt, ist niemals das Ergebnis einer einzelnen Person. Das gilt auch für dieses hier. Viele, die an diesem mitgearbeitet haben, wissen nichts davon. Die meisten kann ich selbst nicht einmal benennen. Alles, was mir begegnet ist, alles, was ich erlebt habe, und jedes Gespräch, das ich je führte, hat seinen Anteil daran. Ob ich mir dessen nun bewusst bin oder nicht. Sehr wohl bewusst bin ich mir aber des Einflusses einiger sehr lieber Menschen, bei denen ich mich an dieser Stelle und stellvertretend für alle, die noch dazu beigetragen haben mögen, bedanken möchte. Lieber Ralf und liebe Petra, für die vielen inspirierenden Gespräche, die anregenden Gedanken, die gemeinsamen Momente der Freude und des Ärgers, für euren Glauben an mich und vor allem für eure Freundschaft bin ich euch unendlich dankbar. Liebe Joey, der Austausch, den wir im Zuge deiner Masterarbeit hatten, war für mich ebenso hilfreich und spannend wie für dich. Danke, dass ich dich auf diesem Weg begleiten durfte. Besonders dankbar bin ich auch Felix, der mit viel Mühe das Manuskript durchgesehen und mir wichtige Anregungen gegeben hat. Ebenfalls möchte ich mich an dieser Stelle auch noch bei allen teilnehmenden Studierenden am Kurs „We think too much and feel too little“ (Charlie Chaplin) – Emotionale Kompetenz im LER-Unterricht für die vielen anregenden Diskussionen bedanken.
Mein besonderer Dank gilt auch allen Menschen, die mich auf meiner eigenen emotionalen Reise unterstützt haben.
Liebe Dany, unsere eigene emotionale Reise hat mich und letztlich auch dieses Buch geprägt. Ich bin dir dankbar für unsere Gespräche, die mich stets inspirieren, aber auch herausfordern. Ich bin froh, dass du in meinem Leben bist und mit mir gemeinsam mutig diesen Weg gehst.
Liebe Sandra, deine professionelle wie freundschaftliche Begleitung hat mich vieles gelehrt. Du warst eine wichtige Stimme in meinem eigenen Entwicklungsprozess, der mich emotional gestärkt und mehr zu mir selbst geführt hat. Danke, dass es dich gibt.
Liebe Caro, für deine Unterstützung in einer schweren, emotional herausfordernden Zeit, die mir selbst einiges an Emotionaler Kompetenz abverlangt hat, bin ich dir ebenfalls sehr dankbar.
Abschließend gilt mein besonderer Dank Sandra Lode und dem Carl-Auer Verlag für die Unterstützung bei der Realisierung dieses Projekts.
Einleitung
„Vollbepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend-Feeling!
Mit Zott Sahnejoghurt, sahnig, fruchtig, frisch und dann hinein ins Weekend-Feeling!
Mmmh, lass dich mal geh'n, schalt einfach ab, erleb den sahnigen Geschmack!
Mit Zott ins Weekend-Feeling!“
Manche von Ihnen werden diesen Werbesong aus den 1990er-Jahren noch kennen. Ich kann mich jedenfalls sehr gut daran erinnern. Falls es Ihnen wie mir geht, haben Sie vielleicht auch gleich die Melodie zu dem Text im Ohr (falls ja, tut es mir ehrlich leid) und sehen die glückliche Familie aus der Werbung vor ihrem geistigen Auge. Schiebe ich den Gedanken daran, dass mich die Musik jetzt wieder für eine Weile als Ohrwurm verfolgen wird, beiseite, bekomme ich sofort wieder gute Laune. Wochenende, Sonnenschein und Lachen. Was jetzt noch fehlt, ist ein leckerer Joghurt. Und genau darum geht es. Beworben wird hier nicht so sehr das Produkt selbst, sondern die besungene wohlige Wochenendstimmung. An diese sollen wir uns beim Einkauf im Supermarkt erinnern, um dann gezielt zu genau dem auf diese Weise beworbenen Joghurt zu greifen. Auch wenn der Werbesong nun schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel hat, das dahinterstehende Werbekonzept ist weiterhin aktuell.1
Emotionen verkaufen. Sie gehören zu den entscheidenden Faktoren im Marketing. Es verwundert daher nicht, dass ein gewisses Maß an Emotionaler Intelligenz auch mehr und mehr zu einer gefragten Kompetenz von Verkäufer:innen wird, die es zu trainieren und auszubauen gilt.2
Aber nicht nur im Verkauf von Waren und Dienstleistungen wird auf Emotionen gesetzt. Auch in der Politik wird mit oder besser auf den Gefühlen der Wähler:innen gespielt.3 Dabei geht es in erster Linie darum, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Entsprechend zeigen sich Politiker:innen nahbar, menschlich, als Teil der Gemeinschaft. Die potenziellen Wähler:innen sollen sich von den Volksvertreter:innen gesehen und verstanden fühlen. Sie sollen sich für die eigenen Sichtweisen und Maßnahmen begeistern oder diese zumindest hinnehmen. Um das zu erreichen, werden gezielt emotionale Botschaften gesendet. Es wird Hoffnung gemacht („Wir schaffen das!“) oder es werden Ängste geschürt („Masseneinwanderung“). Nicht selten wird auch auf Wut gesetzt. So dienen emotionale bzw. emotionalisierende Zuschreibungen („Wutbürger“, „Chaoten“, „Sozialschmarotzer“, „Klima-Kleber“) dazu, die Bedürfnisse und Forderungen bestimmter Menschen(-gruppen) zu delegitimieren, um eine inhaltliche Debatte in eine bestimmte Richtung zu lenken oder gleich ganz zu verhindern. Man weiß ja, was das für welche sind. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch die demonstrativ zur Schau gestellte öffentliche Empörung über die jeweilige Gegenseite und deren Vorschläge, die immer auch dazu dient, ähnliche Gefühle bei den potenziellen Wähler:innen zu wecken. Auf der anderen Seite wird die eigene Emotionalität in den politischen Debatten aber auch ausgeblendet, wenn es darum geht, sich als besonders rational, objektiv und besonnen zu inszenieren. Die eigenen Emotionen sind dann fehl am Platz. Die Gefühle der politischen Gegner:innen erscheinen dann als geradezu obszön und werden zum Ausdruck mangelnder Debattierfähigkeit stilisiert. Ironischerweise soll auch gerade das wiederum bei den Wähler:innen positive Emotionen erzeugen.
Wer ebenfalls, sei es im privaten oder beruflichen Leben, immer den richtigen Grad an Emotionalität zeigen oder die eigene Gefühlslage und damit sich selbst besser verstehen möchte, der findet Hilfe in Form von Coachings, Ratgebern und Trainingsprogrammen. Das Internet, die Buchhandlungen und Zeitschriftenregale sind voll davon.4 Sie alle versprechen uns ein glücklicheres oder beruflich erfolgreicheres Leben führen zu können, wenn wir nur mehr in Kontakt mit unseren Emotionen sind, sie kontrollieren können und dazu in der Lage sind, sie gezielt einzusetzen.
Was die Praktiker:innen in all den genannten Bereichen schon lange wissen, wird zunehmend auch seitens der wissenschaftlichen Forschung konstatiert: Emotionen beeinflussen in notwendiger Hinsicht und tiefgreifender Weise unser Leben. Sie wirken beträchtlich auf unsere Wahrnehmung, auf unser Denken und unser Handeln ein. Das gilt für alle Bereiche des Alltags.
Wenn unsere Emotionen nun derart entscheidend unser Leben bestimmen und zugleich ständig versucht wird, uns mittels unserer Gefühle zu manipulieren, dann kommen wir meines Erachtens tatsächlich nicht umhin, uns mit unserer Emotionalität auseinanderzusetzen. Die eigenen Emotionen (er)kennen und bewältigen zu können sowie mit den Emotionen anderer umzugehen, erscheint unter diesen Bedingungen Voraussetzung dafür zu sein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Der Grundstein, wie wir Gefühle verstehen und wie wir mit diesen umgehen, wird vor allem in der Kindheit und Jugend gelegt. In dieser Zeit wachsen wir in die jeweilige Emotionskultur hinein.5 Zunächst erlernen anhand des Verhaltens unserer Eltern, wie Beziehungen funktionieren, wie mit Konflikten umzugehen ist, welche Emotionen erlaubt sind, wie sie ausgedrückt werden und was gar nicht geht. Später verändern und verfeinern wir das Gelernte dann im Kontakt mit anderen Menschen, unserer weiteren Familie, Freunden, Partner:innen und nicht zuletzt auch den Medien. Der Pubertät kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Sie ist eine Zeit großer emotionaler Herausforderungen, die als jugendspezifische Entwicklungsaufgaben auftreten. Dazu gehören der Ablöseprozess von den Eltern, das Eingehen der ersten romantischen und sexuellen Beziehungen sowie die verstärkte Suche nach dem eigenen Platz in der Welt.
Die Angebote und Varianten, mit denen wir auf der Suche nach unserem eigenen Umgang mit Emotionen konfrontiert werden, sind vielfältig und widersprechen sich teils. Macht es uns nun glücklicher, immer positiv zu denken und negative Emotionen zu ignorieren oder diese doch lieber auszuleben? Ist es okay, wütend zu sein oder führt eine stoische Haltung eher zum Glück? Sollen wir Emotionen zeigen oder sie lieber für uns behalten? Wie sollen wir sie zeigen und wann? Welchen Angeboten wir begegnen, ist dabei letztlich zufällig und abhängig davon, wie wir aufwachsen, welche Medien wir konsumieren und wie unser Umfeld auf unsere Versuche, unsere Emotionen zu handhaben, reagiert.
Aus diesem Konglomerat bilden sich schließlich unsere eigenen emotionalen Muster, mit denen wir als Erwachsene unser Leben und die Dinge, die uns da geschehen und begegnen, bewältigen. Eine mangelnde Kompetenz im Umgang mit vor allem den eigenen Emotionen in dieser wichtigen Phase hinterlässt entsprechend tiefe Spurrinnen, aus denen sich später schwer entkommen lässt.6
Das alles spricht meines Erachtens dafür, Emotionale Kompetenz ausdrücklich auch in der Schule zu entwickeln und zu fördern. Die Schule sollte nicht nur der Ort sein, an dem wir für das Leben lernen, es ist auch der Ort, an dem für Kinder und Jugendliche viel vom Leben stattfindet. Hier werden Freundschaften geknüpft, Konflikte bewältigt, Beziehungen diskutiert und gänzlich neue Anforderungen im sozialen Miteinander erlebt. Emotionale Kompetenz ist nötig, um all das zu bewältigen. Daraus ergibt sich eine gewisse Dringlichkeit, gerade in dieser Lebensphase damit nicht allein gelassen zu werden oder die emotionale Kompetenzentwicklung den mitunter widersprüchlichen medialen Angeboten zu überlassen.
Um Emotionale Kompetenz zum Ziel schulischer Bildung zu machen, muss aber zunächst einmal geklärt werden, was genau unter Emotionaler Kompetenz verstanden werden kann. So ganz einig ist man sich da nämlich noch nicht. Sind Emotionale Kompetenz und Emotionale Intelligenz das gleiche? Worauf kommt es eigentlich genau an? Soll ich meine eigene Gefühlslage erkennen und ausdrücken können oder eher die der anderen verstehen? Geht es eher darum, Emotionen zu akzeptieren oder sie zu verändern? Sollen diese in bestimmten Bereichen gar unterdrückt oder auch inszeniert werden können? Dies ist die erste Frage, die ich im Rahmen dieses Buches klären möchte. Nicht ein für allemal, sondern als Angebot, als eine Möglichkeit, die mir aus verschiedenen Gründen sinnvoll erscheint.
Ist klar, worin Emotionale Kompetenz besteht, muss als nächstes entschieden werden, welches Fach bzw. welcher Fächer wie dafür zuständig sein soll, diese zu entwickeln. In meiner Überlegung gehe ich davon aus, dass das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde wie es im Bundesland Brandenburg unterrichtet wird, dafür prädestiniert ist und zugleich als gutes Beispiel vorangehen kann. Warum ich das denke, werde ich entsprechend darlegen. Anschließend wird es mir darum gehen, ein Modell einer fachspezifischen Emotionalen Kompetenz zu formulieren und hier zur Diskussion zu stellen. An diesem können sich dann andere Fächer orientieren oder bewusst davon abgrenzen, um ihren ganz eigenen Beitrag zu finden.
Da sich Emotionale Kompetenz nicht mal eben nebenbei und als Ganzes fördern lässt, muss diese entsprechend kleingearbeitet werden, um diese für den Unterricht handhabbar zu werden. Auch dafür möchte ich in diesem Buch ein Beispiel liefern, an dem sich Lehrkräfte orientieren können.
Damit sollte klar sein, worum es mir in diesem Buch geht. Daher bleibt mir an dieser Stelle nur noch, Ihnen viel Spaß beim Lesen zu wünschen!
1Siehe für einen kleinen Einblick Chab, Lara: Emotional Marketing – Wie Emotionen unser Kaufverhalten beeinflussen, Wissenschaftsblog, 08.04.2021, online unter: https://www.wipub.net/emotional-marketing-wie-emotionen-unser-kaufverhaltenbeeinflussen/.
2Vgl. für einen Einblick Bittner, Gerhard; Schwarz, Elke: Emotion Selling. Messbar mehr verkaufen durch neue Erkenntnisse der Neurokommunikation, Wiesbaden 2015, Kettler, Jörn: Mit Empathie verkaufen. Emotionale Intelligenz als Sales-Code – so finden Sie den besten Zugang zum Kunden, Wiesbaden 2021, Bosch, Christian; Schiel, Stefan; Winder, Thomas: Emotionen im Marketing. Verstehen – Messen – Nutzen, Wiesbaden 2006, Sigg, Barbara: Emotionen im Marketing. Neuroökonomische Erkenntnisse, Bern u. a. 2009.
3Für einen Überblick über die verschiedenen Ebenen auf denen Emotionen eine Rolle für Politik siehe Zimmermann, Mechthild: Wohldosierte Emotionen, 2022, online unter: https://www.mpg.de/18101870/regieren-mit-gefuehl. Für einen Einblick in die Debatte siehe Kesting, Marietta; Witzgall, Susanne (Hg.): Politik der Emotionen/Macht der Affekte, Zürich 2021, Flemming, Felix: Die Ängste der Wähler. Entstehungsbedingungen und Folgen für die Wählermobilisierung, Wiesbaden 2020, Jensen, Uffa: Zornpolitik, Berlin 2017 und Korte, Karl-Rudolf (Hg.): Emotionen und Politik. Begründungen, Konzeptionen und Praxisfelder einer politikwissenschaftlichen Emotionsforschung, Baden-Baden 2015. Besonders aufschlussreich ist hierbei die politikdidaktische Debatte. Siehe dazu Petri, Annette: Emotionssensibler Politikunterricht. Konsequenzen aus der Emotionsforschung für Theorie und Praxis politischer Bildung, Frankfurt am Main 2018 und Frech, Siegfried; Richter, Dagmar (Hg.): Emotionen im Politikunterricht, Frankfurt am Main 2019.
4Wer bei einer Suchmaschine seiner Wahl „Glücksratgeber“, „Emotionscoach“ oder „Emotionen regulieren“ eingibt, wird förmlich erschlagen von Suchergebnissen. Machen Sie den Test und schauen Sie sich mal um!
5Vgl. Gerlach, Theresa: Im Unterricht über Gefühle sprechen? Emotionales Verständnis fördern, in: Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF) Nr. 4 (2015), S. 3, online unter: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/inklusion/PDFs/ZEIF-Blog/Gerlach_2015_Im_Unterricht_%C3%BCber_Gef%C3%BChle_sprechen.pdf.
6Zu den möglich Folgen beispielsweise in Form psychischer Erkrankungen siehe Welding, Carlotta: Fühlen lernen. Warum wir so oft unsere Emotionen nicht verstehen und wie wir das ändern können, 2. Aufl., Stuttgart 2023.
Grundlagen
„Was wir sehen ist nicht, was wir sehen, sondern das, was wir sind!“
(Fernando Pessoa)
Bevor nun mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden kann, sollten deren Grundlagen geklärt sein. Das gilt sowohl für die theoretischen wie auch die persönlichen. Es geht mir dabei darum, offenzulegen, von welchem Standort aus ich schreibe, also welche Vorannahmen, Denkmuster und Theorien meinen Blick bestimmen und welche Erfahrungen mein Vorgehen prägen. Auf diese Weise möchte ich nicht nur einem erweiterten Verständnis von Wissenschaftlichkeit gerecht werden, sondern auch meine Gedanken verständlicher und nachvollziehbarer zu machen. Warum ich ein solches Vorgehen für nötig halte, ergibt sich aus den nun folgenden Überlegungen.
Theoretische Grundlagen
Die Grundlage meiner Arbeit bildet ein konstruktivistisches Verständnis von Wissenschaft, Lehren und Lernen, das ich im Folgenden kurz skizzieren möchte. Für einen tieferen Einblick und eine ausführliche Herleitung empfehle ich die jeweils genannte Literatur.
Kern eines konstruktivistisch geprägten Verständnisses von Wissenschaft ist die Annahme, dass wir die Welt niemals so wahrzunehmen imstande sind, wie diese ist, sondern nur so, wie sie uns erscheint. Unsere Sinne bilden die Welt nicht einfach ab. Als „endliche Geister“ befinden wir uns daher „nie in der Situation sagen zu können, was es gibt und was etwas ist“.7 Stattdessen erschaffen (konstruieren) wir uns in der Begegnung mit der Welt unsere eigene Wirklichkeit.8 Unsere Wahrnehmung ist daher vielmehr ein Prozess der Wahrgebung.9 Daher ist auch „Objektivität“, so Heinz von Foerster, „die Wahnvorstellung, Beobachtungen könnten ohne Beobachter gemacht werden“.10
Was wir wahrgeben, ist nun einerseits abhängig von den Widerständen, denen uns unsere Umwelt entgegenbringt, also davon, dass da etwas ist und andererseits von unseren inneren (physischen, psychischen, kognitiven) Strukturen.11 Das Verhältnis von uns und unserer Umwelt lässt sich dabei als strukturelle Kopplung beschreiben. Wir wirken beständig und wechselseitig aufeinander und unsere Umwelt ein, allerdings ohne dass dabei tatsächlich Informationen übertragen werden. Wir sind operational geschlossene Systeme und haben daher keinerlei unmittelbaren Zugang zur Welt, sondern lediglich einen mittelbaren. Ein Austausch findet nur im Rahmen sog. Perturbationen statt. Unsere Sinnesorgane werden also von außen angeregt (beispielsweise indem Licht auf das Auge trifft), Signale zu produzieren, die dann an das Gehirn geleitet werden, welches aus diesen dann das zusammensetzt, was wir zu sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen meinen. Wir sehen also nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn.12 Auf diese Weise entsteht ein von innen produziertes Bild von einem Außen, das zu diesem keinerlei direkten Kontakt hat.13 Das Ziel dieses Prozesses ist es nun eben nicht, die Welt zu erkennen, wie sie wirklich ist, sondern viable, also passende Verarbeitungs- und Umgangsweisen zu finden, die das Überleben ermöglichen.
Wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir mit ihr umgehen und sie bewältigen und dadurch zu unserer Lebenswelt machen, ist dabei nicht willkürlich, sondern von unserer biologischen Struktur abhängig. Eine weitere entscheidende Rolle spielen unsere sozialen und kulturellen Prägungen. Als soziale Wesen befinden wir uns notwendig immer im (kommunikativen) Austausch. Wir konstruieren unsere Wirklichkeit(en) nicht nur, sondern ko-konstruieren diese gemeinsam mit anderen und müssen dies auch, um uns verständigen und miteinander kooperieren zu können.14 Wir alle werden zudem in eine Welt hineingeboren, die immer schon bereits geordnet und gedeutet ist bzw. in eine Gesellschaft, die dies bereits getan hat.15 Unsere (Ko-)Konstruktionen entstehen somit immer in Auseinandersetzung mit bereits bestehenden Wirklichkeitsmodellen. Diesen begegnen wir in der Regel in Form sog. Kulturprogramme. Dabei handelt es sich um mehr oder weniger konkrete Vorgaben für die Wahrnehmung, Deutung und Bewältigung von bestimmten Phänomenen, Verhaltensweisen oder Situationen, samt der dazu nötigen Glaubenssätze, Wissensbestände, Handlungsabläufe und Wahrnehmungsmuster. Diese werden in den Geschichten und Diskursen einer Gesellschaft (re)produziert und vor allem medial vermittelt.
Wollen wir nun von einer Gesellschaft, einer sozialen Gruppe oder auch von einem einzelnen Individuum anerkannt, verstanden oder gar gemocht werden, so kommen wir nicht umhin, uns mindestens bis zu einem gewissen Grad auf deren Wirklichkeitskonstruktion hin auszurichten. Andernfalls ist mit Ablehnung, Unverständnis oder gar Sanktionen zu rechnen. In der Regel aber geschieht diese Ausrichtung unbewusst im Zuge des Auf- und Hineinwachsens in eine Gesellschaft bzw. Kultur sowie des beständigen und selbstverständlichen (sozialen) Umgangs innerhalb dieser. Dabei übernehmen wir das bestehende Wirklichkeitsmodell und dessen Kulturprogramme aber nicht einfach, sondern eignen uns diese durch Re-, De- und Neukonstruktion an.16 Im Zuge dessen kommt es zu einer individuellen Anpassung. Das ist so lange kein Problem, wie sich die damit einhergehenden Änderungen im Rahmen der geduldeten Spielräume bewegen und selbst dann unproblematisch, wenn sich die zunächst individuellen Varianten verbreiten und dadurch auch anderen als neue Angebote zur Aneignung zur Verfügung stehen. Ohnehin kommen wir im Laufe unseres Lebens mit unterschiedlichen Varianten des bestehenden Wirklichkeitsmodells aber unter Umständen auch mit gänzlich anderen Wirklichkeitskonstruktionen (und daran gekoppelt Formen des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und Handelns) in Kontakt. Dies eröffnet uns (begrenzte) Spielräume, mit verschiedenen Modellen und Gewissheiten zu spielen, sie miteinander zu kombinieren oder neu arrangieren, um auch auf diese Weise neue Varianten zu erschaffen oder bestehende zu verändern. Dies wiederum kann zu Konflikten führen, an deren Ende die jeweiligen Ergebnisse dieses Prozesses entweder ignoriert, als Innovationen anerkannt oder als unerwünscht verworfen werden.
Bei der Frage, welche Wirklichkeitsmodelle oder Elemente dieser wir uns aneignen, spielt deren Anschlussfähigkeit eine zentrale Rolle. Angeeignet, also gelernt, wird vor allem das, was uns (auch unbewusst) als sinnvoll,17 praktikabel und moralisch vertretbar erscheint, emotional positiv besetzt werden kann oder sich zumindest entsprechend adaptieren lässt. Bei allen diesen Kriterien spielt soziale Akzeptanz eine entscheidende Rolle.
Von besonderer Bedeutung für die (Ko)Konstruktion von Wirklichkeiten ist Sprache. Mittels dieser treffen wir Unterscheidungen, teilen die Welt ein, legen Bedeutungen fest und suchen die sich daraus ergebende Ordnung zu vermitteln. Sprache dient dabei dazu, die Vielfalt an Möglichkeiten zur Wahrnehmung und Interpretation der Welt zu reduzieren. Auf diese Weise wird die Verständigung wahrscheinlicher und so schließlich auch ein gemeinsames Handeln erleichtert. Der Grund dafür ist, dass sich durch die Nutzung einer gemeinsamen Sprache ein Common Sense an Begriffsbedeutungen und ein Kanon an für jeweils spezifische Situationen festgelegten Codes herausbilden können, auf die die Akteur:innen dann zurückgreifen, um sich verständlich zu machen.18 Dies gilt allerdings vornehmlich unter der Voraussetzung, dass beide Seiten eine ähnliche kulturelle Prägung durchlaufen haben. Allerdings bringt uns Sprache auch dann weder einer beobachterunabhängigen Realität näher, noch vermag sie es, Informationen zu übertragen. Alles, was gesagt (oder geschrieben) wird, bleibt von denjenigen abhängig, die sprechen (oder schreiben) und das, was verstanden wird, von denjenigen, die zuhören oder lesen. Es ist eben „eine Illusion zu meinen, dass wir uns verstehen können, nur weil wir dieselben Worte verwenden“.19 Wir können „unsere Erfahrung mit niemandem teilen, wir können den Mitmenschen nur davon erzählen. Wenn wir dies tun, gebrauchen wir Wörter, die wir mit unseren Erfahrungen assoziieren. Was unsere Partner verstehen, wenn wir sprechen oder schreiben, das kann sich nur in den Bedeutungen verwirklichen, die sie aufgrund ihrer Erfahrung mit den Klangbildern der Wörter verknüpfen, die wir gebrauchen – und ihre Erfahrung ist nie identisch mit der unsrigen“, so Ernst von Glasersfeld.20 Das, was wir Verstehen nennen, entspricht also eher einem graduell abnehmenden Missverstehen.21 Sich (sprachlich) verständlich zu machen, bedeutet damit letztlich vor allem die Herstellung von Anschlussfähigkeit in der weiteren Kommunikation bzw. Interaktion, ohne dass es dabei zum Bruch (vor allem mit den jeweiligen Erwartungen) kommt.22 So kann das Wort „Liebe“ sehr unterschiedliche Bedeutung haben. Bewusst wird uns das erst, wenn es zu einem Konflikt kommt, weil jemand etwas tut, das mit unserer Vorstellung von der Bedeutung dieses Konzepts nicht vereinbar ist. Solange unser Handeln aber konsistent erscheint, die möglichen Unterschiede also zu keiner Irritation führen, bleibt uns diese Ungenauigkeit unerkannt. Genau darauf zielt Verständigung letztlich ab. Siegfried J. Schmidt spricht daher auch vom Verstehen als Mittel zur sozialen Kontrolle. Nicht um das, was im Kopf des anderen vorgeht, geht es, sondern darum, diesen mittels der Zuschreibung von Verstehen oder Nicht-Verstehen in seinem Verhalten zu regulieren.23 Erfolgreich sind Verständigung und die damit einhergehende Übernahme eines Wirklichkeitsmodells also dann, wenn die gegenseitigen Erwartungen und Erwartungs-Erwartungen in den als relevant angesehenen Bereichen ausreichend erfüllt werden und es somit zu keinen Konflikten oder Störungen kommt.
Wahrheit, so lässt sich mit Verweis auf Paul Watzlawick und Hans Vaihinger schließen, ist also nur ein jeweils zweckmäßiger Irrtum.24 Das gilt auch für die Wissenschaften. Wissenschaftliche Erkenntnisse setzen sich nicht deswegen durch, weil sie die Welt wahrer abbilden, sondern weil mit diesen bestimmte Phänomene scheinbar besser beschrieben, Beobachtungen erklärt und Vorhersagen gemacht werden können und auch dann nur insofern sie anschlussfähig sind.
Eine solche Sichtweise auf das Zustandekommen von Wissen wirkt sich auch auf das Verständnis von Lehren und Lernen aus. Aus dem konstruktivistischen Wissenschaftsverständnis folgt eine entsprechend konstruktivistische Didaktik.25 Laut dieser lässt sich Wissen nicht eintrichtern, lassen sich Menschen nicht einfach belehren und lässt sich Lernen nicht erzwingen. Was und ob jemand lernt, hängt nämlich in erster Linie von diesem selbst ab. Ein entscheidender Faktor ist auch hier, ob das was es zu lernen gäbe, anschlussfähig ist und dem lernenden Individuum sinnvoll erscheint. Lernen ist zudem ein aktiver Prozess, kein passiver Vorgang, der einfach geschieht. Wissen wird also nicht einfach übernommen, sondern muss vom Individuum selbst neu konstruiert werden. Gelernt wird also nicht das, was gelehrt wird, sondern das, was die Lernenden daraus in Abhängigkeit ihrer inneren Strukturen und in Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt machen. Das bedeutet nun nicht, dass Lehrende obsolet sind. Zwar können sie nicht belehren, aber sie können Lernen unterstützen, indem ansprechende und vor allem passende Lernumgebungen geschaffen werden, in denen die Lernenden vor Herausforderungen gestellt werden, die es zu bewältigen gilt und die diese auch bewältigen möchten. Darüber hinaus liefern die Lehrenden durch ihr Lehrangebot auch die (Wissens-)Bausteine, aus denen die Lernenden dann für sich neue Wissensbestände konstruieren können. Was sich verändert ist also in erste Linie die Rolle der Lehrkraft. Aufgabe ist nicht mehr das Vermitteln von Wissen und Abprüfen vorher festgelegter Wissensbestände, sondern das Ermöglichen von Lernen durch die Gestaltung von Lernräumen und die Begleitung der individuellen Lernprozesse.
Persönliche Grundlagen
Wie wir beobachten, auch wie wir wissenschaftlich beobachten, hängt nicht nur von unseren wissenschaftstheoretischen Vorannahmen, der verwendeten Methodik und den gewählten Fragestellungen ab, sondern auch ganz entscheidend von uns als Person. Wissenschaftlichkeit unter den oben genannten Bedingungen herzustellen, erfordert daher auch, unsere persönlichen Konstruktionsbedingungen in den Blick zu nehmen und diese zumindest in den Grundzügen offenzulegen, um unsere Arbeit auf diese Weise nachvollziehbar zu machen. Ich möchte Sie daher bitten, mir ganz im Sinne Heinz von Foersters, in ein Land zu folgen, in dem es nicht verboten ist, sondern in dem man sogar dazu ermutigt wird, über sich selbst zu sprechen, denn was könnte man auch sonst tun?
Ich stamme aus einer kleinen Stadt im Süd-Osten Brandenburgs. Dort wurde ich geboren und habe meine Kindheit und Jugend verbracht. Mit Mitte Zwanzig bin ich dann des Studiums wegen nach Potsdam gezogen. Dass ich das geschafft habe, war für mich ein kleines Wunder, denn bis dato war meine Heimatstadt für mich ein Gefängnis, aus dem ich nicht entkommen konnte. Schuld daran waren meine Emotionen. Nun hatte ich keine unangenehme Kindheit. Auch die s.g. „Baseballschlägerjahre“ im Osten Deutschlands habe ich als politisch linker Jugendlicher halbwegs gut überstanden.
Zum Verhängnis wurde mir vielmehr ein an sich harmloser Ausflug, bei dem sich unsere kleine Reisegesellschaft verirrte. Hier hatte ich meine erste Panikattacke. Daraus entwickelte sich eine ausgewachsene Angsterkrankung, die dazu führte, dass ich meine Heimatstadt nicht mehr verlassen konnte. Es waren also meine eigenen Emotionen, die mir ein Gefängnis gebaut hatten. Als ich es dann doch nach Potsdam zum Studium schaffte, setzte sich das alte Spiel an diesem Ort fort. Im Laufe meines Geschichtsstudiums stieß ich dann, dank meines späteren Doktorvaters auf den s.g. Emotional Turn und begann, mich auch wissenschaftlich mit Emotionen auseinanderzusetzen. Dies setzte einen Prozess des wechselseitigen Verstehens von wissenschaftlichen Modellen und persönlichen Erfahrungen in Gang, der bis heute meine Arbeit prägt und den ich daher im Folgenden kurz erläutern möchte.
Laut Schütz begegnen wir unserem lebensweltlichen Alltag vor allem pragmatisch.26