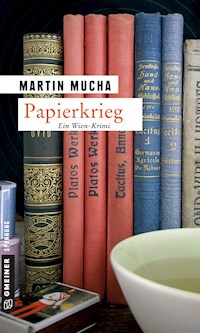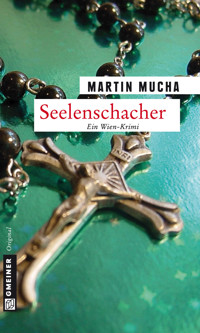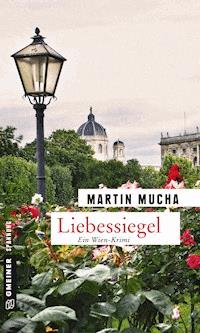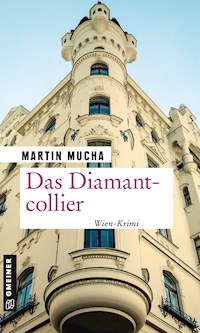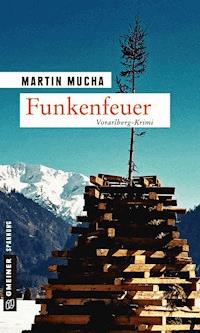
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wachtmeister Schmiedle
- Sprache: Deutsch
Der Stolz eines jeden Vorarlberger Dorfes ist der Funken - das Frühlingsfeuer, das den Winter vertreiben soll. Während Wachtmeister Schmiedle alle Hände voll damit zu tun hat, den Dorffunken vor den missgünstigen Menschen aus den Nachbardörfern zu schützen, verschwindet auch noch die neue Volksschullehrerin spurlos. Ein Motiv ist schnell gefunden: Die Lehrerin hatte den Bürgermeister wegen sexueller Belästigung verklagt. Doch wie gegen den Dorfkaiser ermitteln, der sich absoluter Beliebtheit erfreut, und dabei den Dorffunken nicht aus den Augen verlieren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Mucha
Funkenfeuer
Kriminalroman
Zum Buch
Funkenbrauch In einem beschaulichen Dorf in Vorarlberg verschwindet die Volksschullehrerin plötzlich spurlos. Wachtmeister Schmiedle beginnt zu ermitteln und stößt rasch auf ein Motiv. Die Lehrerin hatte den allseits beliebten Bürgermeister wegen sexueller Belästigung verklagt. Alle Machtstrukturen im Dorf beschützen den Dorfkaiser, der in vierter, ununterbrochener Generation regiert. Doch es gibt auch kritische Stimmen im Dorf, und Hubert Schmiedle findet manch unerwarteten Verbündeten – jedoch keine Spur von der verschwundenen Lehrerin. Überraschende Geheimnisse kommen ans Licht, die niemand hinter der sauberen Fassade alemannischer Ordnungsliebe vermutet hätte. Mehrfach ist des Rätsels Lösung für den Wachtmeister zum Greifen nah, ehe sich alles wieder in Rauch auflöst. Schlussendlich muss er sich die Frage stellen, was ihm wichtiger ist: die eigene Reputation oder die Dorfgemeinschaft …
Martin Michael Mucha, 1976 in Graz geboren, studierte in Wien Philosophie, Geschichte sowie Theologie und promovierte anschließend in Philosophie. Seit fast zehn Jahren arbeitet er im Bereich Drehbuch für Kino- und Fernsehfilme. Seiner ausgedehnten Reisetätigkeit, vor allem nach Asien und Afrika, entsprang bisher ein Bild-/Textband über Afghanistan und Tadschikistan. Der Autor lebt als verheirateter Familienvater in Wien. Seine Jugend verbrachte er allerdings in einem Dorf im Vorarlberger Walgau.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Die Lebensversicherung im Plastiksackerl (E-Book Only, 2015)
Liebessiegel (2015)
Zufälle und Mordfälle (E-Book Only, 2014)
Erbschleicher (2014)
Beziehungskiller (2012)
Seelenschacher (2011)
Papierkrieg (2010)
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt von der
Literaturagentur erzähl:perspektive, München
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Astrid Gast/fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5618-3
Widmung
Christian, Johnny und Stefan in tiefer Freundschaft zugeneigt
Vorwort
Diese Geschichte vom Wachtmeister Hubert Schmiedle spielt in Vorarlberg. Vorarlberg ist ein geografischer Begriff, der sich aber viel besser und schöner semantisch fassen lässt.
Überall dort, wo das Wort »g’hörig« verstanden wird und es kein Dialektwort für Arbeitslosigkeit gibt, dort ist Vorarlberg.
Müßig ist es auch, das Dorf zu suchen, in dem die Geschichte sich zuträgt, denn dieses Dorf ist eines und viele gleichzeitig.
Das Buch versteht sich nicht als reale Schilderung von Polizeiarbeit und Dienstgraden. Wer zu schmunzeln vermag, der tue dies, wer stur nach Realismus sucht, der sei gewarnt.
Und jetzt zur Sache.
Freitag
I
Wachtmeister Hubert Schmiedle saß an seinem Schreibtisch. Hinter ihm an der Wand hingen der Heiland und der Landeshauptmann. Vor ihm auf dem Tisch lagen eine Wurst, ein Kanten Brot und ein schönes Stück Schnüfner Bergkäs’.
Schmiedle leckte sich erwartungsfroh die Lippen und den Schnäuzer. Die vormittägliche Jause, das z’Nüne, war seit jeher seine Lieblingsmahlzeit. Ein kleines Bier dazu wäre gut gewesen, aber der Wachtmeister trank im Dienst ausschließlich, wenn es der Ermittlungserfolg gebot.
In der Wachstube war es still. Der Schreibtisch war aufgeräumt. Der Halfter mit der Dienstwaffe hing an seinem Ort, und der Computer war ausgeschaltet.
Niemand hätte vermutet, dass der Wachtmeister hart arbeitete. Doch er tat es. Freitagvormittag vor dem Funkensonntag. Der gefährlichste Tag und das gefährlichste Wochenende im Jahr. Denn der Funken war schon aufgebaut und konnte gestohlen werden. Der Freitag war der beliebteste Tag für solch ein Verbrechen. Bis zum Sonntag konnte nicht einmal alemannischer Fleiß einen neuen Funken aufbauen. Die Schande dauerte länger, als wenn der Diebstahl am Samstag geschähe oder in der Nacht auf Sonntag.
Seitdem im 84er Jahr der Funken gestohlen worden war, hatte kein Dorfgendarm mehr am Funken-Wochenende auch nur ein Auge geschlossen. Das Schicksal von Reinhardt Amann stand allen klar vor Augen. Der Mann hatte sich selbst, seine Familie, sein Dorf und die Truppe entehrt. Seither lebte er in Thailand. Dort gibt es keinen Bergkäse. Hubert Schmiedle erzitterte bei dem Gedanken. Keine Berge, keinen Käse, dafür Reis und Dschungel.
Längst gab es nur mehr einen Gendarm im Dorf, und auch der war kein Gendarm mehr, sondern Polizist. Sagten die in Wien zumindest. Aber Wien ist weit von Vorarlberg. Die Hauptstadt liegt hinter dem Arlberg, hinter dem Tirol, in Innerösterreich. Für einen echten Vorarlberger liegt Wien gleich bei Kinshasa und unterscheidet sich von Nairobi nur dadurch, dass man Nairobi auf der Landkarte schneller findet. Deswegen war Hubert Schmiedle nach wie vor Wachtmeister und Gendarm.
Die Wurst war aufgeschnitten, der Käse ebenfalls, es konnte gegessen werden. Dass seit zwei Tagen Fastenzeit war, störte den Wachtmeister nicht. Denn Wurst war kein Fleisch, das stand fest. Aber er hatte die Wurst trotzdem im Nachbardorf gekauft, denn Anna, die Frau vom Wachtmeister, sah das ganz anders. Im Nachbardorf Wurst kaufen. Das war immer ein Risiko. Wer weiß schon, was die in die Wurst tun. Hubert Schmiedle wusste es nicht und wollte es auch gar nicht wissen. Den Schlinsern war alles zuzutrauen. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Denn wenn Anna erführe, dass er im Nachbardorf Wurst gekauft hätte, dann wäre das schlimm. Sehr schlimm. Nicht auszudenken. Anna war kein Freund der Schlinser. Oder der Satteinser. Oder von sonst wem, der nicht im Dorf wohnte.
Der Wachtmeister drängte die Sorgen beiseite, nahm ein Stück vom Käse und wollte hineinbeißen. Der Schnäuzer sträubte sich erwartungsfroh, der runde Bierbauch, der ihm Würde und Stabilität verlieh, gurgelte fröhlich, und die kleinen braunen Augen schlossen sich verzückt.
Da klingelte das Telefon. Hubert Schmiedle legte den Käse beiseite und nahm den Hörer ab.
»Hm«, meldete er sich offiziell. Sein Gesichtsausdruck wurde ernst. Er nickte mehrmals. Dann sagte er bestimmt: »Hm«, und legte auf. Er zog sein Stofftaschentuch aus der rechten Hosentasche und deckte seine Jause zu. Langsam stand er auf, ging auf den Hutständer zu, nahm die Dienstwaffe an sich und schnallte sich den Gürtel um. Schließlich verließ er das Büro, sperrte hinter sich ab und stieg in den Dienstwagen.
Fünf Minuten später parkierte er vor einem kleinen einstöckigen Haus. Der Garten des Häuschens befand sich noch im Winterschlaf, erschien aber ordentlich und für das Frühjahr gerüstet. Hubert Schmiedle ging um sein Auto herum, zur Gartentür und nickte drei Menschen zu, die dort standen.
Zwei Frauen und ein Mann standen beim Postfach und unterhielten sich. Sie sahen zum Wachtmeister hin.
Schmiedle blickte die Leute fragend an. Selbstredend kannte er alle drei, seitdem sie den Windeln entwachsen waren. So wie sie auch ihn kannten.
»Mir waren da, weil d’ Susanne gestern nicht am Oppression Workshop war. Der Klaus hat sie ang’rufen, aber sie hat nicht abg’nommen«, sagte die ältere der beiden Frauen.
»Da haben wir uns Sorgen gmacht«, ergänzte die zweite. Beide Ende 30 mit kurzen Haaren. In Naturstoffen gekleidet und adrett.
»Und jetzt ist große Pause, da kommt sie normalerweise schnell heim, nach der Katze schauen.«
Der Mann stand schweigend daneben. Er trug das Haar lang, einen dichten blonden Bart.
Hubert Schmiedle nickte nur, griff über das Gartentürchen und öffnete. Die drei anderen blieben stehen. Er ging den Weg zur Haustür und läutete. Einmal, zweimal, dreimal, wartete, nichts geschah.
»D’ Susanne hat all an Schlüssel über der Tür«, rief der langhaarige Mann zu Hubert. Schmiedle ignorierte die Meldung. Er besah sich die Tür. Schöne, gute Arbeit. Dann zog er einen Bund aus der Tasche und knackte das Schloss. Rechtlich gesehen, war das Einbruch. Aber Hubert war Dorfgendarm und, da Gefahr in Verzug, zu allem ermächtigt.
Schließlich hatte die Direktorin der Volksschule angerufen und das Fehlen ihrer Lehrerin und deren telefonische Unerreichbarkeit konstatiert. Nun standen auch noch drei andere da und machten sich Sorgen. In der Kriminalgeschichte des Dorfes kam das dem Kennedy-Attentat nahe.
Hubert hatte mittlerweile die Tür geöffnet und besah sich die Räume des Häuschens. Alles ordentlich, gut aufgeräumt, keine Kampfspuren, nichts, was einen Hinweis hinterlassen hätte. Er sah einen schönen, verbauten Ofen, mit gutem, trockenem Holz daneben, fein säuberlich gestapelt und in Hart- und Weichholzscheite getrennt. Außerdem gab es noch eine schöne graue Perserkatze, die sich unter der Bank versteckte, und deren Futternapf traurig leer war. Fünf Minuten später stand er wieder bei den Leuten am Gartentor.
»Hm?«, fragte er den jungen Mann.
»Kennsch mi eh. I bin Reuttes Klaus«, sagte er. Hubert nickte und notierte. Der Amtsweg war nun mal einzuhalten. Als der Reutte noch ein Teenager war, hatte Hubert einmal ein Päckchen Hanfkraut konfisziert und keine Meldung gemacht. Jetzt war der ehemalige Rockmusiker ein Vorzeigebiobauer. Kreislaufbewirtschafteter Hof, Hochbeete, es kamen Leute aus der Landeshauptstadt, um sich das anzuschauen. Hubert mochte vor allem die Erdäpfel. Grumpiera, wie sie der Dialekt liebevoll nannte. Am besten mit Zwiebeln, Wurst und geriebenem Bergkäse. Hubert wäre am liebsten gleich hinaufgefahren und hätte sich ein Kilo gekauft. Der ehemalige Rockmusiker hatte den Hang unter seinem Bauernhof mit Natursteinen belegt, was nicht nur sehr schön aussah, sondern auch einen beständigen Strom an warmer Luft generierte. Das Ergebnis waren Zuckermelonen, die auf 770 Meter über dem Meer reiften. Hubert war nicht so für Früchte zu begeistern, aber ab und zu brachte er seiner Anna eine von den süßen Köstlichkeiten.
Er blickte die beiden Frauen an.
»Nicole Dünser«, und »Irene Maier«, waren die Antworten. Die Erste war die Frau vom Reutte, aber ob sie verheiratet waren, wusste Hubert nicht. Heutzutage war das nicht so einfach, manche hatten denselben Namen, manche hatten zwei, aber der Mann nur einen. Hubert hatte schon lange aufgegeben diese babylonische Verwirrung durchschauen zu wollen. Da musste er seine eigene Frau fragen, auf jeden Fall hatten sie Kinder, zwei oder drei. Buben. Der ältere war mit dem Rad ohne Bremsen die Straße von Amerlügen ins Dorf runter gefahren. Handwurzelbruch und zwei Milchzähne ausgeschlagen. Reife Leistung. Hubert hatte den Vorfall protokolliert. Offiziell hatte er geschimpft, stillschweigend den Eltern gratuliert. Aus dem Buben würde mal was werden.
Irene Maier: Hubert musste nachdenken, bis ihm einfiel, woher er sie kannte. Sie war die Tochter vom einzigen Olympiasieger, den das Dorf hervorgebracht hatte. Zwar nicht Alpin und schon gar nicht Abfahrt, sondern bloß Nordische Kombination, Mannschaft, aber immerhin. Nach der Scheidung hatte die Tochter den Namen der Mutter angenommen. So war das. Hubert notierte sich die Einzelheiten.
»Oppression Workshop?«, fragte er. Das klang nach was.
»Oppression ist die anhaltende, ungerechte Behandlung von marginalisierten Gruppen durch die dominante Mehrheitsgesellschaft aufgrund von Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder ethnischer Herkunft.«
Hubert hatte Bahnhof verstanden. Ließ sich das aber nicht anmerken. Er notierte sich ein paar Striche ins Notizbuch mit dem dunkelgrünen Umschlag. Hubert besaß dieses Notizbuch schon viele Jahre, seine Frau hatte es ihm einmal zu Weihnachten geschenkt, der Preis stand noch in Schillingen notiert auf der letzten Umschlagseite. Das Papier war rau und grob, mehr grau als weiß, jedoch widerstandsfähig. Kaffee, Schlamm, aber auch ein wenig Blut fand sich daran, hatte ihm aber nicht geschadet. Den Umschlag bildete eine Art grünes Kunstleder, das an manchen Stellen schon schwer abgegriffen war und speckig glänzte, an anderen noch eine feine Textur aufwies. Hubert notierte sich alles mit einem kleinen, sehr weichen Bleistift. Beim Schreiben steckte er immer die Zungenspitze durch die Zähne und hörte auf zu atmen. Er liebte den schwarzen, satten Strich auf dem Papier. Den Bleistift spitzte er mit dem Sackmesser jeden Tag in der Früh in der Amtsstube in den Mistkübel. Das Messer schliff er einmal in der Woche zu Hause an der Werkbank. Das Messer war scharf, und der Bleistift spitz.
»Wer hat die Frau Susanne Drimic unterdrückt? Und warum?«, kam Hubert auf den Oppression Workshop zurück, stolz darauf, so gut Englisch zu können.
»Nein, nicht sie wurde unterdrückt, sie hat den Workshop geleitet, um uns für die Unterdrückung, die wir marginalisierten Minderheiten zukommen lassen, zu sensibilisieren.«
»Sensibilisieren«, murmelte Hubert, während er sich das Wort ins Notizbuch schrieb.
»Wem g’hört se?«, fragte Hubert, damit ausdrückend, von welcher Familie im Dorf Frau Susanne Drimic abstammte.
Die drei schwiegen zurückhaltend und schauten auf ihre Schuhspitzen. Reutte kratzte sich verlegen hinter dem Ohr.
»Aha, a Zuagreiste«, stellte Hubert fest. Auch das wurde notiert. Ortsfremde Person. »Woher?«
»Wien.«
Hubert steckte das Notizbuch weg. Er war einmal in Wien gewesen. Letztes Jahr. Mit seiner Frau. Die wollte unbedingt ins Theater und in irgendein Museum. Alles, an was Hubert sich erinnern konnte, waren Kopftücher, Menschenmassen und Sprachen, die er nicht kannte. Das mit der großen Welt war schön und gut, aber er fühlte sich in seinem Dorf wohl.
»Hm«, sagte Hubert abschließend und übergab den Schlüssel fürs Haus der Frau Dünser. Sie war die Verheiratete, oder zumindest so was Ähnliches. Auf jeden Fall hatte sie Kinder.
»Sicher werd ich mich um die Katze kümmern. Und wir rufen an, sobald wir was von der Susanne hören.«
»Hm«, sagte Hubert zum Abschluss und stieg in den Dienstwagen. Er fuhr einmal ums Eck und parkierte vor der Volksschule.
Der Hybrid Audi der Direktorin stand da, es gab noch ein paar Fahrräder, und im Hof hörte er laute Kinderstimmen. Hubert ging nicht ohne Unbehagen in das Gebäude hinein. Schule war nie so Seins gewesen. Werken und Turnen hatte er gemocht, den Rest vergessen. Hubert ging zum Büro der Direktorin, klopfte und trat ein.
Agnes Nesensohn saß hinter dem Schreibtisch. In ihrem Rücken hing ein Bild des Bundespräsidenten an der Wand. In den 80ern war sie politisch aktiv gewesen, Umweltschutz war ihr ein Anliegen, und deswegen freute sie fast nichts so sehr wie ein grüner Bundespräsident.
»Ah, Herr Wachtmeister«, sprach sie Schmiedle unkorrekt an. Denn, wie gesagt, Gendarmen gab es schon lange keine mehr. Aber im Dorf war das nicht wichtig. Schmiedle setzte sich. Er hatte Notizbuch und Bleistift gezückt, bereit zu kritzeln. Innerlich brach bei ihm der Schweiß aus. So wie damals. Er spürte, wie er förmlich klein wurde, sein Bierbauch schrumpfte, der dichte Schnäuzer verschwand und sein Haupthaar wieder voll und lockig wurde. Die Direktorin schwieg für einen Moment, und Schmiedle nahm das gar nicht gut auf. Ihm wurde immer unwohler, die Nervosität stieg, wenn man ihn in diesem Moment gefragt hätte, wie er heiße, oder wie viel eins plus eins ist, er hätte nicht zu antworten vermocht. Wie damals in der Schule. Aber nach der Schule hatte es zu Hause Riebl mit Speck gegeben. Das war gut gewesen. Mit einem Schlag war der Albdruck von Schmiedle gewichen, und er fühlte sich wieder wohl.
Als er aus seinem Riebl-Traum kindlicher Geborgenheit erwachte, sprach Frau Nesensohn gerade von der Volksschullehrerin. Gestern noch kerngesund in der Schule, heute nicht gekommen, kein Telefon abgenommen, nicht erreichbar. Deswegen der Anruf in der Wachstube. Schmiedle kritzelte in das Notizbuch. Am liebsten zeichnete er bei solchen Gelegenheiten zwei Kreise und ein Dreieck. Das half ihm immer, sich zu konzentrieren. Als er fertig war, hob er fragend den Kopf und blickte die Frau Direktorin an. Agnes Nesensohn, die ihren Fernsehkrimi in- und auswendig kannte, wusste, was das zu bedeuten hatte. Sie begann, Susanne Drimic zu charakterisieren.
»Frau Drimic ist seit Beginn des letzten Schuljahres bei uns. Wir sind sehr zufrieden mit ihrem Engagement, sie ist hervorragend qualifiziert, enorm engagiert und eine echte Bereicherung für unseren Lehrkörper. Sie hat mich immer an mich selbst erinnert, damals, als ich von der Pädak gekommen bin, so voller Energie und Idealismus.«
Agnes Nesensohn blickte verträumt aus dem Fenster, hinaus auf das ruhige, grüne, adrette Postkartenbild eines Dorfes im Walgau.
»Sie war noch nie eine Minute zu spät, noch nie krank, obwohl sie Wienerin war. Deswegen habe ich gleich angerufen. Sie hätte mich sofort verständigt, wenn ihr etwas dazwischen gekommen wäre. Sie ist sehr verantwortungsbewusst und hat viel Pflichtgefühl.«
Hubert kritzelte weiter in seinem Notizbuch. Die beiden Kreise und das Dreieck nahmen nun langsam Gestalt an. Hubert überlegte kurz und setzte dann kühn zwei kleine Punkte in die Kreise. Er betrachtete sein Meisterwerk. Dann sah er wieder zu Frau Nesensohn.
Die Direktorin fuhr fort, so wie sie es aus den Fernsehkrimis kannte.
»Also Feinde hatte sie keine, soweit ich weiß. Sie war erst ungefähr eineinhalb Jahre bei uns, deswegen war da sicher auch noch nicht so viel Anschluss an die Dorfgemeinschaft. Sie war sicher bei keinen Vereinen dabei.« Sie unterbrach sich kurz und dachte nach. »Aber es hat da etwas gegeben, was sie in den letzten Monaten gemacht hat. Lassen Sie mich kurz nachdenken, Herr Wachtmeister.«
Hubert sah das Wort Oppressionworkshop in seinem Notizbuch stehen. Zwischen vielen Dreiecken und noch mehr Kreisen. Er las es vor.
»Opressionworkshop. Genau, das hatte sie, da machten ein paar Leute mit. Es ging dabei irgendwie um die neuesten Theorien. Sensibilisierung den eigenen Privilegien gegenüber, glaube ich. Für solche Sachen bin ich schon ein bisschen zu alt.« Sie wartete darauf, dass Hubert als wohlerzogener Mann den Hinweis auf ihr Alter zum Anlass nehmen würde, ihr ein Kompliment zu machen. Aber dem war nicht so. Hubert hatte noch nie einer Frau ein Kompliment gemacht. Streng genommen wusste er gar nicht, was das war. Wenn ihm das Essen zu Hause schmeckte, aß er auf. Wenn nicht, dann ließ er es übrig. Anna machte manchmal so komische Sachen. Vegetarisch, Curry, Quinoa. Das war nicht Huberts Welt. Er ging dann immer zum Salmonellen-Heinz auf einen Zack-Zack.
Einmal, vor 31 Jahren, hatte er mit 19 seiner Anna gesagt, dass er sie liebte. Das musste reichen. Seine Einstellung war: Einmal hatte er es gesagt, wenn sich was ändern würde, dann würde er sich schon melden.
Das soziale Konstrukt eines Kompliments war ihm fremd. So saßen sich die Direktorin und der Wachtmeister kurz schweigend gegenüber. Hubert nahm das Unangenehme gar nicht wahr. Agnes Nesensohn sehr wohl. Innerlich hatte sie Hubert Schmiedle von der Liste der Männer im Dorf gestrichen. Aber was wollte man schon von einem Gendarmen erwarten, dachte sie sich.
»Wie gesagt, mit dem neumodischen Theoriegehalt bin ich nicht so vertraut.«
Hubert sah wieder von seinem Notizbuch auf.
»Ach ja, zuletzt gesehen habe ich sie gestern am Nachmittag um halb vier, da ist sie gegangen. Die letzte Unterhaltung hatten wir vorgestern. Es ging um den Wandertag im Mai.«
Hubert zog die Augenbrauen hoch.
»Danach wollte sie heim. Keine Ahnung, was sie hinterher gemacht hat. In das Privatleben meiner Lehrerinnen mische ich mich nicht ein.«
Hubert stand auf, hielt die Hand hin, murmelte »Danke« und ging dann hinaus. Draußen stieg er in sein Auto, atmete tief durch, überlegte kurz und setzte dann hinüber auf die andere Straßenseite, zur Tischlerei seines besten Freundes Edwin. Er parkierte und betrat die Werkstatt.
»Heile, Hubert.«
»Z’was«, sagte Hubert, die verstümmelte Form von Servus, die im Dorf gebräuchlich war verwendend, so als ob er 20 wäre und nicht 50.
»Schnäpsle?«, fragte Edwin, die Flasche mit der klaren Flüssigkeit und zwei Gläsern in der Hand.
Hubert streckte wortlos die Hand aus.
»Die Nesensohn, gell?«
Hubert nickte.
»Bei der krieg’ ich immer Schweißausbrüche und fühl’ mich wie selbst noch in der Schule.«
Hubert nickte. Die beiden Gläschen waren voll, es wurde angestoßen und ausgetrunken.
»Vogelbeer«, sagte Edwin. Hubert nickte. Edwin stellte die Schnapsflasche wieder weg. Er verbarg sie hinter ein paar Werkzeugkisten, vor die er noch zwei schöne helle Buchenholzbretter stellte.
»Han die gsaha in d’ Volkschul ihe goh. Hamma denkt, a Schnäpsle brucht er jetzt.«
Hubert nickte. Langsam fühlte er sich wieder wie ein Mensch. Er fühlte sich förmlich zwei Zentimeter größer. Edwin grinste und strich mit der Hand über das Holz, von dem er gerade mit dem Hobel hauchdünne Späne abzog. Hubert blickte ihn fragend an. So einen Hobel hatte er noch nie gesehen.
»Is japanisch«, sagte Edwin. »Die Späne kann man praktisch endlos lang machen und hauchdünn, beinahe zum Duriluaga.« So dünn, dass man praktisch hindurchsehen kann, meinte er.
»Des brauchts, weil ich billiges Holz innen verwende und teureres Hartholz außen. Die Japaner machen das schon ewig. Ich hab das im Fernsehen gesehen und über Amazon bestellt. Voll cool.«
Hubert besah sich den Hobel. Ein Stück Holz mit einer einsetzbaren Klinge, die im Winkel verstellbar war. Er nickte. Holzarbeit hatte ihm immer Spaß gemacht. Er liebte das Gefühl, die Textur, den Geruch des Werkstoffes.
»Holz«, sagte er bestimmt, und Edwin nickte verständnisvoll. Die beiden Männer schwiegen. Da ging die Tür auf. Herein kam Edwins Frau. Doppelt so schwer und zwei Köpfe größer als ihr Mann. Der enorme Busen wogte unter der geblümten Bluse. Margit kam dem Bild einer germanischen Rachegöttin gleich. Die alten Römer hatten sich immer vor den germanischen Frauen gefürchtet, nicht nur sie. Edwin und Hubert wurden wieder einen Kopf kleiner.
»Margit-Schätzle …«, doch Edwin kam nicht weiter.
»Nüt Schätzle. Saufen tuts, und die Arbeit bleibt liegen. Schau zu, dass du weiterkommst, Wachtmeister.«
Edwin blickte Hubert bittend an. Hubert nahm allen Mut zusammen. Er zog den Bauch ein, nicht dass irgendwer außer ihm selbst einen Unterschied festgestellt haben würde.
»Frau Stallehr, ich führe hier eine amtliche Ermittlung durch.«
»Dass ich net lach«, antwortete sie, die Hände in die Hüften gestemmt.
»Lachen bei Durchführung einer Amtshandlung bedeutet Verächtlichmachung der staatlichen Autorität und ihrer Symbole. Das ist gleichbedeutend mit Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das ist keine Kleinigkeit.« Hubert konnte, wenn ihn die Umstände dazu drängten, durchaus seinen Posten ausfüllen. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand.
Margit akzeptierte Huberts Ansprache. Respekt jedoch, von Angst ganz zu schweigen, hatte sie trotzdem keinen. Im Dorf war noch nie jemand wegen so was verhaftet worden. Wahrscheinlich war im Dorf überhaupt noch nie wer verhaftet worden.
»Amtshandlung lass ich gelten, aber den Vogelbeer, den riech ich bis in die Kuchi«, entgegnete sie etwas leiser, aber nicht weniger streng.
»Der Hubert war drüben bei der Agnes, deswegen der Vogelbeer«, meinte Edwin leise.
»Bei der Agnes? Dann kann ich’s verstehen«, meinte Margit.
Hubert spitzte die Ohren. Er blickte Margit fragend an. Nicht, dass es das gebraucht hätte. Margit war in Fahrt.
»Die Agnes, das ist so eine. Immer hinter dem Rücken schlecht über andere reden, das macht sie. Immer mit ihrem: ›Ich hab’ studiert, ich weiß das besser.‹ So als ob schon irgendwann irgendwer irgendwas Nützliches beim Studieren gelernt hätte.« Hubert nickte zustimmend. Sein eigener Sohn studierte in Wien. Vergleichende Literaturwissenschaften oder Wasweißichologie, oder so was. Hubert hatte in seinem ganzen Leben noch kein Buch gelesen, er konnte sich gar nicht vorstellen, warum Leute das taten. Die Welt war da draußen, nicht in einem Buch. Bücher lesen erschien Hubert so sinnlos, wie im Küchenkasten nach der Sonne zu suchen. Alles, was Hubert wusste, war, dass er seinen Sohn noch weniger verstand als die Türken im Dorf.
»Egal was mir beschließen, die Agnes und ihre Weiber sind immer dagegen. Beim Ortsvereinsturnier, beim Holzlos, beim Fasnatumzug. Immer sind die dagegen.«
Hubert nutzte die sich bietende Gelegenheit, um eine Frage zu stellen. Eine gut verkleidete allerdings.
»Aber über die Lehrerin, die Susanne Drimic, hat sie nur Gutes gesagt.«
»Ah so, um die geht’s? Was ist leicht?«
»Sie ist heute nicht zum Dienst erschienen, das Haus steht leer, aber das ist ein Amtsgeheimnis. Ich ermittle noch.«
»Na dann viel Glück. Wahrscheinlich hat sie ein Schätzle und hat verschlafen. Der ist alles zuzutrauen.«
»Aber Margit, da war doch gar nichts?«, warf Edwin ein.
»Da war nichts? Und warum hat sie dir dann so große Augen gemacht und: ›Ach Herr Stallehr, der Kuchikasten ist aber so schön geworden‹, gesagt? Hm?«
»Es hat sie halt gefreut.«
»Ach was, hinter den Männern ist sie her, hinter den verheirateten. So eine ist das. Das seh’ ich ihr an der Nasenspitze an. Kein Wunder, dass sie so einen Druck hat, wenn ich mir ihr Büchle anschau, dann hat sie nicht mehr viel Zeit, bevor sie aufgeht wie ein Germteig«, stellte Margit fest, auf das Bäuchlein der Lehrerin anspielend. »Aber meinen kriegt sie nicht.«
Es entstand eine kleine Stille. Ein Atemholen wie zwischen zwei Donnerschlägen.
»Unsere Kinder sind schon groß, aber wenn du mehr wissen willst, da musst du die Kerstin fragen.«
»Thalhammers?«, warf Edwin ein. Sogar für einen geborenen Alemannen, war es schwierig sämtliche Verwandtschaftsverhältnisse im Dorf zu kennen. Hubert wusste nur, dass Kerstin auf obskuren Nebenwegen mit Margit verwandt war.
»Genau.«
»Hm?«
»Die hat zwei Kinder in der Volksschule. Ein Mädchen und einen Buben. Die kann dir was erzählen.«
Hubert kritzelte in sein Notizbuch. Dann steckte er es weg. Er nickte Edwin zu und ging langsam Richtung Tür. Den Rücken getraute er sich nicht, der Frau zuzuwenden. Was seine Anna doch für ein Schatz war, dachte Hubert dankbar. Als er draußen war.
Er setzte sich hinters Steuer, warf den Motor an, ließ ihn ein wenig laufen und tat so, als ob er schreiben würde. Da klopfte es wie immer an das Beifahrerfenster. Es war Edwin. Hubert ließ das Fenster runter. Ein Schnapsglas erschien. Die beiden Männer nickten sich zu. Hubert reichte das leere Glas hinaus. Der Vogelbeer vom alten Thalhammer war schon ein Wahnsinn. Der alte Thalhammer war Brenner und hatte einen der größten Schnapskeller im Dorf. Hubert hielt das alte Gerücht, weswegen Edwin Margit wegen des Schnapskellers ihres Vaters geheiratet hatte, für nicht allzu übertrieben. Sehr klug von Edwin. Die Liebe kommt, die Romantik vergeht, aber Schnaps bleibt bestehen. Damit ließ Hubert den Dienstwagen anfahren, und gemächlich ging’s hinauf zum Dorfplatz, am Postamt vorbei, beim Friseur Moll vorbei und hinauf ins Oberdorf.
Neben der Kirche parkierte er, blickte über die Samina hinüber zum Gemeindeamt, zum Gasthof »Sonne« und freute sich des schönen Vorfrühlingstages. Dann klingelte er bei Thalhammers. Es ging schon auf halb elf zu, und aus dem Haus drang ein wunderbarer Duft nach Käse und Zwiebeln. Den Mayonnaise-Erdäpfelsalat konnte Hubert zwar nicht riechen, aber sein Bauch wusste, dass er auch da war. Freitag, Kässpätzle, Verdauerle. Hubert mochte die alten Traditionen. Vor allem wenn sie mit Käse, Schnaps und vollem Magen zu tun hatten. Die Tatsache, dass die Vorväter die Gebräuche in diese heilige Dreieinigkeit gekleidet hatten, war für Hubert Beweis genug dafür, dass man Überkommenes ernst nehmen sollte.
Da ging die Tür auf.
»Herr Wachtmeister Schmiedle?«, begrüßte ihn eine kleine wunderschöne Frau in Schürze und Hauskleid.
»Heile, Kerstin. Wie gots’m Göthe?«, erkundigte Hubert sich nach dem Taufpaten der jungen Frau, der einer seiner besten Schulfreunde gewesen war.
»Eh all guat, bloß der Ruckn, woasch eh.«
»Ah so an verlitt uf dera Welt«, gab Hubert sein Mitgefühl dem Bandscheibenvorfall des Fliesenlegermeisters Schindegger zum Ausdruck.
»Aber ich bin dienstlich da. Die Susanne Drimic wird vermisst, und ich wollt mich über sie erkundigen. Du hast zwei Kinder bei ihr?«
»Also nur die Anni ist bei ihr, der Max ist eine Klasse drunter. Kumm iha.«
Hubert trat ein. Er wurde in die Stube geführt. Penibel sauber. Aufgeräumt. Helles Holz. Alles tadellos.
»Bierle?«, fragte Kerstin.
Hubert wehrte dankend ab.
»Im Dienst nicht, ich verstehe«, sagte Kerstin. Hubert nickte.
Kerstin setzte sich zu ihm. Huberts Nase sog den Duft, der aus dem Backrohr aufstieg, ein und lächelte selig.
»Bisch eppa hungrig?«, fragte Kerstin. Huberts Magen knurrte zur Antwort.
»Heute bin ich früher mit dem Kochen fertig geworden als sonst. Der Gerhard und die Kinder kommen erst in einer Stunde zum Essen heim. Magst du einen Teller? Es ist genug da.«
Hubert versuchte abzulehnen, aber da stand er schon vor ihm. Ein einfacher Teller, gutes Porzellan. Darauf wunderschöne, leicht gelbliche Spätzle, fädenziehender, duftender Käse, darauf dunkelbraune, ganz frische, süß-knusprige Zwiebelringe. Der Löffel war groß und der Teller auch. Hubert war glücklich und begann zu essen. Beim zweiten Bissen stand eine kleine Schüssel Erdäpfelsalat vor ihm. Hubert nickte kauend. So musste die Welt eingerichtet sein. Während er aß, redete Kerstin.
»Also die Susanne, das ist so eine. Da verlangt sie, dass die Väter mit zum Elternabend kommen, der Gerhard muss extra früher heim aus’m Dienst, dabei ist es im Moment eh so schwer und stressig, und dann redet sie kein Wort mit ihm, wenn er was sagt, ignoriert sie’s und redet eine halbe Stunde von Sachen … da versteh ich kein Wort.«
Hubert kaute fragend und schluckte auffordernd hinunter.
»Heteronormativität und Gender Expression, hat sie gesagt, ich hab’s mir gemerkt, weil ich wollt’s nachschlagen, aber im Wörterbuch vom Papa steht das gar nicht drin! Sie hat gemeint, dass die Anni nicht immer Prinzessin spielen soll, und das kommt daher, weil der Gerhard arbeitet und ich auf die Kinder schau, und das muss man aufbrechen, das sei Unterdrückung.« Sie hielt inne. Es war ihr sichtlich nicht wohl dabei, so in Rage geraten zu sein. Sie strich das Tischtuch glatt und nestelte ein wenig an ihrem Ehering. Dann fuhr sie fort.
Hubert, als wohlerzogener Gast, hatte schweigend weiter gegessen.
»Und wegen dem Max hat sie auch was gesagt. Der Max ist ein Kerle, so ein richtiger. Immer der eigene Kopf, sein erstes Wort war: selber machen. In der Pause haben sie Völkerball gespielt, und der Ritchie von den Zinks hat übertreten, und der Max hat’s gesehen, und dann haben sie gestritten und … und. … dann hat sie den Max heimgeschickt, weil er den Ritchie geschubst hat. Hubert, das sind doch Buben!«
Hubert nickte. Solange die Buben einander nicht vom Sessellift runter schubsen, läuft alles richtig, war seine Meinung dazu.
»So ist das halt mit der Susanne, weißt. Aber ich muss auch sagen, als Lehrerin ist sie toll. Die Kinder lernen so gern bei ihr, und sie gibt sich viel Mühe, aber der ganze gspunnene Irrsinn, der müassat net si.«
Hubert, als wohlerzogener Gast, hatte seinen Teller aufgegessen. Nur der Erdäpfelsalat war stehengeblieben. Hubert mochte in seinem Salat Wurst und Käse, von Gemüse hielt er nicht so viel.
»Moll du, hat’s gschmeckt?«
Hubert nickte. Typisch Frau, was sollte die Frage, er hatte aufgegessen. Das würde er nie verstehen. Wer sollte annehmen, dass es ihm nicht geschmeckt hatte, wenn doch der Teller leer war. Das kam Hubert so vor, als ob man alle fünf Minuten fragen würde, ob die Sonne noch am Himmel stünde. Er lief auch nicht den ganzen Tag durchs Dorf und fragte alle Leute, ob die Sonne scheinen würde. Die würden sich schön bedanken, so einen Gendarmen zu haben.
»Subira?«, fragte Kerstin, auf einen Verdauungsschnaps in Form eines Birnenschnapses anspielend.
Hubert stieß leicht auf, klopfte sich auf den Bierbauch und lehnte dankend ab.
»Im Dienst«, sagte Kerstin.
Hubert nickte. Was der Dienst alles an Opfern forderte, das würden die Zivilisten nie verstehen. Der Subira von Kerstin kam von ihrem Opa. Der lebte noch und war eine Legende unter den Schnapsbrennern. Der alte Moosbrugger saß auf einem Schnapskeller, von dem gemunkelt wurde, dass noch ein Fraxner Kirsch aus dem 13er-Jahr da war. 1913 wohlgemerkt. Den Schnaps hatte der Kaiser noch getrunken, meinte der alte Moosbrugger, wenn er ein Glas zu viel erwischt hatte.
Hubert wechselte mit einem gekonnten Räuspern das Thema. Er blickte Kerstin fragend an.
»Ja, also das hab ich auch gehört. Der Maria ihr Mann, dem hat sie auch schöne Augen gemacht, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Die Frauen im Dorf reden immer so viel. Sie ist halt nicht verheiratet, aber eben auch erst so kurz da. Ob sie einen Freund hat? Kann ich nicht sagen. Ich hätt nichts davon gehört. Nein, wirklich nicht.« Maria war die beste Freundin von Kerstin und momentan auf Skiurlaub im Südtirol.