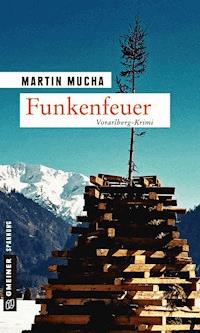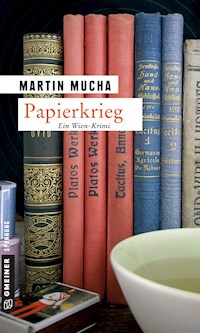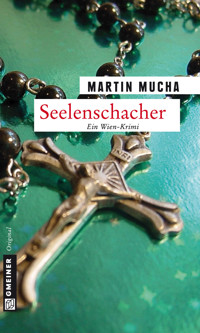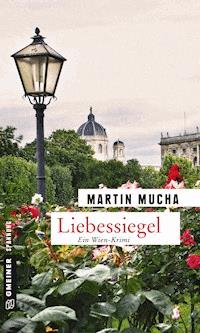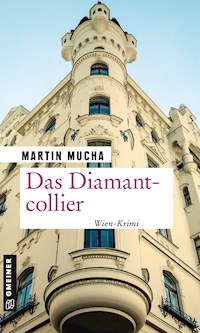Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Universitätslektor Linder
- Sprache: Deutsch
Arno Linder heuert als Privatsekretär bei Millionär Sternwald an. Um den todkranken alten Mann hat sich seine liebende Familie versammelt, denn wer zum Erben zu spät kommt, den bestraft das Leben. Als Arno in einer Bank überfallen wird, verschwindet Sternwalds Testament und kurz darauf verstirbt der Millionär. Erben und Polizei jagen hinter dem verschwundenen Dokument quer durch Wien. Nur Arno denkt sich: Warum nicht fälschen? Leider taucht das Original wieder auf - aber auch dem kann abgeholfen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Mucha
Erbschleicher
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Blende-8 – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4354-1
Vorbemerkung
»Weil das kein Tunnel ist, gibt’s auch kein Licht am Ende.«
Oliver Schopf am 26.9.2012 in »Der Standard« zur politisch-moralischen Situation in Österreich.
»This is a true story, only the names have been changed, to protect the guilty.«
Bon Scott
1. Kapitel
I
Der Winter in Wien hat was von der Redewendung ›wenn die Hölle zufriert‹. Kalte Nässe, die einem ins Mark dringt, kalte Windböen, die wie die Erinnyen kreischend sich durch Hemd und Mantel bohren, kalte Gesichter überall. Aber die Kälte ist nur der eine Teil des Verdrusses, den der Winter bringt. Der andere Teil ist die völlige Abwesenheit von Farben. Die Stadt ist so grau, dass sogar die Lichter der Verkehrsampeln farblos wirken. Kalt, freudlos, abweisend, so präsentiert sich die Stadt, wie die zugefrorene Hölle eben. Das Einzige, das in Wien noch beschissener ist als die Wiener, ist das Wetter.
Schlimm ist die Nässe, die durch die Sohlen der Schuhe dringt, die sich am Schal vorbei ins Unterhemd schleicht und die Finger in den Manteltaschen steif werden lässt. Schlimmer noch ist aber der Winterstaub, wenn es länger nicht geregnet hat. Dann ist die Stadt trocken wie die Takla Makan. Das Atmen wird mühsam, der Staub des von den Autoreifen zerriebenen Streuguts liegt auf allen Oberflächen, und der unbarmherzige Wind treibt die Partikel vor sich her. An den Duft von Blumen kann sich dann niemand mehr erinnern, alles schmeckt nur noch nach zermahlenem Granit.
Nach endlosen Monaten voller Hoffnungslosigkeit und rinnender Nasen wirft man dann einmal einen Blick in den Kalender und stellt fest, dass es erst Anfang Jänner ist. Gefühlte zwölf Monate vor Frühlingsbeginn. An manchen dieser Tage scheint es, als wäre der Frühling gestorben und käme nie wieder. Frühling und Sommer nehmen in diesen Zeiten für den gelernten Österreicher einen Klang an wie Verwaltungsreform oder WM Qualifikation. Es wird ständig davon geredet, aber jeder weiß, dass es nie eintreten wird. Der letzte Konvent zur Verwaltungsreform wurde aufgelöst, als nach zwei Jahren intensiver Tagungstätigkeit als einziges Ergebnis eine Erhöhung der Politikergehälter zu Buche stand. Und in der letzten Qualifikation hat uns sogar Kasachstan verprügelt. Wie es mit dem Frühling steht, wagt man dann nicht einmal mehr zu fragen.
In solchen Zeiten treten dafür aber andere Dinge ein. Man steigt in die einzige Lacke zwischen Landesgericht und Stephansdom, wenn man das Institut verlässt. Man verpasst die Ring-Bim auf dem Weg zur Staatsoper und kommt zu spät zu seinem Rendezvous. Man wird angezischt.
»Arno, kannst du nicht einmal pünktlich sein?« Man entschuldigt sich, hilft Laura aus dem Mantel und hält dem Kontrolleur die Karten hin. Man versucht, sich auf die Oper zu freuen, aber es gelingt nicht. Weil man 40 Minuten zuvor in der Institutskonferenz erfahren hat, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Man ist arbeitslos.
Dieses neutrale man, das mit nassen Füßen friert, bin ich, Arno Linder. 33 Jahre alt, promovierter Philologe und diplomierter Negerant sub auspiciis. Nachdem ich mich jahrelang von einem Vertrag zum nächsten gehangelt hatte, mit mehr Glück als Verstand, war jetzt die Katastrophe über mich hereingebrochen. Dem Institut für Klassische Philologie an der Uni Wien waren die Mittel gekürzt worden, zwei Forschungsstipendien waren nicht bewilligt worden, und so musste unnötiger Ballast abgeworfen werden. Manpower freisetzen, sagt man dazu. Tut verdammt weh. Wie sang Sixt Rodriguez so schön:
»Cause I lost my job two weeks before Christmas
And I talked to Jesus at the sewer
And the Pope said it was none of his God-damned business
While the rain drank champagne.«
Im Orchestergraben wurden derweil die Instrumente gestimmt. Ansonsten ein Moment höchsten Genusses, voller Vorfreude auf das Kommende, wenn die Erregung der Musiker und des Publikums spürbar wird, sodass es scheint, als würde sich der Vorhang von selbst bewegen. Heute nahm ich es nicht einmal wahr. Genauso wenig wie Lauras warmen Schenkel an meinem oder meinen nassen Fuß. Ich hörte nicht, wie die Streicher das a suchten, noch einen schnellen Lauf probierten und das ältere Ehepaar hinter mit tuschelte.
Ich hörte nur meine Chefin, Frau Glanicic-Werffel sagen: »Mit Anfang Februar sind Sie arbeitslos, Linder. Es tut mir wirklich leid, aber anders geht’s nicht.«
»Beide Forschungsanträge sind durchgefallen?«
»Beide.«
»Gibt’s gar keine Chance mehr?«
»Sicher doch. Sie müssen einfach Drittmittel in der Höhe von mindestens 50.000 Euro bringen. Wenn wir die Kommission von der wirtschaftlichen Relevanz unseres Instituts überzeugen können, bewilligen die sicher auch wieder Anträge.« An dieser Stelle hatte ich bitter gelacht. Welches Unternehmen sponsort Philologen, die sich mit einer seit gut 2000 Jahren untergegangenen Sprache beschäftigen. Den Eskimos Kühlschränke verkaufen ist dagegen ein Kinderspiel bei dem Klimawandel.
»Seien Sie nicht so negativ, Linder. Die Tibetologen haben’s auch geschafft.«
»Was haben die geschafft?«
»Drittmittel heranzukarren. Die schwimmen im Geld.«
»Wer sponsort die Forschungen der Tibetologie? Sanskrit ist noch länger ausgestorben als Griechisch.«
»Schon, aber die haben Geld. Leider halten sie sich ziemlich bedeckt und wollen ihre Quellen nicht verraten.«
»Wer kann’s ihnen verdenken.« Ich ließ den Kopf hängen, meine Chefin drehte den Dolch auch noch um:
»Nach der letzten Prüfung räumen Sie das Büro. Kopf hoch Linder, Sie werden schon was finden.«
Da war ich mir nicht so sicher. Vor sieben Jahren, als ich mit dem Studium fertig geworden war, hätte ich vielleicht noch irgendwo unterkriechen können. Aber Mitte 30, mit sieben Jahren Lücke im Lebenslauf, denn Lektor klingt zwar gut, überzeugt aber überhaupt keinen Personalchef, würde das sehr schwer werden. Ich sah mich schon wieder zu irgendwelchen Studentenjobs zurückkehren. Croupier war ich gewesen, in einem illegalen Casino. Doch die illegalen Casinos waren genauso auf der Strecke geblieben wie die klassische Bildung. Einen positiven Aspekt hatte die Situation jedoch. Ich wusste nun genau, wie sich die Dinosaurier gefühlt hatten, als sie merkten, dass sie unweigerlich aussterben würden.
»Arno! Hallo, irgendwer zu Hause?« Laura hatte sich zu mir herüber gebeugt und flüsterte mir ins Ohr.
»Es ist Pause. Ich will ein Glas Sekt und Unterhaltung.« Lauras mitternachtsblaue Augen funkelten, und in ihrer Stimme hörte ich ein kleines Mädchen über eine sommerliche Blumenwiese tollen.
»Gefällt’s dir?«
»Wunderbar.« Ich stand auf, bot Laura meinen Arm und wir gingen hinaus in den Gang. Dort wo ein Piccolo Sekt zum Preis einer Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Blick auf den Stephansdom verkauft wird. Von der Eigentumswohnung hat man zwar länger was, aber dafür moussiert der Sekt.
»Ich hätte mir nie gedacht, dass es mir so gut gefällt«, meinte Laura. Im Allgemeinen steht sie nicht so auf Musik, und klassische Orchester sind schon gar nicht ihr Ding.
»Oper ist eben mehr als nur Musik, das ist Kunst für den ganzen Menschen. Kostüme, Inszenierung, Drama, Emotionen. Das Einzige, was dem nahekommt, ist ein richtiges Fußballmatch. Der Oper fehlen nur die Schlachtgesänge der Fans, die Stimmung auf der Tribüne ist immer ein wenig reserviert.«
Laura lachte.
»Arno, ich trau’s dir sogar zu, dass du mich mal in ein Stadion schmuggelst. So ein richtiger VIP Bereich hätte mal was.«
»Blödsinn. Wenn wir ins Stadion gehen, dann nur in die Kurve.«
»Kurve?«
»Dort wo die echten Fans stehen, hinter dem Tor. Solange du das nicht erlebt hast, fehlt dir was!«
»Arno, die Leute schauen schon«, flüsterte Laura zwischen den Zähnen. Ich blickte mich um. Von überallher wurden wir beäugt, Fußball in der Staatsoper, das war zu viel für die Spießer.
Kurz darauf klingelte es zum zweiten Mal, und wir machten uns auf den Weg zurück zu unseren Plätzen.
Was an jenem Abend in der Staatsoper gegeben wurde, bleibt mir bis heute schleierhaft. Wenn sich die Leute über Meischberger, Hochegger und Mensdorff-Pouilly mokieren, die keine Wahrnehmung dazu haben, wie sie im Zuge verschiedenster Tätigkeiten zu Millionenbeträgen gekommen sind, so kann ich die armen Unschuldslämmer verstehen. Ich habe nicht die geringste Erinnerung daran, was an jenem Abend in der Oper auf dem Programm stand. Natürlich könnte ich im Spielplan nachlesen und mir in journalistischer Manier irgendwas aus den Fingern saugen, aber das wäre unehrlich. Nicht, dass ich Hemmungen hätte, zu lügen, ich flunkere gerne, aber nicht im Zusammenhang mit Musik oder Tee.
Ich saß also in meinem Sitz und grübelte darüber nach, wie die Tibetologen an Drittmittel gekommen sein mochten. Tibet war mir eigentlich immer sympathisch gewesen, aber damit war es jetzt vorbei. Wenn es mir nicht gelang, Geld aufzutreiben, würde ich nicht nur meinen Job an der Uni los sein, sondern vermutlich auch meine Freundin. Laura hat jede Menge Stärken, aber die Geduld, einen Privatgelehrten durchzufüttern, gehörte sicher nicht dazu. Eine Zukunft, in der ich die stillen Stunden in staubigen Lesesälen mit schweißtreibenden Hilfsarbeitertätigkeiten vertauschen musste, die Freude an homerischer Sprache gegen schwielige Hände und zermatschte Bandscheiben, das Drama der Antigone mit der Langeweile monotoner Arbeit an irgendeiner Maschine, eine solche Zukunft wollte ich nicht erleben.
In Gedanken ging ich alle Möglichkeiten durch, schnell reich zu werden, die mir je untergekommen waren. Da die Banken momentan selbst kein Geld haben, fiel diese Alternative aus. Um in der Münze Österreich ein paar Hundert Kilo Gold zu klauen, brauchte es Vorarbeit. So an die zehn bis 15 Jahre. Bis dahin wäre Laura sicher schon verheiratet und hätte Kinder. Um mir im Umfeld staatlicher Betriebe einen Platz an den Futtertrögen zu erstreiten, bin ich entschieden zu intelligent. Hut ab, aber nicht jedem ist es gegeben, ein Gorbach zu sein. Drogen und Frauenhandel schieden aus, da zum einen schon genügend Leute in diesen Sparten tätig sind, zum anderen aber auch ein moralisches Problem vorliegt. Laura mag so was nicht.
Ich saß also unempfindlich wie ein Stein in der Oper, während mich die Musik des Staatsopernorchesters umspülte. Kein Ton drang an mein Herz. Auch eine Art des Leidens, die Gefühllosigkeit.
Jedenfalls wurde ich irgendwann aus meinen trübsinnigen Träumereien gerissen, die sich um alleinstehende alte Damen, leichtgläubige Hausfrauen und gierige Kleinbürger drehten, als ich geküsst wurde. Ein Hauch von Zitrus, eine Idee Moschus und kalt-heiße Lippen zeigten mir recht eindrücklich, worauf ich mich zu konzentrieren hatte. Kaum hatte der Kuss begonnen, war er auch schon wieder vorbei. Laura stand auf und applaudierte. Wie so ziemlich alle anderen auch. Ich tat es ihnen gleich. Während der Encores meinte Laura: »Was für ein Abend, Arno, wir müssen das unbedingt wiederholen!« Sie war so begeistert, dass sie meine geistige Abwesenheit überhaupt nicht mitbekommen hatte.
»Wir können so oft kommen, wie du willst«, meinte ich. Wobei mir völlig klar war, dass ich mir das nicht leisten würde können. Wenn ich allein in die Oper gehe, dann sitze ich ganz hinten oben, wo man fast nichts mehr sieht. Das kostet dann zwischen zehn und 15 Euro. Für Laura hatte ich gute Karten gekauft, dagegen war das Piccolo Sekt eine Okkasion gewesen.
Ich bot Laura wieder meinen Arm, und wir zwängten uns durch die Menge. Aus dem Augenwinkel konnte ich bemerken, wie Laura die Toiletten der Damen taxierte, um für das nächste Mal genauer Bescheid zu wissen, was sie tragen sollte. Ich holte ihren Mantel, half ihr hinein, und wir traten hinaus in die kalte, klare Nacht.
»Taxi, Bim oder zu Fuß?«, fragte sie.
»Zu Fuß? Willst du erfrieren?«, entgegnete ich entsetzt. Von der Oper bis in die Kupkagasse am Hamerlingpark, wo Laura wohnt, ist es eine gute halbe Stunde zu Fuß.
»Erfrieren nicht, aber ein wenig bibbern wäre nicht schlecht.«
Da mir nichts einfiel, schaute ich einfach mal blöd drein.
»Arno, heute bist du nicht auf der Höhe.«
»Ja?«
»Irgendwas ist los mit dir. Zuerst ignorierst du mein Dekolleté, dann legst du mir nicht bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit die Hand auf den Hintern, was ich übrigens sehr vermisse, und jetzt stoße ich dich mit der Nase darauf, dass ich nichts dagegen hätte, ein wenig zu frieren, was nahelegt, dass ich gerne aufgewärmt werden würde, und du schaust drein wie der Faymann, als ihm klar geworden ist, dass man als Bundeskanzler auch mal eine Entscheidung treffen muss.«
Wahrhaftig, ich hatte noch gar nicht wahrgenommen, dass Laura in einem entzückenden schwarzen Kleid steckte, das ich jetzt nicht sehen konnte, weil der Mantel im Weg war. Aber ich erinnerte mich verschwommen an Bilder von weißer Haut, schwarzem Stoff und verführerischen Kurven. Irgendwoher schimmerten auch noch ein paar Perlen, aber ob in Form von Ohrringen oder einer Kette konnte ich beim besten Willen nicht sagen.
»Außerdem, auch wenn ich es kaum glauben kann, würde ich schwören, dass du von der Aufführung nichts mitbekommen hast. Ich glaube fast, wir könnten einen Tee trinken und du wüsstest nicht, ob es sich um Blätter oder Beutel handelte.«
»Wie kommst du darauf?«
»Du hast kein einziges Mal versucht, mir etwas zu erklären.« Unterdessen waren wir den Ring hinauf gegangen, näherten uns der Hofburg, und der alte Goethe saß bibbernd in der Dunkelheit auf seinem Denkmal. Etwa fünf Meter von uns.
Da kamen ein paar Typen mit einer Tibetfahne, Spendenboxen und lautem Gebrüll auf uns zu. »Freiheit für Tibet!«, war einer ihrer Slogans. Ich schaute sie bitterböse an. Sie missverstanden den Blick als Einladung. Einer hielt mir die Spendenbox unter die Nase. Das war zu viel.
Ich brüllte das arme Kerlchen aus voller Lunge an: »Reiß o, du Weh! Oder i brich da s’G’sicht!« Es musste relativ überzeugend geklungen haben, denn sogar Laura zuckte zusammen. Dem Kleinen fiel die Spendenbox aufs Trottoir, und die Gruppe gab Fersengeld.
Ich hob die Box auf und schüttelte sie.
»Darf ich die Lady auf einen heißen Drink einladen?«
»Arno, das ist Diebstahl!«
»Nein, ausgleichende Gerechtigkeit.«
»Wenn du die Box nicht zurückgibst, dann …«
»Dann?«
»Dann darfst du mich nicht aufwärmen.«
»Hm.« Ich hatte nur mit einem Ohr zugehört, denn die Erinnerung an Lauras Kleidung hatte meine Neugier angestachelt. Ich nahm sie in die Arme, sodass ihr dicker, grauer Wollpelz uns beide umschloss. Unter dem Mantel war es warm und kuschelig. Über uns raschelte der Wind in den toten Ästen der Bäume der Ringallee. Unter dem Kleid war es heiß. Ich ließ die Box fallen, Geld ist schließlich nur Geld, und es gibt Augenblicke im Leben, da braucht man zwei Hände.
»Arno, wir sind mitten auf der Straße!«, hauche Laura, nachdem sich unsere Lippen wieder voneinander getrennt hatten. Ich brauchte immer noch zwei Hände.
»Taxi?«
»Taxi!«
II
Zwei Wochen später, es war immer noch kalt und nass, ging ich eine Auffahrt in Grinzing hinauf. Die Wolken hingen tief über dem Wienerwald und versprachen eiskalten Regen in winzigen, nadelstichartigen Tropfen. Ich trug einen dunkelgrauen Anzug, eine blaue Krawatte, die guten Schuhe und blaue Socken. Ich war sauber, nüchtern, rasiert, und es war mir egal, wer das wusste. Ich hatte eine Verabredung mit 40 Millionen Euro.
Weißer Kies knirschte unter meinen Sohlen, als ich auf die Hintertür zu schritt und klingelte. Leute mit einem Bankkonto unter sechs Stellen im Plus hindert ein Fluch am Finden der Vordertür. Für den Fall aber, dass sie den Fluch brechen sollten, werden sie von den dort wachehaltenden Luxuskarossen gefressen. Davon kommt es auch, dass die Maybachs, Rolls und Bentleys immer so glänzen, auch wenn keine Sonne scheint. Das sind die menschlichen Proteine.
Die Tür wurde geöffnet, und ein missbilligendes Windhundgesicht erschien. Es war schwer auszumachen, was ihn mehr anwiderte, meine Wenigkeit oder das schlechte Wetter.
»Sie wünschen?«
»Linder, ich habe einen Termin.«
»Ahhh. Folgen Sie mir.«
Ich betrat das Haus.
»Aber berühren Sie nichts.« Ein Finger in weißem Zwirnhandschuh erschien über der breiten Schulter.
»Werd mich hüten.«
Der Mann wandte sich um und legte einen weißen Zeigefinger an den Mund. Ich nickte. Er ging weiter. Er trug ein blaues Hemd mit weißem Kragen, eine eng anliegende schwarze Hose und italienische Schuhe. Ich hatte zwar das Etikett nicht gesehen, aber wenn ein Mann geht wie ein Gott, dann kommen die Schuhe aus Italien.
Durch eine Küche, einen Gang entlang, dann in eine Art Halle und von dort eine Treppe hinauf. Noch mal um ein paar Ecken, und schließlich klopfte der Mann an eine dicke eichengetäfelte Tür. Er wartete auf ein Zeichen, das ich nicht wahrnahm, und trat ein. Ich wartete draußen. Der Gang war großzügig, aber dunkel. Wahrscheinlich gab es irgendwo Fenster, die jedoch verhängt waren. Ein paar Meter entfernt stand ein Globus im Dunkel an der Wand. Weiter konnte ich nicht sehen. Es roch nach Holzpolitur und abgestandener Luft.
Mehr gab es nicht herauszufinden und mir wurde langweilig, als sich die Tür öffnete und mir Einlass gewährt wurde. Im Zimmer herrschte dieselbe dumpfe, stille Atmosphäre, und das Licht war genauso schwach wie auf dem Gang, denn auch hier gab es Fenster, die aber kein Licht einließen.
Das Zimmer war groß, man hätte auch von einem Gemach sprechen können. Bücherregale an der Wand, ein paar Bilder, Kleiderschränke und ein Bett. In dem jemand lag.
»Linder?«
»Ja.«
»Was trinken Sie?«
»Was ist denn angebracht?«
Ein leises hüstelndes Lachen erklang vom Bett her, durch hohe Kissen gedämpft.
»Von mir aus können Sie auch Laudanum mit Absinth auf eine Halbe gespritzt trinken, ich bin kein Gesundheitsapostel.« Wieder das hüstelnde Lachen.
»Einen Tee«, antwortete ich trocken.
»Assam, Darjeeling, Oloong, Grün oder Früchte?«, fragte der Mann mit den weißen Handschuhen. Das Wort ›Früchte‹ sprach er aus, als ob es Lepra hätte.
»Grün bitte, wenn Sie haben, was Japanisches.«
»Lung Ching oder Gyokuro?«, fragte er mich ungerührt.
»Das sind zwar beide Drachenbrunnentees, aber nur der Gyokuro kommt aus Japan.« Die stahlgrauen Augen blitzten kurz anerkennend auf. Dann hatte er sich wieder im Griff.
»Sehr gerne«, meinte er und schloss die Türe hinter sich.
»Nehmen Sie sich einen Stuhl und rücken Sie ihn ans Bett heran.« Ich tat, wie mir geheißen.
Nun konnte ich Herrn Sternwald ins Gesicht sehen. Zermergelt und ausgelutscht sah es aus. Die dunklen Augen brannten aber noch hellwach im grauen Fleisch, und seine Zunge fuhr alle Augenblicke über seine dünnen violetten Lippen, als wolle er meine Aura schmecken. Auf seinem Kopf saß eine dicke Mütze, und an der Wand hinter ihm hing ein Beutel, von dem eine Kanüle zu seinem rechten Arm führte. Er bemerkte meinen Blick.
»Traurige Art, zu essen, nicht wahr? Aber ohne Eingeweide, was will man machen.«
Ich nickte.
»Sie müssen keine Zurückhaltung zeigen. Ich weiß selbst, wie beschissen meine Existenz ist. Trotzdem bin ich nicht gewillt, abzutreten, bevor es nicht unbedingt sein muss. Das schrecklichste Leben ist besser als der beste Tod. Lassen Sie sich das gesagt sein.«
Sternwalds Ton war trocken, spröde, seine Artikulation undeutlich, was wahrscheinlich von Medikamenten herrührte, aber vielleicht auch der Schwäche geschuldet war. Jedenfalls war er einer der ganz wenigen Menschen, deren Sprache mir nicht sofort verriet, woher sie kamen, sowohl geografisch als auch sozial. Es war für mich ein wenig so, als ob ich mir ein Eck eines Zahns abgebrochen hätte und nun immer wieder mit der Zunge über die Stelle fahren müsste. Es ließ mich nicht los. Aber ich hatte keine Chance. Er blieb ein Rätsel für mich. Alles was ich wusste war, dass er zu den Typen gehörte, die von den Frauen geliebt, von den Männern beneidet, nie verurteilt werden und schlußendlich in einem Ehrengrab der Gruppe 12 am Zentralfriedhof ihre letzte Ruhe finden.
Es klopfte, und herein kam mein Tee. Ich schenkte mir ein, aber er war noch nicht soweit, also goss ich den Inhalt der Schale zurück und beschloss, noch zwei Minuten zu warten.
»Rauchen Sie?«
»Nein.«
»Schade. Das ist ein entschiedener Minuspunkt für Sie. Ich habe den Tabak mein Leben lang geliebt. Aber jetzt geht’s nicht mehr. Es schmeckt mir einfach nicht mehr.« Er schüttelte traurig seinen Kopf. »Ich hatte gehofft, dass Sie rauchen.«
»Wenn Sie wollen, kann ich ja anfangen.«
»Sie sind bereit, so weit zu gehen, nur für einen Job?«
»Ja.«
»Gut. Allerdings sollten Sie das Ihren Arbeitgeber niemals wissen lassen.«
»Normalerweise würde ich das auch nicht, aber hier liegen spezielle Gründe vor.«
»Ah so? Welche denn?«
»Dieses Arbeitsverhältnis scheint mir kein Ding für die Ewigkeit zu sein.«
Ganz kurz war ich mir nicht sicher, ob er das akzeptieren würde. Aber er lachte. Wenn in seinem Körper nur noch eine Unze Lebenssaft gewesen wäre, dann hätte er Tränen gelacht, so aber blieb er trocken.
»Sie gefallen mir«, meinte er schließlich. »Da drüben, in der Kommode finden Sie Tabak in einem Lederbeutel und dazu Papiere, Feuerzeug ist auch eins da. Sie können doch drehen?«
Ich nickte und machte mich auf, das Zeug zu holen.
»Die Filterzigaretten aus den Päckchen habe ich immer gehasst«, meinte er. »Da kann man gleich Stroh rauchen. Für morgen werde ich ein paar gute Zigarren besorgen!« Ich hatte das Zeug geholt, setzte mich wieder zu ihm, probierte den Tee und drehte eine Zigarette. Derweilen erzählte er mir sein Leben.
Normalerweise verrät mir die Sprache eines Menschen so viel über ihn, sodass ich zumeist schon dadurch genug Hinweise in der Hand habe, um abschätzen zu können wie viel Wahrheit in einer solchen Erzählung steckt. Hier war es anderes. Die Tatsache, dass Sternwald noch dazu komplett reglos in einem Bett lag, von einer dicken Daunendecke umhüllt und von enormen Polstern verdeckt war, kam erschwerend hinzu. Ohne Gestik und Mimik blieb mir nichts übrig, als alles für bare Münze zu nehmen.
So hörte ich die Lebensgeschichte eines hungrigen jungen Mannes, der ein kleines Dorf verließ, um Geld zu machen, Frauen zu erobern und über andere zu triumphieren. Von ein paar Geschäftspartnern wurde erzählt, an die er sich zuerst als Junior-Partner gehängt hatte, dann dominiert und schlussendlich abgeschossen hatte. Ein paar Details merkte ich mir, denn die vorkommenden Namen waren durchaus prominent. Ich hörte von zwei Ehen samt Sprösslingen und einer unehelichen Tochter. Seine beiden Ehefrauen hatte er überlebt, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er einmal durchaus nachgeholfen haben könnte. Aber das ist pure Spekulation.
Als sich der Tee in der hauchdünnen Porzellankanne verflüchtigt hatte und die dritte Zigarette geraucht war, verlor seine Stimme allmählich an Ton, und die Erzählung geriet ins Stocken. Ich dämpfte aus und wartete ein bisschen. Nur sein regelmäßiger Atem war zu hören. Ich räusperte mich.
»Ja ja, für heute ist fertig, morgen um dieselbe Zeit. Etwas noch. Hier sind zwei Umschläge, der eine ist für Sie, der andere enthält einen Brief für meinen älteren Sohn. Adresse steht drauf. Bringen Sie ihn verlässlich noch heute vorbei. Ich bin zufrieden mit Ihnen. Thubois bringt Sie raus.« Er drückte einen Knopf, den ich nicht sehen konnte, und winkte mich hinweg. Keine 20 Sekunden später öffnete sich die Tür und Thubois begleitete mich durch den Gang.
»Es will Sie noch jemand sprechen«, bemerkte er trocken und führte mich in ein Zimmer. Kaum war ich eingetreten, hatte er auch schon die Tür hinter mir geschlossen.
Ich befand mich in einem weiten Zimmer, das trotz der trüben, winterlichen Lichtverhältnisse erstaunlich hell wirkte. Parkett, Teppiche, ein Sekretär, Bilder, alles war hell und heiter, wenn auch schon ein wenig angejahrt. Auf einer Couch saß eine Dame, und vor einem der Bilder ging ein Mann im dunklen Anzug auf und ab. Als beide gewahr wurden, dass ich eingetreten war, ignorierte mich die Dame völlig, aber der Mann stürzte auf mich zu.
»Wer sind Sie und was wollen Sie von meinem Vater?«, brüllte er mir entgegen. Das musste Werner, sein jüngerer Sohn sein. Sternwald hatte erzählt, dass er früher bei der Bawag beschäftigt gewesen war, jetzt bewohnte er hauptsächlich eine Dachgeschosswohnung im ersten Bezirk, da er nicht-geschäftsführender Stadtrat war. Jeder Stadtrat hat eine Agenda, Wohnbau oder Kunstförderung oder dergleichen. Es gibt aber auch welche, die haben keine Agenda, also nichts zu tun. Muss man sich mal vorstellen, so was gibt’s in Wien. Jobs, die im Nichtstun bestehen. Tu felix Austria.
Außerdem war er verheiratet, seine Frau wurde manchmal in den Klatschspalten des Boulevards erwähnt. Allerdings nie mit vollem Namen, sondern nur mit Akronym: SP. Das P bedeutete irgendeinen französisch klingenden Familiennamen, den sie nach der Heirat behalten hatte. Perrin, oder so. Dunkle Augenbrauen, graues Haar und eine glatte Stimme machten ihn mir vollends unsympathisch.
»Linder ist mein Name, Arno Linder.«
»Was wollen Sie von meinem Vater, frage ich Sie!« Werners glatte, nasale Stimme war irgendwie unangenehm. Er trug eine rote Nelke im Knopfloch. Irgendwie wirkte die unecht.
»Wenn er Ihnen das nicht selbst erzählt, sehe ich keinen Grund, warum ich es tun sollte.«
Werner war ein feiner Mann und lief ob dieser Insolenz rot an.
»Was erlauben Sie sich!«
»Loyalität!«, bemerkte ich spitz.
»Zuerst schleichen Sie sich ein wie ein Dieb, missbrauchen die Schwäche eines alten Mannes, um daraus Kapital zu schlagen und dann, dann besitzen Sie auch noch die Frechheit, mich unter meinem eigenen Dach zu beleidigen!«
»Soweit ich weiß, ist es das Dach Ihres Vaters, solange er noch lebt«, legte ich nach.
Er kam auf mich zu und tippte mir mit dem Zeigefinger auf die Hemdbrust. Ich fand das putzig und ließ ihn gewähren.
»Ich werde zu verhindern wissen, dass Sie sich einschleichen um erb… zu … schlei… schleichzuer… um sich in das Erbe einzuschleichen!«
»Da haben Sie vollkommen recht.«
»Sicherlich habe ich das. Ich habe immer recht!«, posaunte er. Dann hielt er kurz inne und wurde misstrauisch.
»Wie meinen Sie das jetzt?«
»Dass ich mich schleichen werde, und zwar jetzt. Mir gefällt die Unterhaltung nicht.«
»Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihnen das nicht gefällt. Seit 20 Jahren bewache ich das Erbe meines Vaters, und jetzt auf der Zielgeraden, da lasse ich mir nicht von einem dahergelaufenen …« Mehr hörte ich nicht, denn ich hatte die Tür hinter mir geschlossen. Werner Sternwald wurde angenehm leiser, seine Frau hatte die ganze Zeit geschwiegen.
Thubois stand vor der Tür, hatte offensichtlich alles gehört und seine Augen lächelten, das Gesicht blieb maskenstarr.
»Sie wünschen zu gehen?«
»Genau. Morgen bin ich wieder da, zur selben Zeit.
»Gut.« Er schritt mir voraus. An der Hintertür angekommen öffnete er mir und ließ mich hinaus. Auf der Schwelle drehte ich mich um und sagte: »Das war ein Lung Ching, aber er war trotzdem sehr gut.«
»Freut mich, dass Sie es bemerkt haben.« Anerkennung lag in der Stimme. Mit einem Mal hielt er einen Schlüsselbund in der Hand.
»Vordertür, Hintertür, Gartentür, Waschküchentür.«
»Danke.«
»Nichts zu danken, Sie gehören jetzt zu uns.« Damit schloss sich die Tür hinter mir und ließ offen, ob der meine Anstellung bei Sternwald oder mein Verhalten Werner gegenüber meinte.
Ich ging den Kiesweg hinunter, durch das Gartentor und hinaus auf die Straße. Es nieselte, und die Wärme des Hauses, die sich noch in meiner Kleidung bemerkbar machte, begann langsam zu schwinden.
Ich fischte mein Handy raus und wählte eine Nummer.
»Unrath«, meldete sich eine Stimme.
»Linder.«
»Fein. Wie gefällt Ihnen Sternwald?«
»Gut.«
»Sie haben den Job?«
»Morgen geht’s los. Dann bin ich Privatsekretär. Mal schauen, was ich alles machen muss.«
»Wie ich den alten Sternwald so kenne, wird das genau Ihre Kragenweite sein, langweilig wird’s bei ihm nie.«
»Kann ich mir denken.«
»Hat er Ihnen die alte Geschichte vom AKH Skandal erzählt?«
»Als er seinen Kompagnon reingelegt hat, indem er es so gedeichselt hat, dass die Türen um fünf Zentimeter zu schmal waren, um die Krankenhaus-Betten durchzuschieben?«
»Genau. Der darauf folgende Skandal hat dem Kompagnon den Kragen gekostet, und Sternwald hat alles übernommen. Auf diese Art muss man mal einen Konkurrenten loswerden. Sternwald ist ein Genie.«
»Ich bin schon gespannt.«
»Fein. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Das nächste Mal lassen Sie es mich direkt wissen, sodass ich nicht auf Umwegen erfahren muss, dass Sie sich in einer brenzligen Lage befinden.«
»Sie haben schon sechs Stunden, nachdem ich von meiner Entlassung erfahren hatte, angerufen. Schneller wärs auch andersherum nicht gegangen.«
»Vielleicht höre ich aber nicht immer alles.«
»Wenn die Hölle zufriert, vielleicht.«
»Apropos. Morgen kommt das sibirische Tief. Temperatursturz.«
»Kanns kaum erwarten.«
Wir legten auf. Mein Mund brannte vom Tabak, in meiner Brusttasche knisterten die beiden Briefumschläge. Der eine enthielt ein Schriftstück, der andere einen Geldschein, dessen gelbe Farbe durch das hauchdünne Papier hindurchschimmerte.
III
Ich fuhr mit den Öffis in die Stadt hinein, dort, wo der Schottenring an den Donaukanal stößt, steht der Ringturm. Darin befindet sich unter anderem eine Versicherungsgesellschaft, die war mein Ziel. Ein großzügig angelegter Eingangsbereich, der glänzt und prunkt, hieß mich willkommen. Bezahlt von den armen Würstchen, die immer brav ihre Versicherungsprämien bezahlt hatten, aber keine Rechtschutzversicherung abgeschlossen hatten und somit nicht die finanzielle Ausdauer hatten, den Instanzenweg zu beschreiten.
Ich trat an einen Empfangstisch aus dunkelrotem Marmor heran. Dahinter saßen zwei wunderhübsche junge Frauen, tief dekolletiert und adrett gekleidet. Beide sahen so aus, als bräuchten sie für 2+2 einen Taschenrechner.
»Guten Tag, mein Name ist Linder, ich soll zu Herrn Joseph Sternwald kommen.«
»Sternwald?«, fragte die erste Dame gedehnt. Sie war blond. Ihre Kollegin saß neben ihr und starrte leer vor sich hin. »Sternwald?« wiederholte sie unsicher. »Du Sandra, gibt’s bei uns einen Sternwald?«
»Sternwald?«, fragte die Zweite gedehnt. »Weiß nicht.« Sie war brünett.
Jede der beiden hatte einen Flachbildschirm vor sich stehen, mit Tastatur, Maus und sicherlich auch einem Computer dran. Auf die Idee, nachzuschauen, kamen sie aber nicht.
Im Hintergrund des Empfangsbereiches gab es eine Tür. Aus der trat ein wamperter Wiener mit Glatze und Aquariengläsern auf der Nase.
Seine blauen Augen wanderten von der einen zur anderen, dann zu mir. Das wirkte wie zwei riesige blaue Fische, die hinter enorm dicken Glaswänden schwimmen.
»Wos iss’n, Pupperln«, fragte er lässig, derweil er sich die Hose hochzog, die an der Unterseite seiner Wampe runterzurutschen drohte.
»Der Herr will zu wem.«
»Ah so, und zu wem will der Herr?«, fragte er seine beiden Kolleginnen. Doch die schwiegen vor sich hin und zupften die Frisur zurecht. Offensichtlich hatten sie den Namen nicht behalten. Darum sprang ich ein.
»Ich habe einen Termin mit Herrn Sternwald.«
»Sternwoid. Ahhhh!« Pause. Er dachte nach, schob sich die Brille zurecht.
»Wer ma nachschaun miassn«, meinte er ohne Anstalten zu machen, in irgendeine Aktivität zu verfallen.
»Das wäre sehr nett von Ihnen.«
»Is eh mei Job«, meinte er mürrisch, kratzte sich am Haaransatz und verschwand hinten in der Tür, wo er vermutlich sein Büro hatte. Ich hörte ihn herumwursteln. Das Smartphone der Blonden piepste, sie nahm es von der Schreibunterlage auf, die vollkommen unbenutzt vor ihr lag, und hielt es sich vors Näschen. Sie las eine SMS, dessen war ich mir sicher, denn ihre Lippen bewegten sich.
»Da Samo will mi auf an Cocktail einladen, heit nach’m Hackln«, meinte sie zu ihrer Kollegin.
»Was sogt da Niva dazua?«, fragte die Brünette zurück.
Beide lachten, und die Blonde tippte eine Antwort in ihr Phone. Ich hätte meine Seele verkauft, um zu wissen, wie sie Cocktail buchstabierte. Aber das ging leider nicht mehr, meine Seele habe ich schon verkauft. Für 500 Euro, der beste Deal meines Lebens.
Inzwischen kam der Portier zurück. In seiner Hand hielt er ein fettiges Schulheft, mit Kartonumschlag und Eselsohren. Er blieb vor mir stehen, befeuchtete sich den Finger und fing an zu blättern. Als er zum zweiten Mal das ganze Heft durchgeschlagen hatte, hob er den Blick und meinte: »San Se ganz sicher, was den Namen betrifft? I kann eam net finden. Es gibt kan Joseph Sternwald.«
Ich fischte den Umschlag heraus und las den Empfängernamen vor: »Direktor Dr. Joseph Sternwald.« Dann hielt ich ihm den Umschlag unter die Nase.
»Ah, der Herr Direktor! Was sagn S’ des denn net gleich. Durchs Drehkreuz in den linken Lift und dann in den 19. Stock hinauf.« Er hielt mir einen Besucherausweis hin, den nahm ich mir und ging durch das Drehkreuz zum Lift, die Tür ging auf, und der Lift fuhr los, ohne dass ich irgendwas gedrückt hätte.
Oben angekommen stieg ich aus dem Lift direkt in ein Büro. Drei rotbraune Holzschreibtische standen im Raum verteilt, sodass niemand auf den Bildschirm eines anderen blicken konnte. Hinter den Bildschirmen an den Schreibtischen saßen drei Damen. Zwei von ihnen tippten wie verrückt und trugen Headsets. Die Dritte starrte mich feindselig an.
»Was kann ich für Sie tun?«
»Linder ist mein Name, ich habe einen Termin mit Herrn Sternwald.«
»Der Herr Direktor«, sie betonte den Titel, »hat ganz sicher keinen Termin mit Ihnen, da bin ich positiv.«
»Ich trage ein Schriftstück bei mir, das für ihn bestimmt ist«, sagte ich so höflich wie möglich.
»Das können Sie mir geben.«
»Leider nicht, streng vertraulich.«
Sie kniff die Augen zusammen und kaute ein wenig auf ihren Lippen herum. Dann musterte sie meinen Anzug, die Krawatte und vor allem die Schuhe.
»Na gut«, hörte ich noch, dann drückte sie einen Knopf, wartete kurz und sprach dann ins Headset.
»Theresa hier, vor mir steht ein Mann«, sie deutete mir, »wie war der Name noch gleich, ah Linder, ein Herr Linder, der ein Schriftstück für Sie abzugeben hat.« Pause. »Ah, gut, Sie haben keine Zeit.« Sie blickte mich an und schüttelte den Kopf.
»Es ist von seinem Vater.«
»Es ist von Ihrem Vater.«
Wieder ein kurze Pause, die sich aber zu ziehen begann.
»Gut, soll reinkommen.« Zu mir: »Sie können reingehen«, meinte Frau Therese und wies mit dem Kopf zu einer Tür, neben der Topfpalmen standen. Ich bedankte mich bei ihr und ging auf die Tür zu. Als ich die Hand an den Türknauf legte, summte es deutlich hörbar, ich konnte sogar die Vibration mit der Hand wahrnehmen. Die Tür sprang auf, und ich trat ein.
IV
Das Erste, was ich sah, war eine Glasfensterfront, die zwei Wände des Zimmers vollständig einnahm. Der Blick ging nach Norden und Osten, hin zum Kahlenberg und über die graue Leopoldstadt hinaus nach Transdanubien. Die Wolken hingen tief, aber ich war mir sicher, dass der Eindruck, den das Büro auf mich machte, auch bei Sonnenschein der gleiche sein würde. Lebensbejahendes Grausteingrau, fröhliches Stoffgrau und glänzendes Stahlgrau von einem Designer perfekt zusammengestellt. Mich überkam der Wunsch nach einer Wolldecke, einem Ostfriesen mit Sahne und Kluntje und viel animalischer Wärme. Dagegen war die staubige Kammer im Institut samt Topfpflanzenmumie, die ich mein Büro geschimpft hatte, eine Wellnessoase. Ich holte tief Luft und trat über die Schwelle.
Hinter einem majestätischen Schreibtisch thronte Joseph Sternwald. Er stand gut im Fleisch, sein Gesicht wies Ähnlichkeit mit einem rosa Fußball auf. Die kleinen schwarzen Augen verschwanden fast hinter den Fettpölsterchen auf seinen Wangen. Das dunkle Haar begann merklich auszudünnen, obwohl er noch immer so frisiert war, als ob das nicht der Fall wäre. Über einen engen Hemdkragen quoll Halsfett, den Rest verbarg der Schreibtisch. Der Gesamteindruck war der eines kleinen Bauern, der in einem teuren Anzug steckt und in einem Furcht einflößenden Büro sitzt und dabei soviel Qualen leidet, dass er kurz vor einem Erschöpfungssyndrom steht.
»Sie kommen von meinem Vater?«, fragte er und bot mir mit der Hand einen Stuhl an.
»Sehr richtig, Linder ist mein Name«, antwortete ich, während ich mich setzte.
»Mein Bruder hat mich bereits von Ihnen in Kenntnis gesetzt.«
»Das ist ja lieb von ihm.«
»Was haben Sie für mich?«
»Das hier.« Ich hielt ihm den Umschlag hin, den mit dem Brief natürlich, nicht den mit dem schönen gelben Euroschein.
Eine rundliche Hand erschien und nahm ihn mir aus der Hand. Neugier, Angst und Gier zeichneten sich in dem Gesicht vor mir ab. Da hatte jemand eine Heidenangst vor seinem Papa. Schließlich überwog die Neugier und er griff zu einem schweren Brieföffner. Ein Ratsch und er zerrte das Schreiben aus dem Umschlag hervor, wurde zuerst bleich, dann rot, dann wieder bleich. Er blickte zu mir, um herauszufinden, ob ich etwas bemerkt hätte, aber ich tat so, als würde ich stumpf vor mich hinstarren. Als er seinen Blick von mir abwandte, steckte er den Brief in die Innentasche seines Jacketts.
»Was spielen Sie eigentlich für eine Rolle in diesem Stück?«, fragte er mich schließlich ernst.
»Hat Ihnen das Ihr Vater nicht geschrieben?«
»Mein Vater setzt mich nicht von allem in Kenntnis, was er tut!«, fauchte er mich an, hatte sich aber gleich wieder unter Kontrolle. »Aber diesmal hat er geschrieben, Sie wären sein Privatsekretär«, fügte er honigsüß hinzu.
»Na dann wissen Sie ohnedies alles.«
»Mein Vater ist nun schon seit einem Jahr ans Bett gefesselt, und bis jetzt hat er keinen Privatsekretär gebraucht. Ich frage mich, warum jetzt.«
»Ich soll ihm dabei helfen, ein paar Dokumente zu ordnen, und wohl auch den einen oder anderen Gang erledigen.«
»Genaueres wissen Sie nicht?«
»Nein.« Ich hätte aber auch nichts gesagt, wenn ich mehr gewusst hätte. 200 Euro für einen Botengang können bei mir für eine Menge Loyalität sorgen. Vor allem, wenn noch mehr vom Selben zu erwarten ist.
»Es ist aber auch mein erster Tag«, fügte ich hinzu. Vielleicht konnte ich ihn ein wenig ködern, indem ich Gesprächsbereitschaft signalisierte. Josephs Stirn lag kurz in Denkerfalten, dann glättete sie sich wieder, und er bot mir etwas zu trinken an. Da ich neugierig bin wie eine Katze, nahm ich an. Die Familienverhältnisse interessierten mich ungemein.
Joseph stand auf und ging zu einer holzgetäfelten Wand. Unnötig zu sagen, dass das Holz grau war und mit Stahl verstärkt. Als die Bartür geöffnet wurde, breitete sich warmes gelbes Licht aus. In der trostlosen Designeratmosphäre wirkte das anheimelnd wie eine Coca Cola Weihnachtswerbung. Edles Bleiglas klirrte, die Bartür schloss sich, das Licht verschwand, und es stand ein riesiger Schwenker vor mir auf dem Schreibtisch. Joseph schenkte sich ein, dann mir und hielt dabei die Cognacflasche so, dass seine Fingerspitzen die Altersangabe teilweise verbargen. Zu sehen waren nur mehr zwei der vier Buchstaben. Ein einsames VP blieb, der Rest war verdeckt.
Wir hoben die Gläser und nahmen einen Schluck. Joseph schmeckte dem Cognac nach, und unbewusst fuhr seine linke Hand dorthin, wo er den Brief untergebracht hatte.
»Meinen Bruder Werner haben Sie schon kennengelernt, was halten Sie von ihm?«
»Wir hatten nur ein ganz kurzes Gespräch.«
»Kann ich mir denken. Er wird Sie wahrscheinlich davor gewarnt haben, mit erben zu wollen.«
»Genau.«
»Nehmen Sie es ihm nicht übel, aber der gute Kerl ist bankrott, und nur das Erbe kann ihn noch retten.«
»Ich bin nicht empfindlich.«
»Das wird Ihnen helfen, wenn Sie seine Angetraute kennenlernen. Die SP ist nicht jedermanns Sache.« Werner gluckste und nahm einen Schluck, um anschließend fortzufahren.
»Meine Stiefschwester und ihren Ehegespons haben Sie auch schon kennengelernt?«
»Nein, das Vergnügen hatte ich noch nicht.«
»Das wird sicher noch kommen. Er ist ein reizender Kerl, wirklich.« Er nahm einen Schluck. »Und?«
»Auch auf die Gefahr hin, jetzt begriffstutzig zu wirken, was meinen Sie mit dem ›und‹?«
»Ob Sie erben wollen.«
»Natürlich, Ihr Vater scheint mir sehr reich zu sein.«
Meine Offenheit brachte Joseph komplett aus dem Konzept. Er starrte mich böse an, und wenn ihn nicht seine Wampe daran gehindert hätte, wäre er glatt über den Tisch gesprungen, um mich zu würgen.
»Sie haben sich also eingeschlichen! Sie, Sie …« Es fiel ihm nichts ein, darum wurde aus der geplanten Beschimpfung nur ein »… Sie Kerl!«. Er stand auf und brüllte los.
»Schaun Sie, dass Sie rauskommen. Ich werde das zu verhindern wissen, dass Sie meinen armen alten Vater ausplündern! Nicht mit mir, haben Sie mich gehört?«
Ich blieb ruhig sitzen, nippte an meinem Cognac, der mir nicht sonderlich schmeckte, und ließ den Wortschwall über mich ergehen. Irgendwie schmeckte der Schnaps überhaupt nicht nach Frankreich. Eher so, als ob er irgendwo hinter Wels aus einem Alufass gelaufen wäre. Als Joseph fertig gebrüllt hatte, meinte ich sachlich:
»Ich habe nur einen Job angenommen, der mir angeboten wurde. Mehr nicht. Ich habe auch überhaupt keine Ambitionen auf das Erbe. Aber wenn Sie mich fragen, dann antworte ich. Meine Antwort bestand in nichts anderem, als dass ich gerne erben würde. Ich würde auch gerne im Lotto gewinnen, vielleicht würde ich auch gerne auf den Mond fliegen und mehr dergleichen. Zu diesen Sachen könnte ich willentlich wahrscheinlich mehr dazu beitragen als dazu, Ihren Vater zu beerben. Seien Sie beruhigt.«
Ich stand auf und ging. Joseph stand da und schnappte nach Luft wie ein Karpfen an Land. Von der Tür her meinte ich noch zum Abschied: »Aber aufs Geld scheinen Sie mir nicht weniger versessen zu sein als Ihr Bruder.« Damit war ich draußen. Ich nickte Therese freundlich zu und ging zum Lift. Unten angekommen gab ich meinen Ausweis ab und trat hinaus in die Winterluft. Ich stellte den Mantelkragen hoch und machte ein paar Schritte auf dem Gehsteig. Mit 200 Euro in der Tasche kann man gut essen gehen. Es war gerade erst Mittag, also war es noch möglich, einen netten Tisch für zwei zu reservieren. Ich ging gerade im Kopf eine Liste von Lokalen durch, als neben mir eine Limousine anhielt und das Fenster runtergelassen wurde. Der Wagen war ein weißer VW Phaeton. So was fällt auf.
»Herr Linder?«
»Ja. Mit wem hab ich es zu tun?«
»Fritz Peter, meine Freunde nennen mich FP. Ich bin der Ehemann der Halbschwester. Wollen Sie nicht einsteigen, ich würde Sie gerne kennenlernen.«
»Sehr gerne«, antwortete ich. Die Familie war wirklich bemerkenswert. Wer hätte gedacht, dass sich jeder brennend für den Privatsekretär des Vaters interessieren würde. Die Leute mussten eine Heidenangst um ihr Geld haben, das gegenwärtig noch Herrn Sternwald gehörte.
»Ich will Ihnen nicht die Zeit stehlen, sagn S’ ma einfach, wos hinwollen, dann führ’ ich Sie.«
»Fein. In den 15., Felberstraße 32/6-8.«