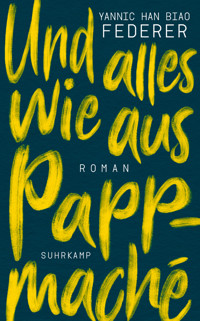16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein herzzerbrechendes, ein wichtiges Buch.« Daniel Schreiber
Charlotte und Yannic erwarten ein Kind. Zwischen Pränatalscreening, Projektabschlüssen und Elterngeldrechner richten sie sich ein auf ein neues Leben als Familie. Doch dann ereignet sich die Katastrophe, ihr Sohn, Gustav Tian Ming, stirbt. Eben noch haben sie Wickeltische gegoogelt, Stillkissen angeschafft, plötzlich müssen sie einen Kindersarg aussuchen, ein Grab kaufen. Alles fühlt sich falsch an, verrückt und wie ausgedacht, aber es passiert wirklich. Erschütterte Verwandte und Freunde reisen an oder nehmen Anteil aus der Ferne, tragen Opferschalen in den Tempel. Und während Charlotte und er mit einer Bürokratie zu kämpfen haben, die mit totgeborenen Kindern kaum umzugehen weiß, beginnt Yannic aufzuschreiben, was um ihn her geschieht. Es ist ein Versuch zu begreifen, was ihnen widerfahren ist, eine Sprache zu finden für die Trauer und den Schmerz, aber auch für die Wärme und Liebe, die sich darin verbirgt.
Präzise und eindringlich erzählt Yannic Han Biao Federer vom Verlust seines Sohnes, von Abschied und Carearbeit, von Elternschaft und Liebe. Für immer seh ich dich wieder ist ein Dokument der Trauer – und der heilenden Kraft des Erzählens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Yannic Han Biao Federer
Für immer seh ich dich wieder
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert durch die Kunststiftung NRW sowie durch ein Residenzstipendium des Goethe-Instituts in Beijing.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5482.
Originalausgabe © Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagfoto: Anthony Arvin
eISBN 978-3-518-78239-2
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
I
II
III
IV
V
VI
Informationen zum Buch
Für immer seh ich dich wieder
I
Es ist spät, aber wir fahren noch zu Kaufland, haben eingeladen für Samstag, Charlotte zählt die Gäste auf der Liste durch, ich hieve Kästen in den Einkaufswagen, Kölsch und Helles, Limo und Nullkommanullbier, außerdem Chips und Salzstangen, Cracker, Mikado. Dann essen wir Salat, müde und schweigend, sie geht ins Bett, ich an den Schreibtisch, schalte den Rechner ein, die Leselampe, schlage das Buch auf. Ich arbeite bis vier, um halb fünf lege ich mich hin, bin sofort weg.
Ich schrecke auf, sie steht vor mir, etwas stimmt nicht, es ist acht Uhr. Sie sagt, sie hat Schmerzen, hier, nicht schlimm, es wird nichts sein, vielleicht Blähungen vom Salat, oder Übungswehen, die Mutterbänder, so was. Sie fährt zur Ärztin, nur zur Sicherheit, bleib ruhig liegen, sagt sie, bist du sicher, frage ich, ja, klar, sagt sie, keine Sorge, und geht hinaus.
Hinter der Tür ihre Stimme, etwas stimmt nicht, ich schlage die Decke zurück, sie steht im Flur. Die will mich nicht haben, sagt sie, wer, frage ich, die Ärztin, sagt sie, ich soll in die Klinik. Warum das denn?, frage ich, keine Ahnung, sie guckt aufs Telefon, vielleicht ist die Praxis voll, oder sie will zeitig ins Wochenende. Ich fahr dich jetzt dahin, sage ich, nehme ein Shirt vom Stuhl, eine Hose, ja, gut, sagt sie, krümmt sich ein wenig. Was ist, frage ich. Keine Ahnung, sagt sie, hält sich den Bauch, tut weh, und mir ist nicht gut, irgendwie.
Wir rufen noch einmal an, wir sagen, wir kommen jetzt, die Arzthelferin sagt, aber auf eigene Gefahr. Was stellen die sich so an, sage ich. Ja, sagt Charlotte, die stellen sich an. Dann suchen wir die nächste Klinik heraus, auch dort wollen sie uns nicht, haben keine Neonatologie im Haus.
Vor uns ein verbeulter Golf, er ist unendlich langsam, ich kann nicht überholen, in Zeitlupe schiebt er sich auf die Abbiegespur, kriecht vom Beschleunigungsstreifen und über den Zubringer. Auf der Brücke beginnt Charlotte zu weinen. Er ist tot, sagt sie, ich spüre ihn nicht mehr, er ist tot. Ich sage, hör auf. Ich sage, Katastrophe machen wir erst, wenn Katastrophe ist. Ich sage das wirklich. Erst mal zum Krankenhaus, sage ich.
Endlich am Parkplatz vor der Gynäkologie, ein beiger Audi steht vor der Schranke, ich halte hinter ihm, die Heckscheinwerfer leuchten auf, die Fahrerin blickt in den Spiegel, ich fluche, bin hektisch, setze zurück, lasse den Motor aufheulen, mit einem Ruck springt der Wagen auf den Gehweg, sie könnte jetzt rückwärts hinaus, überlegt es sich aber anders, zieht nun doch ein Ticket, rollt hinein. Ich fluche noch mehr, rangiere, strecke mich aus dem Fenster, um auf den Knopf zu drücken, folge ihr nach, es ist nichts frei, alles voll, ich kann nicht denken, fluche und fluche, biege hinter ihr zurück auf die Straße und ums Karree.
Lass mich einfach raus, sagt Charlotte, als wir uns wieder der Einfahrt nähern, vor uns ein Lastwagen, der die halbe Fahrbahn blockiert, ein Lieferant schiebt Paletten von der Entladeklappe, auf der Gegenfahrbahn drücken sie sich an ihm vorbei, ja, sage ich, okay, sie steigt aus, wirft sich den Rucksack auf die Schulter, ihr roter Schal flattert überm Mantel, irgendwo hupt es.
Ziellos kurve ich durch die Straßen, entdecke eine Beschilderung, folge ihr, aber die Stellplätze sind abgezäunt, Baustelle, ich irre weiter, endlich eine Lücke vor einem Laden, am Automaten suche ich Kleingeld, habe kein Kleingeld, gegenüber ein Kiosk, ich strecke dem Mann einen Schein hin, können Sie mir wechseln. Er schüttelt den Kopf, alle zahlen mit Schein, immer nur Scheinescheine, keiner hat Kleingeld. Also gut, sage ich, lege ihm ein Corny auf die Theke und den Schein dazu, er schimpft weiter, Scheinescheine, während er Münzen aus der Kasse zieht, mein Telefon klingelt, ihr Foto auf dem Display, ich nehme ab, der Mann gestikuliert mit seinen Münzen in der Hand, ob ich Eineuromünzen brauche oder Zweieuromünzen, vielleicht drei Zweieuromünzen und zwei Eineuromünzen, reicht das so, passt das so, am Telefon eine fremde Stimme, wo sind Sie, wo bleiben Sie, kommen Sie in den Kreißsaal, kommen Sie sofort in den Kreißsaal.
Ich kann noch immer nicht denken oder denke nur Unsinn, fluche, ich fluche ängstlich und hilflos, nehme die Münzen vom Tresen, während der Mann auf mich einredet, Scheinescheine, ich haste zum Automaten, ziehe das Papier aus dem Schlitz, lege es hinter die Windschutzscheibe, schließe ab, merke mir die Hausnummer, vor der unser Wagen steht, haste zur Klinik.
Ich erzähle das später immer wieder. Dass ich tatsächlich noch dieses Parkticket löse und ins Auto lege, mir sogar die Hausnummer merke, Zülpicher Straße zweihundertvierzig. Dass ich überhaupt einen Parkplatz suche, statt einfach den Wagen neben der Einfahrt stehen zu lassen, mit Warnblinkanlage, offenen Türen, egal.
Immer geradeaus, sagen sie am Empfang, ich folge dem Arm des Mannes, gehe durch einen Flur, er windet sich durch das Gebäude, am Ende eine verschlossene Tür mit Gegensprechanlage, ich klingele, sage irgendwas, es summt, wieder ein langer Flur, jemand zieht mich in einen Raum.
Halbnackt liegt sie da, ihre Hose zerknüllt zwischen den Beinen, darin Blut, sie hat geblutet, neben ihr eine Ärztin, die schweigend auf einen Bildschirm schaut, mit der Sonde über ihren Bauch fährt. Um uns her Menschen in Grün und Blau. Charlotte schaut mich an. Sie weint. Sie sagt: Er ist tot. Sein Herz schlägt nicht mehr. Ich weine auch, kann nichts sehen, will zu ihr, kann nicht zu ihr, jemand zieht mir den Rucksack von den Schultern, die schwere Jacke, schiebt mich zur Seite, lässt mich dort stehen.
Der Oberarzt spricht langsam und ruhig. Zwischen Plazenta und Gebärmutterwand hat sich ein Hämatom gebildet, sie hat sich vorzeitig gelöst, hat unseren Sohn nicht mehr versorgt, es gibt keine messbaren Herztöne. Das Hämatom war fest umschlossen, es lag unter dem Mutterkuchen, nichts ist ausgetreten, was man hätte bemerken können, eben erst hat es sich geöffnet, daher das Blut. Er sagt, es tue ihm sehr leid. Er sagt, es handle sich um eine sehr sehr seltene Komplikation. Er sagt, nein. Er sagt, nein, Sie haben nichts falsch gemacht. Er sagt, nein, hören Sie auf, Sie haben nichts falsch gemacht. Nein, sagt er, wirklich nicht. Nein.
Dann spricht er von natürlicher Geburt, sie sei mit gewissen Risiken verbunden, aber weiterhin möglich, hinter ihm wird die Hebamme unruhig, als er aus dem Raum geht, kommt sie zu uns, beugt sich zu Charlotte herunter, fasst sie an den Schultern. Sie wollen keine natürliche Geburt, sagt sie. Sie wollen einen Kaiserschnitt. Charlotte nickt. Wischt sich die Wangen. Ja, sagt sie, ja, bitte.
Sie bringen Charlotte hinaus in den Flur, ich suche unsere Taschen und Jacken zusammen, wanke ihnen nach, im Geburtsraum furchtbarer Lärm, eine Baustelle an der Außenfassade, als grübe sich der Bohrhammer direkt in meine Schläfe. Sie wird von der Liege auf ein Bett gehievt, bekommt Zugänge in den Arm gestochen, in die Hand, Vlieselektroden auf den Körper geklebt, einen Clip an den Finger, bunte Kabel baumeln an einem Monitor, er zeigt ihren Blutdruck, das Elektrokardiogramm, die Sauerstoffsättigung. Der OP sei noch belegt, sagt jemand, in einer halben Stunde könnten sie operieren. Die Hebamme beugt sich wieder zu ihr, komm mal her, sagt sie, nimmt sie in den Arm. Der Anästhesist gibt ihr ein Klemmbrett, er stellt Fragen, eingenommene Medikamente, bekannte Allergien und Unverträglichkeiten, dann erklärt er, was gleich passiert. Sie sagt, ich habe Angst, er sagt, wir passen auf dich auf, sie sagt, werde ich denn wieder aufwachen, er sagt, wir geben acht auf dich, wir passen auf, aber er sagt nicht einfach: ja. Sie ist blass, sie blickt zu mir, sie sagt, ruf alle an, sag ihnen, was los ist, ich nicke, als wüsste ich, was los ist, als könnte ich das erklären, trete hinaus auf den Flur, ein Mann mit Maxicosi in der Hand, sein Blick, an seinem Blick erkenne ich, wie ich aussehen muss.
Ich rufe Charlottes Schwester an. Ich sage, unser Sohn ist tot. Sie sagt, was. Was. Was. Wie kann das sein. Das kann doch nicht sein. Sie weint. Ich sage, sie bringen sie jetzt in den OP. Was. Was ist passiert, sagt sie. Was ist passiert. Ich sage, ich muss jetzt auflegen. Ich rufe ihre Mutter an. Ich sage, unser Sohn ist tot. Sie bringen Charlotte jetzt in den OP. Sie sagt, was, was ist passiert. Was. Ich sage, ich muss jetzt auflegen, ich muss jetzt. Ich rufe ihre andere Schwester an, sie geht nicht ans Telefon. Ich rufe meine Mutter an. Ich spreche mit meiner Mutter, während ihre Schwester zurückruft. Dann rufe ich ihren Vater an.
Ich bin zurück, Charlotte sieht fahl aus, ihre Lippen ganz ausgeblichen, sie sagt, mir ist nicht gut, mir ist gar nicht gut. Es wird hektisch, immer mehr bunte Kittel, die hereinkommen, hinauseilen, Rufe auf dem Flur. Sie schaut auf ihren Monitor, oh Gott, sagt sie. Wir passen auf dich auf, sagt jemand, dreht den Bildschirm weg, eine Anästhesistin offenbar, ihr Kollege von eben ist nicht mehr da, bei der anderen OP, denke ich, wir passen auf, es geht jetzt los, sagt sie, sie öffnen die Tür gegenüber, der Raum sieht nicht nach Operationssaal aus. Sie schieben sie trotzdem hinüber, ich will mit, aber die Hebamme sagt, du kannst nicht mit, Vollnarkose, sie wird intubiert, ich sage, darf ich ihr noch einen Kuss geben, ich möchte ihr noch einen Kuss geben, sie sagt, ja, natürlich, aber ihre Körpersprache sagt, nein, oder: es muss jetzt schnell gehen, es muss jetzt alles sehr schnell gehen, ich komme kaum zu ihr durch, küsse sie, sage irgendwas, sie auch, dann stehe ich auf dem Gang.
Habe ich gewusst, in dem Moment, wie wichtig es war, ihr diesen Kuss gegeben zu haben, weil es der letzte hätte sein können, ein Abschied zwischen Kabeln, Schläuchen, Hektik, Todesangst? Hat die Hebamme ihn deshalb noch zugelassen, weil auch sie es geahnt hat, obwohl die Zeit knapp war, um ebendiesen Tod zu verhindern, zumindest den zweiten?
Nebenan stemmen sie weiter die Fassade auf, eine Hebammenschülerin ist bei mir, sie sagt, ich bringe dich rüber, dort ist es ruhiger, ich sage, okay, sammle wieder unsere Jacken und Taschen vom Boden, Charlottes blutige Jeans, Unterhose und Unterhemd, sie sagt, lass das doch, ich kann das gleich machen, ich bring dir alles, komm, dabei legt sie eine Hand auf meinen Rücken, wo lernen sie das, sich so zu kümmern, ich sage, nein, suche den zweiten Socken, kann den zweiten Socken nicht finden, will den zweiten Socken finden, er liegt zwischen Gymnastikball und Gebärlandschaft.
Dann sitze ich allein in Geburtsraum vier, gedimmtes Licht, Pappbecher und Tafelwasser, ich starre auf das Entbindungsbett, auf die Wickelauflage, auf die Waage für die Erstuntersuchung, ich stehe auf, sehe aus dem Fenster in den Innenhof, der dunkel ist und verlassen. Ich rufe Alex an, komme nicht durch, ich schreibe, kannst du abnehmen. Bitte. Hey, sagt er, räuspert sich, hey, na? Ich sage, unser Sohn ist tot. Wir sind im Krankenhaus. Er sagt, oh Gott. Was ist passiert. Ich sage, die Plazenta hat sich gelöst, hat ihn nicht mehr versorgt, mein Kind ist gestorben, einfach so. Oh Gott, Yannic, sagt er, das tut mir so leid. Ich sage, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich hier allein rausgehe. Er sagt, was ist mit Charlotte, wie geht es Charlotte. Ich sage, ich weiß es nicht. Sie wird operiert. Ich habe Angst, Alex. Wenn ich hier allein rausgehe. Wenn ich hier allein rausgehe. Ihre Mutter ruft an, ich sage, Alex, ihre Mutter ruft an, er sagt, ja, ja, klar, ich sage, hallo Doris. Dann rufe ich meinen Vater an. Ich sage, wir sind im Krankenhaus, unser Sohn ist tot. Er sagt, oh. Oh, sagt er, oh nein. Ich sage, es ist so schrecklich, es ist so furchtbar, wie kann das sein. Es ist ungerecht. Es ist falsch. Ich sage, Charlotte ist jetzt im OP. Ich sage, ich habe Angst. Ich weine in den Hörer. Oh, macht mein Vater. Oh nein.
Alex schreibt: Yannic, wenn du weiterreden möchtest, ruf mich immer an, ja? Ich bin da.
Ihre Mutter schreibt: Bitte drauf hinweisen, dass Blutverdünner genommen. Nicht, dass sie noch verblutet.
Meine Mutter schreibt: Deine Nachricht ist sehr sehr traurig. Es tut mir unendlich leid. Sag Charlotte, dass es mir sehr leidtut und ich ihr viel Kraft und Liebe wünsche, damit fertig zu werden. Auch dir wünsche ich viel Kraft. Ich würde dich gerne umarmen und trösten. Ich bin noch ganz geschockt. Kann es kaum fassen. Alles Liebe für euch beide. Dann ruft sie an, ich gehe nicht ans Telefon, muss in den Innenhof sehen. Auf meiner Brille ein salziger Film, ich reibe mit dem Tuch, es hilft nichts.
Der Oberarzt. Er sagt, Ihre Frau ist noch im OP, aber sie ist über den Berg. Ich sage, okay. Okay, sage ich. Er fragt, ob ich unseren Sohn sofort sehen möchte oder erst, wenn sie aufgewacht ist. Wenn sie aufgewacht ist, sage ich. Er fragt, ob wir eine seelsorgerische Begleitung wünschen. Ich sage, ja. Er sagt, katholisch oder protestantisch. Ich sage, protestantisch. Er sagt, die Klinik hat einen eigenen Friedhof. Das sei zwar etwas seltsam, aber historisch so gewachsen, jedenfalls gebe es da die Möglichkeit der Sammelbestattung, wir müssten nichts organisieren, nichts bezahlen, man kümmere sich um alles, und die Eltern würden eingeladen zur Beisetzung, wir müssten das nicht sofort entscheiden, sollten uns das überlegen. Selbstverständlich könnten wir auch einen Bestatter beauftragen, unseren Sohn zu holen, könnten ihn selbst beisetzen lassen. Ja, sage ich. Wir begraben ihn selbst. Gut, sagt er, gut, ich wollte das nur gesagt haben, damit Sie das wissen. Weil das ja auch mit Kosten verbunden ist. Aber wenn Sie ihn lieber –. Ja, sage ich. Wir machen das selbst. Gut, sagt er. Gut. Also, ich verständige jetzt die Seelsorge. Ich nicke, sage, danke, ja. Und Ihre Frau kommt dann gleich zum Aufwachen hierher. Okay, sage ich. Und er: Mein herzliches Beileid. Es tut mir wirklich sehr leid.
Sie ist schon halb wach, als man sie hereinschiebt, fängt sofort an zu lallen. Mein Kind, sagt sie, mein Kind ist tot. Wie kann das sein. Ich halte ihre Hand, küsse ihre Lippen, sie sind trocken und spröde. Bunte Kabel am Vitaldatenmonitor, ein Schlauch an der Blutdruckmanschette, außerdem Tropf, Katheter, Drainage.
Die Hebamme kommt und die Auszubildende, sie haben Schichtende, sie umarmen uns, sie sagen, wir reden noch mal, ja? Sie schreiben uns, bitte, und dann reden wir noch mal. Ja, sagen wir. Ja, danke. Alles Gute, sagen sie.
Es klopft, die Hebamme von der Spätschicht, sie gibt mir einen Zettel. Kannst du uns seinen Namen aufschreiben? Klar, sage ich. Na klar. Danke, sagt sie, lässt uns allein, ich setze mich ans Bett, zwischen Urinbeutel und Drainagereservoir. Gustav, sage ich, es ist ein Gustav, oder? Ja, sagt Charlotte, natürlich, Gustav. Unser kleiner Gusti. Dann sehe ich mir die chinesischen Namen an, die meine Tante in den Tempel bringen wollte, ich sage, das müssen wir jetzt allein entscheiden. Sie sagt, ja. Tian Ming?, frage ich. Ja, sagt sie, Himmel und hell, nicht? Genau, und das ist die Morgendämmerung. Schön, sagt sie, ja, Tian Ming. Ich nicke, schreibe es auf.
Der Monitor fiept, wir schrecken auf, was ist das, sagt sie, ich weiß nicht, sage ich, betätige die Klingel, eine Schwester öffnet die Tür, sieht sich das Gerät an, nur eine Fehlfunktion, der spinnt ein bisschen, keine Sorge, sie drückt am Touchscreen herum, die Meldung verschwindet. Kaum ist sie raus, fiept es schon wieder, ich klingele noch einmal, es dauert etwas, dann ist sie zurück, stellt den Monitor stumm, alles gut, meint sie, wir sehen das auch drüben. Später kommt die Anästhesistin, fragt, wie Charlotte sich fühlt, klickt am Bildschirm herum, zieht schließlich die Kabel von den Elektroden, die Elektroden von der Haut. Brauch ich das nicht mehr?, fragt sie die Ärztin. Die Anästhesistin schüttelt den Kopf, nein, das brauchst du nicht mehr. Meine Werte sind okay? Ja, die Ärztin nickt, die sind alle prima. Gut, sagt sie. Ich will nämlich nicht sterben. Nein, sagt die Ärztin, du stirbst auch nicht. Gut, sagt Charlotte, danke.
Sie bringen uns Gustav in einem kleinen Korb, sein Gesicht lugt unter einer Decke hervor, auf der Katzen, Elefanten und Bären abgebildet sind, vergnügt sitzen sie auf einer Art Schaukelbrett, oder sie halten sich mit ihren Pfötchen daran fest, jedes der Bretter baumelt an dicken Seilen, die an türkisfarbenen Sternen befestigt sind, sie tragen die Tierkinder durch die Nacht, und die freuen sich darüber, ein Katzenbaby kichert sogar. Darunter ist Gustav in ein Handtuch gewickelt, außerdem trägt er eine Mütze aus grüngrauer Wolle, der Bund beige. Die Hebamme schlägt Decke und Handtuch zurück, hebt ihn vorsichtig heraus, behutsam, an seinen Füßen gestrickte Socken, ebenfalls grüngrau und beige, auf dem Strampler graue Schmetterlinge.
Ich lege ihn dir auf die Brust, ja? Charlotte schaut zur Hebamme, okay, sagt sie, aber ich sehe, dass ihr das eigentlich zu schnell geht, dass sie erschrickt, dass sie ihn vielleicht erst einmal in seinem Körbchen hätte ansehen wollen, ein Händchen hätte halten wollen, die Hebamme gibt ihr keine Zeit dafür, sie sagt, vielleicht schiebst du dein OP-Hemd hoch. So?, fragt Charlotte. Ja, genau, sagt die Hebamme, prima.
Kannst du bitte Fotos machen? Ja, sage ich, ja, klar, ich stehe auf, suche das Telefon, fotografiere: Charlotte, weinend, Gustav seitlich auf ihrer Brust liegend, unter ihrer Decke, ihre Rechte schützend auf seiner Schulter. Charlotte und Gustav in gleicher Position, Charlotte zu ihm hinunterblickend. Von der Seite her fotografiert: Gustavs Gesicht an ihren Körper geschmiegt, ihre Finger umfassen seinen kleinen Arm, darüber ihre verzogenen Mundwinkel. Dann Charlottes Daumen und Zeigefinger, seine Hand haltend. Dann Gustavs Hand auf meiner ausgestreckten Linken. Dann seine Hand von meiner umschlossen. Dann ein Porträt von Gustav, den Ellenbogen angewinkelt, eine irgendwie fragende Geste, aber friedlich, wie von tiefem Schlaf umfangen.
Ich nehme ihn zu mir, habe Angst, etwas falsch zu machen, Charlotte sagt, da kann man nichts falsch machen, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Seine Füße in meiner Armbeuge, die Schulter an meinem Bauch, sein Kopf in meiner Handfläche, das Gesicht mir zugewandt. Ich weine. Streichle seine Nase, seine Wange, dabei verzieht er den Mund, die Augen, einmal kräuselt sich seine Stirn, als störte ich ihn beim Dösen und Dämmern. Es wirkt auch, als atme er, sein kleiner Körper bewegt sich auf und ab, dabei ist es nur mein Körper, der sich unter ihm bewegt, seine Lungenflügel haben sich nie auffalten dürfen, waren nie mit Luft gefüllt, er hat nicht geschrien, nicht gewimmert, nichts, und wie ich ihn liebkose, mit ihm rede, fällt mir ein, dass ich nie seine Augen sehen werde, nicht erfahren werde, welche Farbe seine Iris hat, wie es ist, von ihm erfasst, erkannt zu werden, als Schemen erst, als Mensch, als Vater irgendwann. Papa gerufen zu werden.
Ach Gustav, kleiner Gustav, sage ich. So war das nicht gedacht. So war das alles nicht gedacht. Ich sage auch: Hallo. Hallo, kleiner Gustav. Hi. Hey. Hey, du Kleiner. Ich sage: Mein Sohn ist tot. Mein armer, kleiner Sohn ist tot. Wie kann das sein. Wie kann das sein. Es ist so unfair. Es ist so falsch. Das kann doch nicht sein. Darf doch nicht sein.
Ich fotografiere Gustav, in meinem Arm liegend. Ich mache Selfies von uns zu dritt. Charlotte sagt, gib mal her, ich reiche ihr das Telefon, dann macht sie Fotos von Vater und Sohn.
Die Seelsorgerin ist da. Sie sagt, es tue ihr sehr leid. Sie gibt uns eine kleine Engelsfigur aus Metall, ich glaube, Messing oder Kupfer, kühl und schwer liegt sie in der Hand. Ich sage, wie soll ich an einen Gott glauben, der mir meinen Sohn nimmt. Sie schaut mich an. Mhm, macht sie und nickt. Ich meine das gar nicht rhetorisch, aber sie betrachtet mich schweigend, irgendwann sagt sie, ich könnte Ihren Sohn jetzt segnen. Okay, sage ich. Sie spricht ein Gebet, von dem ich kaum etwas mitbekomme, ich sehe nur, wie sie Rosenwasser auf seine Hände streicht, auf seine Stirn, und ich weine auf seinen Strampler, meine Nase läuft, es fließt mir in den Bart, vom Bett her höre ich Charlotte, sie schluchzt. Amen, sagt die Seelsorgerin, Amen, flüstert Charlotte, ich sage nichts, oder vielleicht sage ich danke.
Ich glaub, die war katholisch, sagt Charlotte später. Auch das noch, sage ich. Wir lachen.
Irgendwann ist die Hebamme zurück, sie sagt, es hat geklappt, wir haben ein Familienzimmer für euch. Das ist toll, sagt Charlotte. Ja, sage ich, toll. Ich helfe der Hebamme, das Bett in die Zimmermitte zu bugsieren, wir legen Gustav zurück in seinen Korb und seinen Korb ans Fußende, wo ich ein Auge auf ihn habe, während die Hebamme vom Kopfende her schiebt, sie fragt, sollen wir sein Gesicht abdecken, wegen der Menschen draußen, ich sage, nein, er ist wunderschön, können ihn ruhig alle sehen. Genau, sagt Charlotte, und die Hebamme sagt, ja, richtig, und wenn jemand kommt, stelle ich mich vor euch, okay? Ja, sage ich, ja, danke. Na klar, sagt sie, dafür nicht. Etwas ist an ihrer Stimme, denke ich, die Art und Weise, wie sie spricht. Es hilft und trägt. Sie zieht eine metallene Halterung unter dem Bett hervor, ich werfe unsere Taschen und Jacken darauf, Charlottes Kleider stopfe ich in einen Jutebeutel, dann gehen wir hinaus. Vermutlich stehen Menschen um uns her, vermutlich schauen sie auch, ich nehme sie kaum wahr, arbeite nur gegen die Massenträgheit des Gefährts, betätige einmal einen Türöffner, blicke dabei auf meinen Sohn, auf Charlotte, auf ihre Schläuche und Beutel, die sich nirgends verhaken dürfen.
Im Aufzug denke ich: Vermutlich stehen Menschen um uns her, vermutlich schauen sie auch, ich nehme sie kaum wahr, arbeite nur gegen die Massenträgheit des Gefährts. Dann schüttele ich mich, hasse mich dafür, dass mein Kopf schon mitspricht, dass er schon probt und wägt, wie ich formulieren würde, wie ich erzählen würde, wie ich Sätze aneinanderreihen würde, wo ich eine Auslassung setzen würde und wo ein schmückendes Detail. Später sage ich, du, es ist schlimm, ich kann es nicht lassen, was denn, sagt sie. Ich sage, ich habe immerzu diese Literaturstimme im Ohr, die beschreibt, was passiert, es ist wie ein Radio hinter der Schläfe, das quasselt und schwatzt, als wäre das hier Recherche, als wäre das hier für einen Text, aber das ist kein Text, das ist wirklich, das ist echt, das ist unser kleiner Sohn, der tot ist, und –, Charlotte schüttelt den Kopf, natürlich schreibst du über Gustav, bist du verrückt, natürlich schreibst du über ihn. Meinst du?, frage ich. Ja, klar, sagt sie. Ich will, dass du über ihn schreibst. Ich wär beleidigt, wenn du’s nicht tun würdest, ist doch unser Sohn.
Ich muss auf Toilette, ich habe Durst, sie sagt, ich auch, ich sage, Moment, ich wasche mir kurz die Hände. Im Bad gibt es Seife und Sterillium, ich benutze beides, dann stelle ich ihr ein Glas auf den Tisch, schraube am Trinkwasserkarton, verstehe den Mechanismus nicht, tue mir weh, es klopft, es ist die Pflegerin, sie sagt, sie kann uns etwas zu essen bringen, wenn wir ihr sagen, was wir wollen, wir können es aber auch selbst aussuchen, am Buffet, ich sage, okay, ich suche es selbst aus, sie sagt, in Ordnung, geht hinaus. Ich schenke ein, reiche Charlotte das Glas, sie kann sich nicht aufrichten wegen der Wunde und der Naht, hat auch Gustav im Arm, es rinnt ihr links und rechts von den Mundwinkeln, oh, mache ich, ziehe Papiertücher aus einem Spender an der Wand, trockne ihr Hals und Brust. Hat Gusti etwas abbekommen?, fragt sie, nein, sage ich, der Gusti hat nichts abbekommen, und fülle nach, sie versucht es wieder, jetzt halte ich ihr Tücher unter das Kinn, was funktioniert, sie sagt, das reicht, danke. Ich trinke selbst, will gerade ins Bad, als die Pflegerin wieder in der Tür steht, ich soll kommen, das Buffet schließt gleich, ich sage, ja, okay, ich komme. Gut, sagt sie und lässt die Tür offen. Ich suche meine Maske, finde meine Maske nicht, ich frage Charlotte, was sie essen möchte, während ich in meine Jackentasche fasse, im Rucksack nachsehe, zwischen den Kleidern, sie sagt, ich weiß nicht, was gibt’s denn, ich sage, weiß ich auch nicht, ich schaue mal, finde die Maske endlich in meiner Hose. Ich schlurfe den Flur entlang, vorbei an Pausenraum und Stationszimmer, an Lager und Küche, dahinter die Essensausgabe, an der ein Mann steht, ich mache ein Foto und sage, sorry, ich kann mir einfach nichts merken, er sagt, na klar; bin sofort wieder da, er guckt auf die Uhr, okay. Im Zimmer sehe ich aufs Display, zähle auf, es gibt Äpfel und Birnen und Kiwi, es gibt Kekse und Fruchtjoghurt, Salat, Brot, Aufschnitt, Charlotte sagt, ich weiß nicht, hol mir irgendwas, ich gehe zurück, ordere Kiwi, Kekse, Joghurt, zwei Scheiben Vollkorn, zwei Scheiben Mischkorn, Käse und eine Wurst, die ich Fleischwurst nenne, die aber nicht Fleischwurst heißt, der Mann sagt, nein, das da ist Fleischwurst, aber Sie wollen diese hier, nicht? Und zu trinken? Pfefferminztee, sage ich, zwei Mal, der Mann blickt auf. Stillt Ihre Frau? Ich sage, nein, unser Sohn ist gestorben. Sie muss abstillen. Oh, sagt er, ach so. Er dreht sich um, pumpt heißes Wasser aus einer großen Thermoskanne, als er die Tassen über die Theke reicht, guckt er mich wieder an, mein Beileid, sagt er, danke, sage ich, er sagt, wollen Sie noch von der anderen Wurst? Nein, sage ich, danke, das reicht. Oder noch etwas Frischkäse? Danke, sage ich, das sollte reichen. Butter? Hab ich schon, danke. Mein Beileid, sagt er noch einmal. Danke, sage ich, danke, nehme das Tablett von der Halterung, im Zimmer stelle ich es auf den Tisch und sage, jetzt gehe ich auf Toilette. Ja, mach das, sagt sie, aber die Pflegerin klopft, sie hat Einwegtupfer dabei, schiebt sie uns in den Rachen und dann in ein Röhrchen, das sie beschriftet, anschließend schlägt sie die Bettdecke zurück und Charlottes OP-Hemd, mit einem länglichen Testbausch reibt sie über ihre Leiste links und rechts. Für was ist das?, frage ich. Krankenhauskeime, sagt sie. Als sie aus der Tür ist, klingelt das Telefon, Charlottes Familie steht am Empfang.
Ihre Schwester kommt aufs Zimmer und ihr Freund, wir umarmen uns, oh Gott, sagt Cristina, als sie sich zu Charlotte beugt und zu Gustav, ihnen Küsse auf die Stirn gibt, oh Gott. Paul steht da, irgendwie gekrümmt, mit eingefallenen Schultern, der kleine Mensch, sagt er immer wieder, der arme kleine Mensch, er wischt sich mit dem Handrücken über Augen und Nase. Später müssen sie nach unten, damit Charlottes Eltern aufs Zimmer dürfen, ihr Vater tritt herein und erstarrt, schluchzt auf, als er seinen Enkel sieht. Ihre Mutter wirft Handtasche und Jacke in eine Ecke, will Charlotte in die Arme schließen, was eigentlich nicht geht, weil sie sich nicht aufrichten kann, nur die Hände kann sie ihrer Mutter auf die Schultern legen, und Doris drückt ihre Stirn an Charlottes Schläfe, umfasst dabei ihre Oberarme, an der anderen Bettseite ihr Vater, Gustavs Kopf liebkosend.
Mein Vater schreibt: Wie geht’s Charlotte?
Mein Vater schreibt: Wie geht’s dir?
Mein Vater schreibt: Alles OK im Moment?
Ich schreibe: Wir sind okay, sind mit dem Kleinen auf dem Zimmer, er wird jetzt abgeholt.
Mein Vater schreibt: Ok. Mein tiefes Beileid.
Ich schreibe: Haben ihn den ganzen Tag auf dem Arm gehabt
Ich schreibe: Er ist so schön und perfekt
Ich schreibe: Kerngesund bis zu dieser Scheiße heute