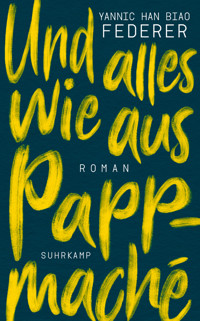19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über Herkunft und Zugehörigkeit, Liebe und Verlust
Dass Tobi eigentlich Tao heißt, wissen die wenigsten. Nur Miriam nennt ihn, wenn sie zu zweit sind, bei seinem chinesischen Namen. Als sie ihn verlässt, reist Tao mit dem Auto quer durch Europa, um der Trauer über die Trennung zu entkommen. Doch die Erinnerung an die gemeinsamen Jahre verfolgt ihn, und auch der Tod des Vaters lässt ihn nicht los: Vor Jahren verschwand der in Hongkong – auf der Suche nach dem Geburtsort des eigenen Vaters. Nun ist es Tao, der sich auf die Spuren seiner Vorfahren begibt und zu schreiben beginnt, um die eigene Geschichte zu ordnen und die seiner Familie, die von China über Indonesien bis nach Deutschland reicht.
Yannic Han Biao Federer erzählt von einer Spurensuche entlang biographischer Brüche und historischer Verwerfungen, in der deutschen Provinz wie im zerrissenen Hongkong von heute. Sein Roman Tao stellt die Frage, wie gemeinsame Erinnerung erzählt werden kann, wem sie gehört – und was sie verspricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Yannic Han Biao Federer
Tao
Roman
Suhrkamp
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Dank an Martina Wunderer,Tilman Strasser, Charlotte Loesch, Alexander Bartsch, Chris Parton.Und Dank an R.&S.Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert durch Kunststiftung NRW/Kunststiftung Baden-Württemberg sowie durch das Grenzgänger-Programm der Robert Bosch Stiftung und des Literarischen Colloquiums Berlin sowie durch ein LCB-Aufenthaltsstipendium.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung: Christopher Hartmann, Come so close (that I might see). Öl auf Leinwand, 60 x 45cm, 2020
eISBN 978-3-518-77225-6
www.suhrkamp.de
Tao
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
Informationen zum Buch
1
Als der Vater meines Vaters starb, sagte man ihm, sein Vater sitze nun hoch oben, auf der felsigen Kante des Mondes, sehe zu ihm herunter, wache über ihn, und wenn er einmal allein sei und verzweifelt, solle er nur warten, bis es dämmerte, bis der milchig leuchtende Stein über den Palmen und Stromleitungen stehe, dann könne er sicher sein, dass die väterlichen Augen auf ihm ruhten, erwartungsvoll. Ich stelle mir vor, wie mein Vater, ein Kind in weißer Trauerkleidung, aus dem Fenster sah, zum Nachthimmel, der zuverlässig wolkenlos blieb, zumindest in der Trockenzeit, ein Rest von Mond fast immer sichtbar. Aber hier ist es bewölkt. Es nieselt. Mir ist kalt. Ich bin betrunken. Der teure Wein, den ich vor Jahren geschenkt bekommen habe, den ich aufgehoben habe für eine besondere Gelegenheit – ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn einmal aus der Flasche trinken würde. Vor mir der Rhein eine schwarze Fläche, gleichgültig, unbeschienen, rechts und links Gestrüpp, hinter mir quietschen die Güterzüge, es riecht streng, vermutlich eine Kläranlage.
Unter der Nase des Hausverwalters ein gelber Halbkreis, dort, wo ihm die Zigaretten in den grauen Bart dampfen, seine Hand ist breit und kräftig und warm, er mustert mich neugierig. Na, dann kommen Sie mal hoch, sagt er, obwohl wir stehen bleiben müssen und ein Dutzend Mädchen passieren lassen, eine Frau und ihren Trolley, hinter ihm beschleunigen Autos, ein Lastwagen, die Müllabfuhr, endlich können wir vom äußeren Rand des Gehwegs zur Häuserfront, zwischen dm und Pizza-Döner-Center Kalk schließt der Hausverwalter eine Tür auf, daneben Klingelschilder und Briefkästen, in Plastik eingeschweißte Werbezeitungen lugen aus ihren Mäulern. Das Treppenhaus ist minzgrün gekachelt, die Treppenstufen auch, im ersten Geschoss ein Fenster, man blickt hinaus auf ein bekiestes Flachdach, dahinter ein Parkplatz. Da können Sie einkaufen, sagt der Mann, erst jetzt erkenne ich, dass es ein Aldi ist, der sich zur Parallelstraße hin öffnet. Im einzigen Raum der Wohnung riecht es nach Kunststoff, er ist nicht klein, aber auch nicht geräumig, viele Halogenleuchten in der niedrigen Decke, ein ehemaliges Büro, Linoleum in dunkler Parkettoptik, ich öffne ein Fenster, über dem Motorenlärm die gläserne Fassade eines alten Kaufhofs, dahinter Arbeiter, die Pressspanplatten und Gerät transportieren. Ist halb so wild, sagt der Verwalter und legt sein Klemmbrett ab. Wird nur entkernt, kommt ein Kaufland rein, da können Sie dann auch einkaufen. Ich nicke. Zur fensterlosen Küche ein Durchgang ohne Tür, ich betätige den Lichtschalter, aber nichts tut sich. Ach so, ja, sagt der Verwalter und reibt sich den Bauch. Der Strom ist weg, der Vormieter hat nicht gezahlt, na ja, die Küche können Sie übrigens haben, die geb ich Ihnen so, er zeigt auf Schränke, die einmal weiß waren, an der Wand lehnt die Dunstabzugshaube, ein Jägermeisterkühlschrank mit Glastür steht in der Ecke, am Herd fehlen Knöpfe, der Ofen hat keine Klappe, fassungslos und einäugig starrt er mich an.
Miriam versucht jetzt, möglichst selten in der Wohnung zu sein. Wenn ich nach Hause komme, liegen die Zimmer verlassen da, an einem hingeworfenen Küchenhandtuch, an einer neuen Schicht alter Wäsche im Wäschekorb, an ab- und zunehmenden Kühlschrankbeständen erkenne ich, dass sie da gewesen sein muss. Nachts höre ich manchmal die Wohnungstür, die knarrenden Dielen, die Toilettenspülung. Morgens ist sie dann schon wieder fort. Auf ihrem Schreibtisch zwischen losen Notizzetteln und geöffneten Briefen und Büchern eine laptopförmige Leerstelle, sie arbeitet in der Bibliothek, nehme ich an, obwohl sie das immer gehasst hat, die aufgekratzten Erstsemester, die flüsternd Probeklausuren diskutieren und glauben, es höre sie keiner, abseits die Pensionäre, die ihr Zeitungsabonnement nicht mehr zahlen wollen oder können und sich nun morgens bei den Zeitschriften um den Stadtanzeiger streiten oder um die Rundschau, die immer laut atmen und jede Seite geräuschvoll wenden und glattstreichen und wieder aufschütteln, die gealterten Langzeitpromovenden, die halbglatzig den Masterstudentinnen nachstellen.
Leer klingen die Räume unter meinen Schritten, dabei fehlt erst ein Regal. Am Ende schmerzen die Arme, die Kleider kleben mir am Leib, ich atme schwer, lehne am geöffneten Wagen, eine Zimmerlampe überragt Kartons, ihr Schirm steht schief. In Kalk bin ich zu müde, um noch auszuladen, ich nehme meinen Rucksack vom Beifahrersitz, öffne die Hecktür und ziehe Schlafsack und Isomatte zwischen Stuhlbeinen hervor, etwas kommt ins Rutschen und kracht gegen das Holz der Innenverkleidung. Meine Kleider in blauen Müllsäcken, ich bekomme ein T-Shirt und Boxershorts zu fassen, dann schließe ich den Wagen ab. Männer sitzen auf einer Mauer, sie trinken Schnaps und sehen mir zu, wie ich vor ihnen über den Aldiparkplatz laufe. In der Wohnung riecht es immer noch nach Kunststoff, dumpf fällt das Licht der Straßenlaternen in den Raum, ich öffne ein Fenster, höre den Stimmen auf der Straße zu, Amir, ruft einer, Amir, ruft er wieder, aber Amir will nicht hören, stoisch läuft er die Straße hinunter, an seinem Gang meine ich den Streit zu erkennen, dem er eben den Rücken gekehrt haben muss. Ich schaue auf mein Telefon, vier Anrufe in Abwesenheit, außerdem warten Nachrichten in verschiedenen Messengerdiensten, die ich nicht lesen möchte, vielleicht hat Miriam begonnen, es unseren Leuten zu sagen, und jetzt sind sie alle sehr besorgt, sie haben Angst, dass ich schon überm falschen Parkett baumele, ich schalte das Gerät aus, das Licht des Displays versiegt, der Raum wie geschwärzt, erst nach und nach gewöhnen sich die Augen wieder an das Halbdunkel, in dem die Wände enger wirken als am Tag. Ich rauche und frage mich, wann ich Strom haben werde. Amir, ruft es draußen wieder, diesmal eine Frauenstimme, ich sehe hinaus, Amir ist verschwunden.
Micha schreibt: Hey, ist alles okay?
Ich schreibe: Miriam hat sich von mir getrennt
Micha schreibt: Fuck
Micha schreibt: Tobi, das tut mir sehr leid
Micha schreibt: Wenn du jemanden zum Reden brauchst, ruf mich an
Ich schreibe: Sitze gerade im Bus. Idee für Bandname: The Crying in Public. Erstes Album: Trying not to
Micha schreibt: Haha
Es regnet, im Zug sehe ich aus dem Fenster, betrachte Wolken, die tief über dem Boden treiben, kleine Finger zur Landschaft strecken, wie um sich festzuhalten, darunter bunte Regenjacken mit vorgespanntem Hund, manchmal ein einsames Auto, das sich durch die Dämmerung tastet. Im Sitz vor mir steckt eine Zeitschrift, auf der Rückseite die Anzeige einer Hotelkette, Pool und Pavillons zwischen Bambus und Bananenstauden, blumengeschmückte Steinskulpturen, ein seltsam gewundener Stamm, riesige Blätter, Lianen, darüber eine stilisierte Schreibschrift: Endless Exploitation, ich wundere mich, aber ich habe mich verlesen, eigentlich steht dort: Endless Exploration. Hinter Mannheim hebt sich ein Gebirge aus der Erde.
Wandern im Schwarzwald. Mutter und Onkel Winfried unterhalten sich, sie reden von Krankheiten und Tod. Onkel Winfried hat das Hemd offen und viel Gewicht verloren, hager und bleich stapft er durchs Gras. Das graue Haar fällt ihm auf die Schultern, er isst vom Wegesrand, Brennnesselsamen und Brombeeren und winzige Walderdbeeren, nur an die Pilze traut er sich nicht. Von oben sehen wir hinunter, überblicken die Täler. Dort ist der Opa gestorben, sagt Mutter irgendwann, zeigt auf einen Hang, den Krater kann man heute nicht mehr sehen. Zugewuchert, sagt Onkel Winfried noch, dann geht er weiter, pflückt etwas aus einem Baum.
Micha schickt mir einen neuen Text, ich lese ihn auf dem Handy. Es geht um einen, der Tomi heißt und Autor werden will, er ist Halbchinese, aber die meisten sehen ihm das nicht an, und manchmal vergisst er es auch selbst. Ich schreibe Micha: Also dieser Tomi bin schon ich, oder? Micha schreibt: Nee. Micha schreibt: Okay, vielleicht ein bisschen. Micha schreibt, aber keine Nachricht kommt, nur das Pulsieren der grauen Punkte, sie scheinen auf, verschwinden wieder, scheinen wieder auf, ich schalte das Display aus, trete hinaus auf den Balkon, es ist noch kühl, hinter den Bergen tagt es, zaghafte Konturen in der Ebene, da vibriert es wieder. Bist du jetzt böse?
Ich höre, wie Mutter hinter mir aus dem Schlafzimmer tritt und stehen bleibt, dann die Badezimmertür, dann Musik. Ich ziehe Schuhe an und gehe hinaus, in der schmalen Straße zur Innenstadt haben der Spielwarenladen und das Sportgeschäft noch nicht geöffnet, es brennt Licht, Angestellte gehen darin umher, die Auslagen, die sonst den Gehweg säumen, verbarrikadieren von innen die Eingänge. Im türkischen Imbiss dreht sich schon der Dönerspieß, es ist niemand zu sehen, und dort, wo sonst geschnetzelter Salat und Kraut und Tomaten und Gurken liegen, nur leere Halterungen für die Gastrobehälter aus Edelstahl. Unter der Kirche eine Kaisers-Backstube, ich kaufe zwei Seelen, eine Laugenstange, ein Dinkel. Auf dem Rückweg beobachte ich Kurgäste, man erkennt sie an den Krücken, an großflächigen Pflastern im Gesicht oder an Angehörigen, die sie am Ellenbogen über die Straße führen. Dann sitze ich Mutter gegenüber, sie sagt, ich sollte wegfahren, Urlaub machen, ich nicke, stelle den Kaffee neben meinen Teller. Irgendwohin, um den Kopf freizukriegen. Ja, sage ich und schneide meine Seele in zwei Hälften. In die Sonne. Ans Meer. Hm, mache ich und drücke Käse hinein. Zwei Wochen oder drei. Mal sehen, antworte ich und beiße ins Brot. Südfrankreich, sagt sie. Ich kaue, versuche zu schlucken.
Als ich Miriam das erste Mal in Marseille besuchte, haben sie mich aus dem Wagen gezogen. Nur einmal schlugen sie mir ins Gesicht, vermutlich wussten sie, dass das genügte, und es war auch gar nicht so schlimm, mein alter Mazda wäre nie durch den TÜV gekommen, und das meiste Bargeld hatte ich unterwegs für Benzin ausgegeben. Es tat mir nur leid um den Discman, der über eine Adapterkassette an der Stereoanlage hing, es tat mir leid um die CD-Spindel im Handschuhfach, in der ich meine größtenteils gebrannte Musiksammlung transportierte, es tat mir leid um die schöne Schwab-Ausgabe, die ich kurz zuvor auf dem Flohmarkt im Stühlinger erstanden hatte, es tat mir leid um die Adidas-Trainingsjacke, sie war orange, und ich trug sie häufig, obwohl sie schon sehr alt war. Es tat mir außerdem leid um die T-Shirts und Unterhosen und Jeans, die ich jetzt neu kaufen musste, und um den Koffer, den ich von meiner Mutter geliehen hatte. Um den Roman von Junot Díaz, den ich für Miriam besorgt hatte, ein schöner Paperbackband, ich hatte ihn gelesen, ohne ihn mehr als nötig zu öffnen, er sah aus wie neu. Oh nein, sagte Miriam, sie stand in der Tür, musste mein Gesicht anfassen, wie um zu prüfen, dass nichts lose war, es tat weh, als ihre Finger direkt über die Schwellung fuhren. Sie begutachtete mich eindringlich, obwohl ich immer wieder sagte, ich sei okay, endlich ließ sie mich in die Wohnung. Es roch nach ihrem Ratatouille, das ich sehr mochte, Weingläser standen auf dem Küchentisch, sie setzte mich auf einen Stuhl, gab Eis in ein Geschirrtuch, das schnurlose Telefon zwischen Schulter und Ohr geklemmt. Erst als die Beamten wieder gegangen waren, konnte ich sie zu mir ziehen und sie fragen, ob sie mir nun endlich einen Kuss geben würde, sie sagte: Tao, chéri.
Zum Abschied will Mutter mir noch etwas sagen, weißt du, setzt sie an, aber dann donnert ein Güterzug in den Bahnhof, dicht vor uns die Container und Kesselwagen, wir wenden uns ab, weil der Fahrtwind in unsere Gesichter peitscht, endlich ist es vorbei, weißt du, fängt sie wieder an, aber jetzt wird die Regionalbahn angesagt, der Lautsprecher scheppert grell und laut, am Ende kann sie nur noch winken, während ich meinen Koffer in den Zug hieve, die Tür fiept schon, als ich mich nach ihr umdrehe, der Wagon rollt an, weg bin ich.
Am Montag sitze ich im Büro, und ein Gasthörer schreit mich an. Ich warte, bis er fertig ist, dann fülle ich wieder Formulare aus. Er kommt noch einmal zurück, steht unsicher im Raum, entdeckt endlich seinen Jutebeutel auf dem Schreibtisch meiner Kollegin, wo er ihn erregt und gedankenlos abgelegt hatte, hastig greift er nach ihm, schaut sogar hinein, als wollte er prüfen, dass ich nichts entwendet oder hinzugetan habe, aus dem Augenwinkel beobachte ich, wie er endlich seinen dummen Beutel sinken lässt, noch immer zitternd, ich setze einen Stempel unter meine Unterschrift und blase die Tinte trocken, lege das Dokument auf die Glasfläche des Kopierers und schalte das Gerät ein, es rauscht, als ich aufsehe, ist der Gasthörer aus der Tür geschlichen.
Miriams Vater starb, als sie dreiundzwanzig war, ich vierundzwanzig, blass wie ein Blatt Papier saß sie im tiefen Ledersessel, ich auf dem schmalen Bett, bemüht, mich nicht zu rühren, um den metallenen Rost nicht quietschen zu lassen, zwei Mal hatte ich versucht, mich ihr zu nähern, zwei Mal hatte sie nur die Hand gehoben, wie um mich abzuwehren. Es war eiskalt im Zimmer, obwohl wir eine Decke in die breiten Fugen der Balkontür gestopft hatten, obwohl draußen wieder die Sonne schien, durch das schmutzige Glas drang ihr Licht herein, legte sich auf die schönen, alten Fliesen, auf den übergroßen Kleiderschrank, auf die Rigipswand, die den riesigen Salon teilte. Von der Straße her die Rufe der Obstverkäufer, das Knattern der Motorroller, und erst als Laurence, die Mitbewohnerin, nebenan mit ihrer Mutter zu telefonieren begann, es ging um ihren Twingo, der liegengeblieben war, putain de voiture, erst da begann Miriam, sich mit dem Handrücken über das Gesicht zu fahren, lautlos. Später schickte sie mich Wein kaufen oder Schnaps, im Spar irrte ich lange durch die Gänge, starrte lange auf das Regal mit den Spirituosen, konnte endlich eine Flasche Pernod herausgreifen, ich kam zurück, und Miriam hatte schon ihre Tasche gepackt und ein Taxi gerufen, ratlos stand ich in der Tür, sie gab mir die Schlüssel. Ich wollte etwas sagen, aber sie legte ihre Hand auf meine Brust, gab mir einen Kuss auf die Wange. Als ich ihre SMS las, war ich ziemlich betrunken, der Pernod halbleer, es tue ihr leid, sie müsse jetzt, sie könne jetzt nicht, sie melde sich, und dann: Bis bald, Tobi, Kuss, M.
Ist doch voll okay, sagt Micha und dreht sich um die eigene Achse. Ich folge seinem Blick. Graue Bettwäsche, das Bettgestell sehr schlicht und aus hellem Holz. Der alte Schreibtisch am Fenster, darauf Kabelgewirr, Speicherkarten, die Kamera, mein Notizbuch mit dem Gekritzel der vergangenen Tage, ein Laptop. Das Bücherregal noch in Einzelteilen, die Umzugskartons zu schmalen Wällen aufgetürmt, Staubsauger, Stehlampe, schiefer Schirm. Voll okay, sagt Micha noch einmal, zieht Bierflaschen aus seinem Rucksack und reicht mir eine, sie ist kalt und vermutlich vom Kiosk neben dem O2-Shop an der Ecke. Er nickt und versucht ein Lächeln, wir rauchen aus dem Fenster. Irgendwann muss ich dann doch erzählen, und Micha hat mich noch nie umarmt, er ist ziemlich dick und sehr weich, und ich dachte immer, wenn Micha mich einmal umarmen würde, wäre mir das vielleicht unangenehm, aber es ist überhaupt nicht unangenehm, es fühlt sich schön an, und er drückt mich fest an sich, bis ich mich beruhigt habe. Guck mal, sagt er irgendwann und zeigt auf den alten Kaufhof, dort steht noch ein Mannequin. Im obersten Stockwerk, zwischen Pressspanplatten und Kabelrollen, eine Silhouette im Halbdunkel. Als es hell wird, erkennen wir das waldgrüne Oberteil, untenrum ist die Puppe nackt, zurückgelassen steht sie da, blickt auf den verwüsteten Gang, an dessen Ende die Aufzüge nicht mehr fahren.
Laurence schenkte mir drei alte T-Shirts und Unterhosen, die eigentlich ihrem Exfreund gehörten, auf dem Marché du Prado erstand ich zwei billige Jeans und CD-Rohlinge. Miriam brannte mir alle Musik, die sie besaß, während das Laufwerk blinkte, schliefen wir miteinander oder gingen in den Park, hörten Portishead oder Charlotte Gainsbourg, manchmal musste sie in die Uni, dann las ich in ihren Büchern oder lief zum Spar am Ende der Straße und kaufte ein. Von Marseille sah ich nicht viel. Marseille war mir egal. Bei Saint-Charles bot mir ein Straßenhändler einen Discman von Panasonic an, es war das Modell, das ich besessen hatte. Laurence meinte später, es sei vielleicht tatsächlich meiner, nachts, als Miriam schlief, schaltete ich ihre Schreibtischlampe ein und untersuchte das Gerät, besah mir die Gebrauchsspuren, die kleinen Kratzer und Dellen in der Plastikverschalung, Laurence konnte recht haben, dachte ich.
Ich nehme Urlaub und einen Mietwagen, und bei 180 beginnt das Lenkrad zu schlackern, der Wind drückt den mickrigen Corsa mal nach links, mal nach rechts, als suchte er Schutz in den Leitplanken. Ein roter Porsche mit grellen LEDs lässt mich passieren, damit kein Unglück geschieht, es geht nicht anders. Ich überhole schwarze Limousinen, gucke dabei hinüber, sehe sie mir an, die gestärkten Hemdkragen, die weißen Blusen, manchmal schauen sie zurück, leere Gesichter, ich kann ihre Blicke nicht deuten.
Einmal Platzregen, tiefe Pfützen auf der Fahrbahn, die Lenkung wie Wachs, der Corsa reagiert nicht mehr, schlittert träge vor sich hin, bis endlich das Profil wieder greift, ruckartig steuert der Wagen zurück in die Spur, und erst, als es längst vorbei ist, erst, als ich drei Mal in den Rückspiegel gesehen habe, die Wagen hinter mir in unveränderter Reihung, erst da bekomme ich Angst vor dem Unfall, der nicht geschehen ist.
In Cuxhaven gibt es einen Anleger, der Alte Liebe heißt. Er ist sicher morsch und riecht. Überall Fischrestaurants, ich esse bei Burger King, dann irre ich umher, bis ich das Hotel finde, als ich eingecheckt habe, ist es dunkel. Hinter dem Deich das Meer ein schwarzer Strich, darauf hell erleuchtete Kreuzfahrtschiffe. Die Strandkörbe sind versperrt, Bretter vor den Sitzflächen wie vorgeschobene Unterlippen, sie stehen verstreut, aber niemals allein, kleine Rudel eingeschnappten Strandmobiliars. Ich gehe hinunter, und da, wo das Schwarz beginnt, wo ich das Wasser vermute, rührt sich nichts, Ebbe, überlege ich, aber es ist mir unheimlich, und ich gehe nicht näher, als könnte das Schwarz aus seinem Bett steigen und mich hineinziehen und keiner wüsste, was geschehen ist. Sie fänden das Mietauto auf dem Hotelparkplatz, meinen eilig bekritzelten Meldeschein an der Rezeption, vielleicht würde sich der Kassierer von Burger King an mich erinnern, vielleicht auch nicht. Der Wind pfeift in meine Flasche, ich versuche, sie ihm zu entwenden, aber immer findet er einen neuen Winkel, aus dem er mir dunkle Töne ins Bier geben kann.
Tao nannte Miriam mich nur, wenn wir allein waren und nackt oder kurz vor Küssen, die nicht beiläufig waren, sondern bedeutsam und ernst, sonst sagte sie Tobi, wie alle anderen auch, die wenigsten wissen, dass ich eigentlich Tao heiße. Auf der Hochzeit ihrer Schwester Alice saßen wir zwischen Cousins und Cousinen, deren Namen ich schon wieder vergessen hatte, als sich eine betrunkene Wienerin neben uns in den Stuhl fallen ließ, eine Patentanwältin, mit der Miriams Schwester einmal gearbeitet hatte, aber das erfuhren wir erst später, sie hing schlaff im Stuhl, dann klappte sie sich nach vorn und sah mir eine Weile schweigend ins Gesicht. Wo kommst du her?, fragte sie. Aus Köln, sagte ich. Naa, sie machte eine wegwerfende Geste, wo kommst du eigentlich her? Ach so. Freiburg. Noch immer der eindringliche Blick. Und deine Eltern? Auch, sagte ich. Ah geh, rief sie ärgerlich, streckte sich halb auf dem Tisch aus, nahm einen Schluck aus ihrem Weinglas, weißt du, sagte sie, ich hab einen echt guten Freund, den Tam, und der Tam ist aus Vietnam, und das ist doch interessant, ich interessier mich da halt total für, und deswegen frag ich, weil das doch spannend ist, wo die Leute herkommen. Aha, antwortete ich, ja, Vietnam ist bestimmt interessant, aber kenn ich mich jetzt auch nicht aus, die Betrunkene setzte nach, sag schon, Mutter oder Vater? Weil ganz bist du ja nicht was anderes, nur halb, oder? Miriam stand jetzt neben mir, sie war aufgesprungen, ihr Stuhl hatte gescheppert. Komm, sagte sie. Komm. Wir gingen zum Buffet und aßen Fingerfood, mein Freund, der Tam, äffte Miriam und schnitt eine Grimasse, ich musste lachen und spuckte ihr versehentlich ein Stück Käse ins Glas.
Abseits buddelt ein Tier im Schlick, findet etwas, beißt hinein, erbricht sich, buddelt weiter.
Ich sammle Schmutzwäsche vom Teppichboden, verstaue sie in einer Plastiktüte von Lidl, öffne den Koffer, das Handy vibriert. Micha schreibt: Hey Tobi, sitze im Café und arbeite meinen Text um. Tomi heißt jetzt Yán und entscheidet sich im Laufe der Story gegen eine literarische Karriere, er bleibt an der Uni und promoviert über Apokalypse und Carl Schmitt. Also, die Figur hat schon gewisse Züge von dir, aber mehr nicht. Ich schreibe: Okay. Mit einem Knie auf dem Kofferdeckel zerre ich am Reißverschluss.
Wenn ich Miriam leckte und sie kam, wenn sie dabei nur zur Zimmerdecke blickte, immer nur nach oben, als bezöge sie alles von dort, ihre Bauchmuskeln spannten sich, ihr Atem flachte ab zu kurzen Stößen – ich kam mir allein vor zwischen ihren Beinen.
Auf Rügen ist es anders, tiefes Blau, von Grün umwaldet, Segelboote, auf der Straße zuckeln die Wohnwagen, fast ist es warm, irgendwo brennt's, und oben auf den Kreidefelsen mein Hotel, es ist alt, die Teppichböden ausgetreten, und aus dem Schrank wurde die Minibar herausgerissen. Sonst sehr sauber, von der Terrasse ein Blick hinab in die Weite, ein Offshorepark und Schiffe, ein Leuchtturm, eine Steilküste, unter der Abbruchkante Geröll.
Hat es Miriam und mich enger zusammengebracht, dass unser beider Väter tot waren? Oder hat es uns eher getrennt? Als wären tote Väter eine ansteckende Krankheit. Vielleicht gab sie mir die Schuld, insgeheim. Wissend, dass das Unsinn war. Aber nicht jeden Unsinn kann man sich wirklich vom Leib halten. Und immer die Trauer, in die sie sich zurückzog.
Am Strand beobachte ich eine Frau, roter Bademantel, Dauerwelle, Handtuch in der Linken. Regungslos steht sie da und guckt hinaus, als rührte sich dort etwas, aber dort rührt sich nichts, die Ostsee liegt da wie tot. Erst nach einer Weile erkenne ich einen haarlosen Kopf, daneben Arme, die sich aus dem Wasser heben und wieder eintauchen, irgendwann watet der Mann an Land, er ist nackt, guckt zu mir, guckt zur Frau, sie reicht ihm sein Handtuch, er trocknet sich ab.
Mit Miriam am Lago di Bolsena, unser Zelt einsam auf der Wiese, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, ich glaube, es war unser erster gemeinsamer Urlaub. Nachts wachte ich auf, die Isomatte neben mir leer, das Moskitonetz heruntergezogen auf dem Zeltboden, also stand ich auf, ging hinaus. Miriam in der Dunkelheit, verstört, sie sagte, sie habe etwas gehört, etwas sei ins Wasser gefallen, oder jemand. Ich schaute hinaus auf den See, den ich kaum ausmachen konnte, der Himmel hob sich nur wenig heller von ihm ab. Ich sah nichts, hörte nichts außer dem leisen Rauschen der Schnellstraße, das von der anderen Seite zu uns herüberwehte, schließlich sagte ich, das war sicher ein Tier, ein Vogel, vielleicht sogar ein Fisch, ein heftiger Flossenschlag, wer weiß, und Miriam wollte mir nicht glauben, aber glaubte mir dann doch, als ich meinte, oder du hast nur geträumt. Ich führte sie zurück ins Zelt, schloss das Moskitonetz hinter uns und zog sie zu mir, es dauerte, bis wir wieder einschliefen. Am nächsten Morgen Rufe, ein Mann in Badeschlappen, ein Mädchen barfuß, etwas zurückgefallen eine Frau in kurzer Hose und bauchfreiem Top, wir hatten sie zuvor noch nicht gesehen, sie mussten einen der Bungalows gemietet haben, die am anderen Ende des Geländes in der Nähe der Duschen lagen, ich kochte Kaffee auf dem Gaskocher, und Miriam stieg aus dem See, wischte sich Wasser von den Augen. Paula, riefen sie, Pau-la! Der Vater klang heiser, bellte fast, das Mädchen dagegen in einem leiernden Singsang, Pau-la!, die Mutter blieb stumm, erst als sie bei uns ankam, hörten wir ihre Stimme, sie fragte, ob wir ihren Hund gesehen hätten, Paula, etwa so groß, sie zeigte auf ihr rechtes Knie, am linken ein blauer Fleck, das Tier habe weißes Fell, ein Terrier, ich schüttelte den Kopf. Die Frau sah auf die Caffettiera, in der es zu blubbern begonnen hatte, und ich machte mich am Gaskocher zu schaffen, dann gingen sie weiter, ich reichte Miriam eine Tasse, aber sie ließ die Arme hängen, sah mich an, da erst begriff ich.
Micha schreibt. Der WDR hat sein Hörspiel produziert. Ich öffne den Link zur Datei, den er mir schickt. Yán kommt mir etwas weinerlich vor, überlege ich, und der Sprecher affektiert. Ich schreibe: Yán kommt mir etwas weinerlich vor. Haha. Micha schreibt: Haha ja.
Miriams Vater habe ich zwei Mal gesehen. Das zweite Mal lag sein Gesicht schon blass und wächsern im Dämmerlicht, das durch die Kirchenfenster drang. Nach dem Gottesdienst trafen wir auf Miriams Halbgeschwister, die ich noch nicht kannte, der Halbbruder hieß Max und war nur wenig jünger als Miriam, er trug Ohrstecker und sah Ronaldo auch sonst sehr ähnlich, die Halbschwester hieß Jennifer, sie war vielleicht vierzehn oder fünfzehn und hatte schlechte Zähne. Abseits Miriams Mutter, den linken Arm hatte sie sich um den Bauch gelegt, den rechten Ellenbogen auf die linke Hand gestützt, sie rauchte, sah zu, wie Alice, Miriam und ich nacheinander Max und Jennifer die Hand reichten, sie beguckte sich die Szene, fast neugierig, und ich frage mich manchmal, was sie dachte, ob es ihr schlüssig erschien, dass die Halbgeschwister jetzt beieinander standen, etwas ungelenk und unsicher zwar, aber doch gemeinsam trauernd um ihren treulosen Erzeuger, der nun unter die Erde kam.
Über Wrocław und Wien nach Zagreb, in der Hotellobby steht ein Pianola, ein schöner Flügel, es spielt Debussy, nur für mich und den Rezeptionisten, der mit meiner Kreditkarte hantiert, das Lesegerät streikt. Ich setze mich auf den Hocker, lege meine Finger auf die weißen und schwarzen Tasten, die sich unter ihnen ins Gehäuse zurückziehen und wieder herausspringen, auf und ab, eine Gruppe Chinesen kommt herein, jetzt beginne ich, meine Hände dem Spiel des Pianola folgen zu lassen, ich wiege sogar meinen Oberkörper, sehe einmal versonnen zur Decke, sie verstummen, sehen zu mir, der Älteste von ihnen beginnt zu filmen. Als sie im Aufzug verschwunden sind, grinst mich der Rezeptionist an, er trägt eine feste Zahnspange. Oben werfe ich mich aufs Bett, schalte den Fernseher ein, Kommissar Rex in kroatischer Synchronfassung, der Hund springt durch eine Fensterscheibe, Geschrei, eine Waffe feuert, Richard Moser eilt die Treppe hinauf, es ist spannend, obwohl ich die Dialoge nicht verstehe, manchmal ist mir, als könnte ich Tobias Morettis Lippen lesen und die der Nebendarsteller, trotz der weich geschliffenen kroatischen Stimmen, die sich beständig über die Bilder legen. Nachts wache ich auf, ungewaschen, verwirrt, nackte Frauen räkeln sich auf einer Wiese, schlaftrunken wanke ich ins Bad.