
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine Lovestory wie ein Lieblingslied: Bittersüß komponiert aus Liebe, Herzschmerz und wunderschönen Tönen voller Poesie! Obwohl Anna James das Saxofonspielen erst spät für sich entdeckt hat, träumt sie davon, Musikerin zu werden. Als sie in der Marchingband ihrer Schule mit Weston Ryan für ein Duett eingeteilt wird, ist ihr klar, dass sie von dem erfahrenen Mellophon-Spieler viel lernen kann – und möchte. Dabei stellt sie schnell fest, dass Weston, dem jeder aus der Kleinstadt einen Bad-Boy-Stempel aufdrücken will, einfach nur in seinem eigenen Takt marschiert. Ungeachtet der Vorbehalte von Annas Eltern, stürzen sich die beiden in eine intensive Hals-über-Kopf-Liebesgeschichte. Zwischen Bandproben, Gute-Nacht-Nachrichten und heimlichen Treffen werden Anna und Weston zu einer perfekten Komposition. Doch was passiert, wenn plötzlich eine Hälfte des Duetts fehlt. Von der Autorin des großen Community-Lieblings Amelia. Alle Seiten des Lebens : eine mitreißende Hals-über-Kopf-Jugendliebe aus zwei Perspektiven mit magisch schönen Worten zum Highlighten und Festhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ashley Schumacher
Für immer unter dem gleichen Himmel
Roman
Aus dem Englischen von Barbara König
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Full Flight bei Wednesday Books, ein Imprint der St. Martin’s Publishing Group, Macmillan.
Deutsche Erstausgabe
© der deutschsprachigen Ausgabe: Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich, 2023
Alle Rechte vorbehalten
© Ashley Schumacher, 2022
First published by Wednesday Books.
Translation rights arranged by The Sandra Dijkstra Literary Agency.
All Rights Reserved.
© Übersetzung: Barbara König
Lektorat: Leona Eßer
© Cover: Niklas Schütte unter Verwendung eines Motivs von Beatriz Naranjalidad
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03880-077-4
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
Für meinen Michael, für alles.
Und für Chris, denn das Leben ist da, um gelebt zu werden.
Danke, dass du mit mir die Sterne vom Himmel geholt hast.
Eins
Weston
Gerade übe ich ein neues Stück auf dem Klavier ein, da tritt sie auf. So fühlt sie sich an: wie ein eigener Auftritt. In einem Moment schwimme ich in einem Meer von Noten, im nächsten schwingt die Tür zum Musikraum auf, prallt mit einem dumpfen Knall gegen den Stopper, und da ist sie; ihr Saxophon baumelt an dem Gurt um ihren Hals.
Die letzte Note, die ich gespielt habe, verklingt, wartet auf den nachfolgenden Lauf, als Anna James um die Bank herumgeht, mich mit ihren braunen Augen flehentlich anschaut und die Wörter wie eine Sturzflut aus ihr hervorbrechen.
»Hör zu«, sagt sie, »ich will ganz offen und ehrlich sein, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Wenn ich das hier vermassele, dann ist das buchstäblich das Ende der Welt. Meine Eltern werden traurig sein. Die Band wird traurig sein. Ich werde traurig sein. Versprich mir einfach«, sagt sie ganz ernst, »dass du, egal was Mr Brant auch sagt, einfach zustimmst.«
Sie mag vielleicht ein eigener Auftritt sein, ein Wirbelsturm auf zwei Beinen, aber das sieht man ihr nicht an. Braune Haare, braune Augen, helle Haut, ein Shirt, das so aussieht, als könnte es sich nicht entscheiden, ob es ihre Kurven betonen oder verbergen soll und …
Weihnachtssocken? Am ersten Schultag. Im August. Sie gucken unter ihrer Jeans hervor, ausgeblichene gelbe Bommeln auf geschmückten Tannen.
»Weißt du überhaupt, wer ich bin?«, frage ich und starre die Socken an. Es ist eine Anschuldigung, eine Fangfrage. An einem Ort von der Größe Enfields kennt auf den Fluren der Highschool jeder jeden. Meistens ist dir die liebe Verwandtschaft deiner Mitschülerinnen und Mitschüler genauso vertraut wie deine eigene; dieselben Großeltern, Eltern, Tanten und Onkel erscheinen seit Kindertagen bei all unseren unfreiwilligen Konzert- und Theateraufführungen.
Enfield gehört zu diesen absurd kleinen Orten mitten in Texas, wo alle vorgeben, christlich zu sein und an jeder Straßenecke eine Kirche steht.
Nur dass die größte Kathedrale von allen das Footballfeld mitten im Zentrum ist. Von August bis Dezember versammelt man sich dort, um alles rund um das Spektakel anzubeten: das Schweinsleder, die Zuschauertribüne, die in Käsesoße erstarrten Nachos vom Imbissstand, an dem man nur bar bezahlen kann.
Also kennt sie mich, wahrscheinlich sogar meinen vollständigen Namen und meinen Notendurchschnitt. Sie hat ganz bestimmt von dem »Skandal« gehört, von der Scheidung meiner Eltern und auch die »schockierende« Neuigkeit mitbekommen, dass ich deswegen nach Bloom abgehauen bin.
Und ich kenne sie auch ein bisschen. Ich weiß, dass sie dieses Schuljahr mangels Alternative Registerführerin bei den Saxophonen ist. Ich weiß, dass sie nicht wie alle anderen in der fünften Klasse der Band beigetreten ist, sondern erst in der neunten – als ich in der zehnten war –, bevor ich nach Bloom gezogen bin. Ich weiß, dass ihre Eltern noch verheiratet sind, wie die meisten anderen in Enfield auch. Ich glaube, sie hat eine kleine Schwester.
Aber das bedeutet gar nichts.
Diese Art von Wissen.
Vor zwei Wochen waren wir noch zusammen auf dem Band-Wochenende, um Himmels willen, und sie hat nicht ein einziges Mal mit mir gesprochen. Nicht, dass sie damit die Ausnahme war: Bis auf Ratio und ab und zu Jonathan – wenn ihm plötzlich einfiel, dass wir ja befreundet sind – hat praktisch keiner mit mir geredet, außer um aufdringlich nachzufragen, warum ich denn nach Bloom gezogen bin und warum ich denn wieder hier bin. Als wüssten sie das nicht. Als würden sie in ihrer heilen, perfekten Welt nur darauf warten, dass ich das Wort Scheidung laut ausspreche. Aber es stand keiner von ihnen viel zu nah neben mir im Musikraum. So wie Anna James jetzt.
Sie sieht mich an, den Kopf zur Seite geneigt, während sie einen hämmernden Rhythmus auf die Klappen ihres Saxophons drückt – ein seltsamer Trommelwirbel von Kunststoff auf Metall. Sie schweigt, und ich fühle mich benommen und leer. Fürchte mich vor dem, was sie gleich sagen wird. Ach, schon gut. Ich habe dich mit jemandem verwechselt. Oder noch schlimmer: Klar, weiß ich, wer du bist. Du bist dieser Freak mit der schwarzen Lederjacke.
Das sagt sie aber nicht.
Als sie spricht, ist es fast ein Flüstern, und ich bekomme eine Gänsehaut.
»Ich weiß, wer du bist, Weston Ryan.«
Es ist lächerlich, denn fast nehme ich ihr das ab. Dass sie mich kennt und nicht die Version, die Eltern wie Lehrer seit Jahren hinter vorgehaltener Hand flüsternd von mir erschaffen. Sie sagen, ich sei »begabt, aber seltsam«, »musikalisch, jedoch nicht in der Lage sich anzupassen«. Fast könnte ich sogar so tun, als ob meine zwei besten und einzigen Freunde mich nicht schon immer als ihr soziales Mitleidsprojekt betrachten würden.
Plötzlich frage ich mich, ob Anna das Gerücht mitbekommen hat, das nach einem Jahr noch immer die Runde macht, nämlich dass ich derjenige war, der die Axt in dieses dämliche Gedenkbaum-Denkmal gehackt hat. Bestimmt hat sie das. Man konnte von dem Vorfall sogar auf der Titelseite des Enfielder Wochenblattes lesen: »Baum der Hoffnung umgehauen«. Die örtliche Polizei suche nach dem Täter, stand in dem Artikel. Wörter wie heimtückisch, rachgierig und bösartig waren da zu lesen, Wörter, die das Wochenblatt nicht verwendet hat, seit der neunzigjährige Mr Summer sich am vergangenen Thanksgiving geweigert hat, beim Basketballspiel Schüler gegen Lehrer mitzumachen.
Das Bäumchen, das von den Schülerinnen und Schülern auch liebevoll als Gedenkbaum-Denkmal bezeichnet wird, wurde erst vor einem Monat vom Schulparlament gepflanzt, nachdem der ursprüngliche Gedenkbaum im vergangenen Frühjahr vom Blitz getroffen wurde. Die Schüler*innen hatten das ganze Jahr über Kuchenbasare veranstaltet, um Geld für den neuen Baum und die Entfernung des Baumstumpfes zu sammeln, nicht ahnend, dass ihre ganze harte Arbeit in einer Tragödie enden würde. Der ursprüngliche Gedenkbaum hatte eine reiche Geschichte und beherrschte den Mittelpunkt des Schülerparkplatzes seit den Tagen, als dort noch Pferde angebunden wurden; dieses Gedenkbaum-Denkmal hat nicht einmal einen Monat dort gestanden.
Ich habe diesen verdammten Baum nicht einmal angefasst. Das denken nur alle, weil irgendjemand mitbekommen hat, wie ich zu Ratio gesagt habe, »den wären wir los«. Aber damit das klar ist: Das habe ich nur gesagt, weil dieser Ersatz-Baum so aussah, als würde er nicht einmal den milden texanischen Winter überleben. Ihn als Zweig zu bezeichnen, wäre schon zu hoch gegriffen. Bestimmt ist er eingeschrumpelt und vor lauter Scham buchstäblich im Boden versunken. Wie auch immer. Dass ich danach umgezogen bin, hat die Gerüchteküche jedenfalls erst recht angeheizt.
Doch Anna sieht mich nicht so an, als würde sie mich für einen Baum-Mörder halten, der das Weite gesucht hat, nachdem er wichtige Vegetation vernichtet hat. Wenn Anna mich ansieht, dann kann ich fast, fast, fast glauben, dass sie das alles durchschaut – das Geflüster, die Baum-Vorwürfe, alles.
Wir werden unterbrochen, weil die Tür aufgeht, viel sanfter als eben und der Direktor unserer Marching Band hereinkommt. Der winzige Raum ist nun übervoll – das Klavier, mein Mellophon-Koffer, mein Rucksack, Anna und ihr Saxophon und Mr Brant.
»Weston Ryan«, begrüßt er mich. »Ich bin überrascht, dich hier nach Schulschluss zu finden.«
Mit einer vagen Geste zeige ich auf die Noten auf dem Klavier. »Ich wollte ein wenig üben, Sir.«
Ich wollte nicht in das leere Haus meiner Mutter, Sir.
Mr Brant nickt, sein Blick huscht zwischen uns hin und her. »Gut. Anna hat mir erzählt, dass du ihr mit dem Duett helfen wirst, das ihr gemeinsam aufführen werdet. Ist das richtig?«
Anna stellt sich schnell neben Mr Brant, und ich weiß nicht so recht, ob es jetzt schwerer oder leichter ist zu atmen, nun, da ein angemessener Abstand zwischen uns liegt. Ihre Augen flehen mich an, während sie mir gleichzeitig einen vielsagenden Blick zuwirft und ihr Saxophon im Würgegriff hält. Und die Art, wie sie mich ansieht – als wäre ich die Antwort auf all ihre Fragen – verändert etwas in mir. Ob diese Veränderung etwas Gutes oder Schlechtes ist – um das zu entscheiden, bleibt mir keine Zeit.
»Natürlich.« Das Wort verlässt meinen Mund, ohne dass mein Gehirn mitbekommt, auf was ich mich da einlasse.
Wenn ich bisher dachte, dass Anna glänzende Augen hat, dann nur, weil ich nicht wusste, wie sie aussehen können, wenn sie mich anlächelt. Strahlend. Als würde man zufällig über die ersten Glühwürmchen des Sommers stolpern.
Fast will ich zurücklächeln.
»Wunderbar. Ausgezeichnet«, sagt Mr Brant gerade. »Dann nichts wie ran. Und zwar schnell, verstanden? Sonst muss Ryland Annas Teil übernehmen. Und der braucht auch Zeit, um ihn bis zum Regionalwettbewerb einzuüben.«
»Ja, Sir«, sagt Anna und versucht meinen Blick einzufangen.
»Okay«, sage ich.
Mr Brant hebt eine Augenbraue.
»Ich weiß ja nicht, was die guten Leute von Bloom dir haben durchgehen lassen, Mr Ryan, aber niemand aus der Enfield Bearcat Marching Band spricht so mit mir in diesem Ton.«
Bloom. Lange, lange Flure ohne Jonathan oder Ratio, Bandmitglieder in den falschen Farben, fremde Gesichter, die mich Speed Racer nennen, ein Zuhause mit nur einem einzigen Elternteil anstatt zweien.
Letzteres lässt mich innerlich zusammenzucken. Ich sollte dankbar sein für diese Mahnung; Anna James ist überall besser aufgehoben als in meiner Nähe. Wenn Mom und Dad nicht durchhalten konnten, gibt es für mich gar keine Hoffnung. Überhaupt keine.
Bei dem Gedanken entsteht in meinem Innern eine große Leere.
»Ja, Sir«, antworte ich Mr Brant.
Er nickt wieder, fast entschuldigend, wie alle Lehrerinnen und Lehrer, seit ich für das letzte Schuljahr zurück nach Enfield gekommen bin.
»Gut«, sagt Mr Brant. »Gut. Und ich werde regelmäßig vorbeischauen, um zu sehen, wie ihr vorankommt. Vor uns liegt ein Jahr voller Wettbewerbe. Da können wir uns da draußen keine Fehler leisten.«
Damit kehrt er in sein Büro zurück, lässt die schwere Holztür hinter sich offen stehen und schubst Anna und mich in ein Schweigen, in dem wir beide darauf warten, dass der jeweils andere es bricht.
»Danke schön«, sagt sie schließlich. Sie steht nicht so nah bei mir wie bei ihrem ersten Auftritt, aber sie geht wieder einen Schritt auf mich zu. »Ich hätte nicht gedacht, dass du Ja sagst.«
Ihr Lächeln ist vorsichtig, und obwohl ich Abstand halten sollte, will ich noch einmal sehen, wie ihre Augen aufleuchten, also sage ich: »Aber du kennst mich doch, Anna.«
Sie lacht. Aus vollem Halse, ein zu lautes, zu wundervolles Lachen.
»Ja, das tue ich«, sagt sie, »das tue ich.«
Ich kann nicht anders. »Erzähl mir etwas, was du über mich weißt«, sage ich mit so sanfter Stimme, dass mich die paar Leute, die draußen im Flur rumhängen, nicht hören können.
»Nur eine Sache?«, fragt sie.
»Nur eine.«
Sie hat wieder diesen Blick, der mir das Gefühl gibt, als würden kleine Wunderkerzen in mir abbrennen.
»Deine Haare sehen lang besser aus«, sagt sie.
Ich fahre mir mit der Hand über meinen glattrasierten Schädel. Die Rasur war nicht unbedingt meine klügste Idee. Aber es war ein langweiliger Nachmittag, die Haarschneidemaschine, die Mom früher für den Hund benutzt hat, lag rum, und ich spürte den unbedingten Wunsch, alles möge anders sein. Ich dachte, vielleicht habe ich keinen Einfluss auf die Ehe meiner Eltern oder darauf, wie die Leute mit mir am Band-Wochenende umgegangen sind, aber mit meinen Haaren kann ich machen, was ich will.
Doch vielleicht sind das, was ich tun kann und das, was ich tun sollte, zwei Paar Schuhe.
»Alles gut«, meint sie lächelnd. »Es wächst ja wieder nach, stimmt’s?«
Wir reden zwar nur über Haare, aber die Atmosphäre zwischen uns ist so aufgeladen, dass ich es fast knistern hören kann.
Welcher Gott auch immer für die sechs Kirchen zuständig ist, die die einzige Straße Enfields säumen, muss heute zur Abwechslung mal auf meiner Seite sein, denn Annas Handy piept und erlöst uns von diesem seltsam vertrauten Gespräch. Oder Gott weiß vielleicht doch, was am besten ist, und hat einen Plan, der vorsieht, Anna lieber von mir fernzuhalten.
»Mist«, sagt sie. »Ich muss los, sonst komme ich zu spät zum Abendessen. Heute gibt’s Hähnchen-Nuggets. Bis morgen?«
Als wäre das eine Frage. Als würde man nicht von uns verlangen, jeden Morgen pünktlich um sechs Uhr zur Marschprobe auf dem Feld zu stehen.
»Morgen«, sage ich mit etwas härterer Stimme, aber sie lächelt.
In mir drin kämpfen zwei Wölfe: Einer will sie wegschubsen, und der andere will versuchen, sie wieder und wieder zum Lächeln zu bringen.
Sie werden mich zerreißen.
Ich kann das nicht.
Ich kann ihr nicht helfen.
Ratio soll das Duett mit ihr üben, er spielt auch Mellophon. Er kann es ihr genauso gut beibringen. Vielleicht sogar noch besser, schließlich ist Ratio der Goldjunge von Enfield.
Aber während ich meine Sachen einpacke, bleibt sie in meinen Gedanken. Der Musikraum, der eben noch mein stiller Rückzugsort war, scheint mir nun zu leer und einsam zu sein, um als Versteck zu dienen.
Ich sage mir, dass ich nicht noch eine weitere Ablenkung brauche. Ich sollte das letzte Schuljahr hinter mich bringen und dann zusehen, dass ich Enfield verlasse, an einen neuen Ort ziehe. Irgendwohin, wo niemand sich darum schert, dass deine Eltern geschieden sind, wo niemand dir mitleidige Blicke zuwirft, weil sie sich daran erinnern, wie es war, als sie noch zusammen waren. Irgendwohin, wo Klatsch und Tratsch nicht das verdammte Lebenselixier eines Ortes sind.
Ich ignoriere das dunkle Gefühl in meinem Innern, während ich nach Hause fahre. Morgen werde ich Ratio dazu überreden, Anna zu helfen. Und dann wird wieder alles normal.
Mom ist heute früh wieder mal zu einer Geschäftsreise aufgebrochen, was bedeutet, dass die gähnende Leere zu Hause unerträglich sein wird. Das Feuer, das seit der Scheidung in mir lodert, hat hier Platz sich auszubreiten, Zimmer für Zimmer, schwärzt das Klavier, das sie und mein Dad mir zum siebten Geburtstag gekauft haben, brennt sich durch Moms Gemälde, für die Dad im Schuppen hinter dem Haus die Rahmen gebaut hat; ein Inferno, das jede Erinnerung an meine Kindheit Stück für Stück vernichtet.
Ich weiß nicht so recht, ob es mehr oder weniger schmerzt, es einfach weiter brennen zu lassen.
Mom hat immer einen ganzen Vorrat von diesen nervigen Fertigmenüs im Kühlschrank, aber leider muss man sie selbst zubereiten. »Einfach!«, verspricht die Packung Zitronenhähnchen mit Ricotta. »Schnell! Leicht!«
Das Rezept sieht überhaupt nicht danach aus. Ich nehme mir hinten aus der Speisekammer eine Packung Instantnudeln und übergieße sie mit heißem Wasser.
Auf der Kücheninsel liegt ein Zettel in Moms perfekter, schmaler Handschrift:
Bin bis Freitag in Cincinnati. Sag Bescheid, falls du zu deinem Vater gehst. Und miste deine Kartons auf dem Speicher aus. Sperrmüll kommt nächste Woche.
Bis zum Mond und zurück
Mom
Noch hat sie nicht ausgesprochen, dass sie das Haus verkaufen wird, aber das ist nur eine Frage der Zeit. In allen Zimmern herrscht zu viel Ordnung, die Schränke leeren sich allmählich. Das Wohnzimmer riecht leicht nach Farbe, und ich kann erkennen, wo sie Stellen ausgebessert hat.
Ich nehme meine Nudeln mit nach oben, die Kisten auf dem Speicher habe ich schon wieder vergessen. Mom muss das geahnt haben, denn sie hat sie alle vor meiner Zimmertür aufgereiht, sodass ich nicht reinkomme.
Im Ernst?
Ich öffne die Pappkartons. Hauptsächlich alte Pfadfinderuniformen, Pokale von irgendwelchen Klavierwettbewerben in der Grundschule und nicht gerade beeindruckende Bilder: Handabdruck-Truthähne und Fingerfarben-Bäume. Ich entdecke einen Plastikordner aus der Neunten, voller Stolz verkündet die Titelseite: »Der Kaua‘i‘Ō‘ō von Weston Ryan«. Darunter ist eine verwischte Zeichnung des Singvogels.
In meinen Händen geht der Ordner auf, und als ich ihn wieder zurück in den Karton legen will, fällt mein Blick auf die letzte Seite:
Der Kaua‘i‘Ō‘ō, auch Schuppenkehlmoho genannt, wurde zum letzten Mal 1987 gesichtet, ein einziger männlicher Vogel, von dem angenommen wird, dass er der letzte seiner Art ist, nachdem das Weibchen bei einem Hurrikan umgekommen ist. Als Wissenschaftler das Lied des Kaua‘i‘Ō‘ō dort abspielten, wo er zuletzt gesehen wurde, kam er auf sie zugeflogen. Er dachte, die Wissenschaftler wären ein anderer Kaua‘i‘Ō‘ō. Er dachte, er sei nicht allein, seine Familie sei noch am Leben.
Ich schiebe die Kartons in Richtung Treppe – ich werde sie später ausmisten und nach unten tragen – aber das Referat über den Kaua‘i‘Ō‘ō behalte ich bei mir.
Später, als ich nicht schlafen kann, kreisen meine Gedanken zwanghaft um den einsamen Singvogel aus Hawaii. Wusste er, dass er der einzige seiner Art war? Hat er getrauert? Hat er einen Funken Hoffnung in seinem Vogelkopf gespürt, ist die Erinnerung in ihm aufgeblitzt, als er sein eigenes Lied gehört hat?
Ich schlafe in dem Glauben ein, dass der Kaua‘i‘Ō‘ō mich bis in meine Träume verfolgen wird, doch stattdessen sind sie voller Weihnachtssocken und dem Mädchen, das sie im August trägt.
Zwei
Anna
Als wir nach Enfield gezogen sind, fand ich das erst ganz schrecklich.
»Ich habe hier doch keine Freunde«, habe ich zu Mom gesagt, während sie Töpfe und Pfannen auspackte und Dad das Zeitungspapier von den Tellern abmachte. »Was soll ich denn hier?«
Mom warf Dad einen Du-bist-dran-Blick zu. Er drückte meine Schulter und lächelte.
»Warum gehen du und Herr Bär nicht nach draußen und du zeigst ihm unseren Garten?«, schlug er vor. »Bestimmt ist er gerade ein bisschen ängstlich, und du musst ihm erklären, dass wir hier sind, weil das für uns alle besser ist.«
Eine blöde Idee, habe ich ihm gesagt, bin aber trotzdem durch die Haustür nach draußen geschlüpft, als meine Eltern wegen Jenny abgelenkt waren.
Ich bin mit Herrn Bär in den Garten gegangen, und zusammen sind wir den ganzen Zaun abgelaufen. Ich habe ihm Geschichten zugeflüstert von Umzugskartons und tränenreichen Abschieden und ihm versichert, dass alles gut wird, dass dieser Ort viel besser sein würde als der, den wir zurückgelassen hatten.
Und allmählich wurde mir leichter zumute.
In Enfield hatte ich zwar keine Freunde, aber dennoch gab es jemanden, der mir zuhörte. Das war genauso gut. Vielleicht sogar besser. Jedenfalls habe ich mir das gesagt.
Morgens bei der Probe erwische ich Weston immer wieder dabei, wie er mich anstarrt. Das erste Mal, als es passiert, als wir uns gerade eingespielt haben, lächele ich ihn an. Er lächelt fast zurück, in seinen Augen ist ein kurzes Aufleuchten zu sehen, doch er erstickt es und guckt wieder weg.
Wir sind auf dem Übungsfeld, dessen Boden so aussieht wie der eines Footballfelds, mit Yard-Linien und Endzones. So wissen wir später bei der Aufführung, wo wir stehen müssen, jeder von uns ein Schiffskapitän, der sich nicht nach den Sternen, sondern nach der Anzahl der Schritte von der weißen Seitenlinie aus richtet.
Mr Brant steht etwa sechs Meter über uns, auf dem Turm des Banddirektors, Ratio viel weiter unten, auf dem dreistufigen Podium des Tambourmajors, und beide blättern durch ihre orangenen Ordner, um herauszufinden, warum das letzte Set des Auftakts so schief aussah.
Die dreiundvierzig von uns mit Instrumenten stehen locker in Habachtstellung, bereit beim ersten Wort sofort loszulegen.
Ich bin total verkrampft und das nicht nur, weil Weston Ryan mich nicht aus den Augen lässt.
Sobald Mr Brant herausgefunden hat, warum wir den gigantischen Bogen so schief gelaufen sind, geht es mit der Inszenierung weiter, und danach wird es fast Zeit für das Duett.
Mit Weston Ryan.
Meinem Duettpartner.
Der, der mich absichtlich nicht anlächelt … wohl, weil ich ihn gestern im Musikraum praktisch überfallen habe.
Ich schaue zu ihm rüber. Eigentlich sollten wir uns genau gegenüberstehen, als die beiden Spitzen des Bogens, aber ich bin Weston mindestens vier Schritte voraus, und wenn ich raten müsste, wer von uns beiden die Marschaufstellung falsch gelesen hat …
»Anna«, ruft Mr Brant. »Du bist zu weit vorne. Guck in die Marschaufstellung.«
Meine Wangen brennen, während ich mit dem Heftchen kämpfe, das an meiner Taille baumelt. Die Schnur hängt um meinen Hals, wie bei einem Kurierboten. Weil ich mich so hektisch bewege, verheddert sie sich mit dem Gurt meines Saxophons, und einen Moment lang bin ich mir sicher, mich gleich aus Versehen selbst zu erwürgen.
»Gimpel«, flüstert einer von den Holzbläsern zu meiner Linken, und sofort bin ich auf hundertachtzig. Ich bin kein Gimpel. Nicht dieses Jahr.
Es ist mein drittes Jahr in der Marching Band. Das klingt vielleicht lang, bis einem klar wird, dass alle anderen eingetreten sind, als sie neun Jahre alt waren. Während die Handvoll Fünftklässler von uns, die keine Mitglieder waren, durch eine Reihe von klischeehaften Kunstprojekten gelotst und mit sinnlosen Aufgaben beschäftigt wurden, waren meine Freunde bei den Proben und lernten alles über Viertelnoten und Violinschlüssel und Tempobezeichnungen.
»Warum machst du nicht mit?«, lag mir meine beste Freundin Lauren ständig in den Ohren. Mit zehn Jahren war sie schon begabter, als gut für sie war, und sie war schnell zur zweiten Registerführerin unter den Flötisten aufgestiegen. »Du wärst so super! Und dann könntest du in der fünften Stunde immer mit mir und Andy und Katherine abhängen.«
Sie war nicht die Einzige, die mich immer wieder darauf ansprach. Als wir älter wurden und die Band-Leute mitten im Unterricht den Klassenraum verließen, um an irgendeinem Wettbewerb teilzunehmen, sahen mich die Lehrerinnen und Lehrer, die mich seit Jahren kannten, immer erwartungsvoll an.
»Anna, es wird Zeit.«
»Ich bin nicht in der Marching Band, Mrs Thomas.«
»Oh. Bist du dir sicher?«
»Absolut.«
Dass sie verwirrt waren, war mehr als verständlich. Ich hing mit den Leuten aus der Band rum. Ich ging zu allen Konzerten. Ich verhielt mich jedem gegenüber respektvoll, war übertrieben höflich – etwas, für das vor allem die Bandmitglieder bekannt waren, da ihnen Mr Brant ansonsten das Fürchten lehren würde. Ich hatte gute Noten und ging so gern in die Schule, dass ich das Wort »Streberin« als Kompliment auffasste.
Aber ich gehörte nicht zu den Band-Leuten. Stattdessen wartete ich wie ein treuer Hund vor dem Musiksaal darauf, dass Lauren ihren Flötenkoffer und Andy seine Schlägel zusammenpackten.
Die Marching Band und ich waren wie das Liebespaar in einem kitschigen Weihnachtsfilm: Man weiß, dass sie am Ende zusammenkommen, aber sie treffen sich immer zum falschen Zeitpunkt, bis man sich schließlich fragt – nach dem Kuss im Schneetreiben am Ende – wie sie je ohneeinander leben konnten.
Doch wir konnten lange einfach nicht zueinander finden. Die Finanzen meiner Familie waren ein einziges Hin und Her, schwankten von Nicht besonders viel zu Mehr als genug und wieder zurück zu Jeden Cent umdrehen.
Nachdem Jenny geboren wurde, arbeitete Dad rund um die Uhr. Da sie in den Nachrichten ständig von »Wirtschaftsabschwung« und »Arbeitslosenzahlen« redeten, wusste ich, dass die Lage angespannt war. Davor waren wir jedes Wochenende essen gegangen, einmal im Jahr in den Urlaub gefahren. Dad hatte mir immer mal einen Zwanzigdollarschein zugesteckt, für ein Eis in der Schule, einen Kinobesuch mit Lauren und Andy, für was immer ich wollte.
Und obwohl Dad ständig bei der Arbeit war und Mom ihr Sekretärinnen-Gehalt bekam, gab es an manchen Abenden nur welke Reste. Im Sommer fuhren wir einmal ins Erlebnisbad in der Nähe, anstatt nach Colorado oder Florida. Dad – es war immer Dad – steckte mir noch immer Geld zu, aber nun waren es Eindollarscheine oder fünf mit der Ermahnung, es ja nicht meiner Mutter zu erzählen – und jetzt meinte er es ernst. Hungern mussten wir nicht, aber ich wusste Bescheid.
Als Jenny dann ein Kleinkind war und ich in die fünfte Klasse kam, ging es allmählich aufwärts. Dad bewarb sich bei einer neuen Druckerei. Er bekam zwar anfangs weniger Gehalt als vorher, aber ich hörte wie er und Mom flüsterten, dass die Firma wachsen würde, weil er neue Kunden heranschaffte.
Als in dem Schuljahr der Termin für die Band-Anmeldung anstand, und die Highschool-Schülerinnen und -Schüler ein Konzert für uns gaben und uns anboten, ihre Instrumente auszuprobieren, war ich total aufgeregt. Mir gefielen die glänzenden Instrumente. Mir gefiel das warme Gefühl, das ich hatte, wenn ich mir ausmalte, zusammen mit Lauren oder Andy oder meinen anderen Freunden Musik zu machen. Mir gefiel die Vorstellung, dass ich, Anna James, mit meinen Lippen und meinem Atem und meinen Fingern eine Melodie aus dem Nichts zaubern konnte.
Doch dann wurden orangefarbene Informationsblätter ausgeteilt. Darauf waren die Gebühren für den Instrumentenverleih, die Notenbücher, die Konzertgarderobe und die Musikstunden aufgeführt. Zahlen über Zahlen. Ich machte mir nicht die Mühe sie zusammenzuaddieren.
Es ging uns besser, aber nicht Anna-kann-bei-der-Band-mitmachen-besser.
Nachdem die Leute aus der Highschool gegangen waren, sagte ich Lauren und Andy, dass ich mich lieber für Kunst anmelden wolle. Und zu Hause erzählte ich auch meinen Eltern, dass ich keine Lust hätte, mich bei der Marching Band anzumelden. Sie fragten, ob ich wirklich nicht mitmachen wollte.
»Wirklich nicht«, log ich.
Als sie dachten, dass ich sie nicht sehe, tauschten sie einen erleichterten Blick aus.
Doch die Marching Band war geduldig, wartete weiter, flüsterte mir weiter aus dem Abseits zu, dass vielleicht, ganz vielleicht eines Tages die Musik dran sein würde.
Dieses Flüstern schwoll zu einem Brüllen an, im Frühling der achten Klasse, als wir uns für unsere Wahlkurse auf der Highschool eintragen mussten. Die James-Familie fuhr wieder in den Urlaub. Zweimal die Woche gingen wir essen oder Dad brachte manchmal Barbecue-Sandwiches und Pommes mit, einfach so, weil wir Lust drauf hatten.
Also sprach ich mit Mr Brant – der immer und stets Ausschau nach Idioten hält, die blöd genug sind, ihr gesamtes Highschool-Leben der Musik zu opfern – und meldete mich bei der Marching Band an.
Seit meinem neunten Lebensjahr habe ich also auf diese Chance gewartet. Und nun, da ich endlich dazugehöre, will ich es auf keinen Fall vermasseln. Besonders weil es für meine Eltern ein Schlag ins Gesicht wäre, wo sie doch pflichtschuldigst die Musikstunden und die Leihgebühren bezahlen, weil sie so, so stolz auf mich sind. Besonders in einem Jahr voller Wettbewerbe. Besonders wenn an dem Duett zu scheitern bedeuten würde, buchstäblich alle mit mir in den Abgrund zu reißen.
Die Rückkopplung aus dem Verstärker hinten auf dem Feld reißt mich aus meinen Gedanken, und ich tue so, als hätte ich die richtige Seite in dem Heftchen mit der Marschaufstellung gefunden – habe ich aber nicht – und gehe einen Schritt nach vorne, bis ich auf gleicher Höhe mit Weston bin. Er beobachtet mich genau, sein Blick lässt meine linke Seite prickeln. Als ich aufsehe, deutet er sanft mit dem Kopf nach rechts, und ich rücke einen halben Schritt von ihm ab. Eine weitere Kopfbewegung. Ein weiterer halber Schritt. Ein leichtes Nicken.
Vielleicht geht er mir doch nicht aus dem Weg.
»In Ordnung, Leute. Bis zum Spiel am Freitag müssen wir das draufhaben, ist das klar? Ganz simpel. Jetzt spielen wir alles schnell einmal durch, bevor ihr unter die Dusche dürft. Alle können ihren Teil auswendig, stimmt’s?« Mr Brant wartet nicht auf eine Antwort von uns. »Okay? Wunderbar. Bleibt auf eurer Position, aber übt in der ersten Hälfte des Stücks das Losmarschieren. Tambourmajor, du gibst das Stichwort.«
Mein Magen sackt nach unten. Donner kracht über dem schlaffen Segel meines Schiffes. Mr Brant weiß, dass ich das Duett nicht draufhabe. Deswegen hat er mich gestern nach der Schule in sein Büro zitiert und mich gezwungen, das gesamte Stück durchzuspielen, Note für gequälte Note. Deswegen habe ich behauptet, dass Weston mir helfen würde, bevor ich ihn überhaupt selbst fragen konnte.
Hat Mr Brant wirklich geglaubt, dass ich das über Nacht plötzlich hinkriege? Ich hätte doch nicht gedacht, dass ich das vor der gesamten Marching Band so bald vorspielen muss …
Doch nun ist es so weit, das Duett ist dran, die anderen Holz- und Blechblasinstrumente verstummen, damit Weston und ich loslegen können. Der Strom seiner Musik trifft auf ein Gebirge voller falscher Noten. Und ich liege nicht nur einen Halbton daneben. Nein, die Noten sind alle falsch. Ein einziges klebriges Durcheinander, verzerrt und schief.
Ich treffe nicht einen einzigen Ton.
Als Mr Brant ruft, dass wir aufhören sollen, dirigiert Ratio schon gar nicht mehr, und alle anderen haben ihre Instrumente bereits losgelassen.
Nachdem er ein »Rührt euch« hinterhergerufen hat, den offiziellen Befehl, eine bequeme Haltung einzunehmen, starrt Mr Brant zu mir runter.
»Zwei Wochen«, sagt er mit drohender, Unheil verkündender Stimme.
Die gesamte Band guckt mich an. Die Welle ihrer Missbilligung schlägt mir entgegen, und ich sage mir, dass ich ein Fels in der Brandung bin, einer von den beständigen, der schon immer da war, voller Seepocken und allem. Doch mein Bauch hört nicht auf mich. Da drin fühlt es sich an, als hätte sich eine Schildkröte in einem Netz verfangen und würde durch die Wellen wirbeln.
Manchmal, wenn ich das Gefühl habe hinter den Erwartungen zurückzubleiben, wenn ich nicht die Anna James bin, die ich eigentlich sein soll, dann kommen die Schatten, wie dunkle, schwere Wolken, schemenhafte Gestalten, die versuchen mir den Mund zuzuhalten, sodass ich nicht atmen kann.
Jetzt überfallen sie mich hier. Ich bekomme kaum Luft. Es wird auch nicht besser, als Mr Brant wiederholt: »Du hast zwei Wochen Zeit, um das hinzubekommen. Bis zur Probe heute Abend kopierst du die Noten für Ryland. Ryland, mach dich bereit, jederzeit einzuspringen.«
Als ich Ryland in der Menge suche, komme ich nicht umhin, die weit aufgerissenen Augen von Terrance und Samantha zu sehen, die Saxophonisten aus der Neunten unter meiner fragwürdigen Leitung. Ryland spielt während der Konzert- und der Marching Band-Saison die erste Klarinette, hat aber auch das erste Saxophon in der Jazzband inne.
Er wirft mir einen entschuldigenden Blick zu.
Alles ist mir zu nah, zu drückend, und ich habe das Gefühl, vor lauter Scham in die Knie zu gehen. Die schwarzen Schatten greifen nach mir.
Das sollte das Jahr sein, in dem ich nicht versage. Das sollte das Jahr sein, in dem ich dazugehöre, das Jahr, in dem mich keiner mehr einen Gimpel schimpft.
Nach einer Ewigkeit ruft Mr Brant: »Wegtreten!«
Alle gehen auseinander, eilen zu den Duschen.
Es ist eigentlich zu früh im Schuljahr für nasse Haare, Schlabberhosen und Sweatshirt. Ein paar aus unserer Stufe machen sich für die Abschlusszeitung zwar jetzt schon Gedanken darüber, wer am besten angezogen ist, den besten Stil hat, aber diese Dinge brauchen Zeit, und Zeit ist in der morgendlich überfüllten Umkleide ein rares Gut.
Lauren kommt nicht zu mir, um mit mir zu reden. Sie neigt nur ein wenig den Kopf zur Seite, eine unausgesprochene Frage, während sie ihre Noten und ihre Piccoloflöte zusammensammelt. Alles okay?, fragt sie in bester-Freundin-Körpersprache, mein kleines Lächeln antwortet Ja.
Und es ist alles in Ordnung, eigentlich. Doch ich stehe länger unter der Dusche als sonst, lasse das lauwarme Wasser auf mich herabregnen und erinnere mich daran, dass ich genau hier sein will, dass die Band und ich füreinander bestimmt sind, auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Schatten mir zuflüstern.
Auf dem Weg zum Unterricht tropft mir das Wasser aus den nassen Haaren den Rücken runter.
»So schlimm war es auch nicht«, sagt Lauren beim Mittagessen. »Also, nichts im Vergleich zum letzten Jahr, weißt du noch? Als Timothy Lydia zwei Tage vor dem Bezirkswettbewerb aus Versehen mit dem Zug seiner Posaune gegen die Birne gedonnert hat?«
Ich zupfe an meinem Sandwich rum. »Wer könnte das vergessen?«
»Und du hast noch Wochen Zeit, um es richtig hinzukriegen, denk dran. Nicht nur ein paar Tage.«
Normalerweise bin ich immer diejenige, die auf den Silberstreifen am Horizont hinweist, deswegen ist es komisch, das jetzt von Lauren gesagt zu bekommen.
Ohne zu fragen, nimmt sich Andy meinen normalen Joghurt, tauscht ihn gegen seinen griechischen und legt eine Sekunde später noch einen Entschuldigungs-Keks dazu. Eine Abmachung zwischen uns, die schon lange gilt, seit Andys Mutter darauf besteht, ihm Joghurt griechischer Art mitzugeben. Ekliger Art, nennt Andy das.
Lauren und Andy sind beide schon auf dem neusten Stand, was meine Verzweiflung angeht, und dass ich Weston praktisch gezwungen habe, mir zu helfen. Sie wissen von seinem kryptischen Verhalten und der unglaublichen Schande, die Mr Brants Ultimatum darstellt, mein Stück von Ryland spielen zu lassen, was obendrein die gesamte Band mitbekommen hat.
»Ich bin echt gespannt, wie du mit Weston zurechtkommst«, sagt Andy. »Der Typ ist wirklich seltsam.«
»Wie meinst du das?«, fragt Kristin. Sie ist die einzige Neuntklässlerin an unserem Tisch, aber keiner hat etwas dagegen, weil sie die einzige Oboe in der Band ist und wir sie bei Laune halten müssen. Den Kammerton zum Einstimmen anzugeben ist schon so schwer genug, da muss man nicht noch allein zu Mittag essen. »Er scheint doch voll in Ordnung zu sein.«
»Ständig trägt er diese Lederjacke. Na, okay. Aber sogar mitten im Sommer? Der Typ denkt wohl, er ist das Phantom der Oper oder so. Richtig merkwürdig«, sagt Andy und isst einen Löffel Joghurt. »Bis er letztes Jahr aufgehört hat, hatten wir denselben Klavierlehrer. Daher weiß ich, dass er zwar total begabt ist, aber auch total asozial. Der Typ. Ist. Seltsam.«
»Absolut«, stimmt Lauren ihm zu, und ich bin sofort genervt davon, dass sie ihm so einfach zustimmt, obwohl ich all das Geld aus meinem Sparschwein darauf verwetten würde, dass sie noch nie ein Wort mit Weston gewechselt hat. »Warum lässt du dir nicht von mir helfen?«, fragt sie und wendet sich an mich. »Du brauchst ihn doch gar nicht, um deinen Teil zu lernen, weißt du?«
Weston Ryan. Ich wollte ihn nicht anlügen, als ich gesagt habe, dass ich ihn kenne. Aber ich kenne ihn nicht, nicht wirklich. Nicht auf die konkrete Art, wie ich Lauren oder Andy kenne oder jeden anderen auf dieser Schule. Weston ist wie der Nebel, der am frühen Morgen tief über den Getreidefeldern liegt, da, aber nicht wirklich greifbar.
Doch ich weiß genug. Erinnerungen blitzen in mir auf, völlig zusammenhangslos, aus dem Schuljahr, bevor er nach Bloom gezogen ist: Weston in einer Ecke des Musiksaals, während er sein Buch liest, in diesem langen zwei-Proben-am-Tag-Sommer; Weston, ein ferner Planet, der um Ratio und Jonathan kreist, eine Sonne aus lauten Witzen und entspanntem Gelächter. Weston, der sich die Zeit nimmt, einen Gecko zu fangen, der mitten in den Trubel eines Spieltages hineingeraten ist, und ihn sanft in den Händen haltend nach draußen in Sicherheit bringt.
Weston, nach der letzten Probe des Schuljahrs, wie er mit gesenktem Kopf in seiner Lederjacke an seinem alten waldgrünen Explorer lehnt, völlig vernichtet, die länglichen blonden Haare ihm ins Gesicht hängen, das Handy locker in seiner ausgestreckten, bleichen Hand.
Ich war an diesem Abend eine der letzten auf dem Parkplatz gewesen, nachdem ich mit ein paar anderen an der Reihe war, unser ganzes Zeug wegzuräumen. Ich hätte ihn fragen sollen, was los ist, habe ich aber nicht. Ich musste an ihm vorbei, um zu Moms Auto zu kommen, doch ich habe kein einziges Wort gesagt.
Dass er letztes Jahr nicht hier war, hat irgendwas mit der Scheidung seiner Eltern zu tun, und ich weiß, dass er auf der Highschool in Bloom war, unser Nachbarort und Rivale in allen Dingen, auch was die Marching Band angeht. An dem Band-Wochenende vor zwei Wochen haben sie ständig Witze darüber gemacht, ihn einen Verräter genannt.
Er hat nicht gelacht.
Aber vor allem weiß ich, dass mit Ausnahme von Ratio und Jonathan alle glauben, Weston Ryan sei jemand, den man entweder erträgt oder dem man aus dem Weg geht. Und ich frage mich, ob das seekranke Gefühl in meinem Bauch daher rührt, dass ich weiß – ganz sicher weiß –, wenn die Leute über die schwarzen Schatten Bescheid wüssten, die über meiner unbekümmerten, immer-fröhlichen-Persönlichkeitsrüstung kreisen, die ich mir jeden Morgen anlege, dann würden sie mich auch nicht mehr für freundschaftsfähig halten.
Also sage ich Lauren: »Ihr habt alle mehr als genug zu tun. Ich komm schon klar.«
Als hätte unser Gespräch ihn herbeigerufen, taucht Ryland an unserem Tisch auf, und Lauren, Andy und Kristin sind plötzlich voll und ganz in ein Gespräch vertieft.
»Anna? Ich wollte nur sagen, dass es mir leidtut. Ich schwöre, dass ich kein Wort mit Mr Brant über das Duett gewechselt habe. Wirklich nicht. Ich will es gar nicht spielen.«
Sein Tablett in der Hand, steht er so da, als müsste er vor meinem Ärger gleich Reißaus nehmen, was vollkommen lächerlich ist. Bevor ich meinen Führerschein bekommen habe, hat mich Ryland unzählige Male zu den Proben mitgenommen. Ständig macht er in der Holzbläsergruppe flüsternd irgendwelche Witze, um mich zum Lachen zu bringen oder versucht mich dazu zu überreden, auch der Jazzband beizutreten.
Auf Ryland sauer zu sein, wäre wie auf einen Welpen sauer zu sein. Einen sehr begabten Welpen.
»Das weiß ich doch«, sage ich und lege den Keks auf eine freie Stelle auf seinem Tablett. »Aber falls ich das mit Weston nicht hinkriege, brauche ich vielleicht deine Hilfe.«
Ryland lässt ein Schnauben hören. »Ich sag es ja nicht gerne, aber Weston ist wahrscheinlich das Beste, was dir passieren kann. Der Typ ist merkwürdig, aber was Musik angeht, hat er es echt drauf. Wenn dir jemand dieses Duett rechtzeitig beibringen kann, dann er.«
»Hey!«, sagt Lauren und bricht viel zu schnell ihr künstliches Gespräch ab, um bei uns mitzureden. »Ich habe ihr schon angeboten zu helfen!«
Ryland lächelt sie über meinen Kopf hinweg an. »Klar, als könnte ihr eine Piccoloflöte helfen. Dass du allein bist, hat nur einen einzigen Grund: Keiner könnte es ertragen, zwei von diesen Dingern gleichzeitig zu hören.«
»Ich bin die Einzige, weil ich die Beste bin.« Lauren klaut sich den Keks von seinem Tablett und steckt ihn sich ganz in den Mund.
Völlig unbeeindruckt sagt Ryland gedehnt: »Wie bekommt man zwei Piccoloflöten dazu, gemeinsam zu spielen?«
Lauren glotzt ihn wütend an.
»Du musst eine davon ermorden.«
»Haha. Sehr lustig. Total komisch. Wenigstens jault mein Instrument nicht wie ’ne kaputte Klingel.«
Ryland verdreht die Augen und geht dann zu seinem Tisch. Über die Schulter ruft er: »Wenigstens kann man mein Instrument überhaupt hören.«
Lauren wendet sich an uns. »Ich spiele nicht laut genug? In meiner Gruppe sind vier Leute. Vier. Bei ihm sind es sieben, und trotzdem muss sie Mr Brant bei jeder Probe daran erinnern, lauter zu spielen.«
»Sind du und Ryland nicht zusammen in der Jugendgruppe bei den Baptisten?«, fragt Kristin zaghaft.
»Ja, zum Glück. Herr, wirf Hirn vom Himmel! Nur Gott kann diesem Jungen helfen«, sagt Lauren.
»Außerdem haben die beiden mal gedatet«, sagt Andy und legt mir einen weiteren Keks hin.
»Also hasst ihr euch?«, fragt Kristin.
»Ach Schätzchen«, schnaubt Lauren. »Wenn wir anfangen würden, alle aus der Band zu hassen, die wir mal gedatet haben, wäre keiner mehr miteinander befreundet. Unser lieber Andy hier arbeitet sich gerade durch die Blechbläser, als wäre das sein Job.«
»Entschuldige mal. Ich will nur die Beziehungen zwischen den verschiedenen Instrumentengruppen stärken«, sagt Andy. »Eine schwere Bürde, aber irgendjemand muss es ja tun.«
»Was bist du nur für ein Held«, sage ich trocken.
»Dass alle letztes Jahr Pfeiffersches Drüsenfieber hatten, ist allein auf ihn zurückzuführen«, sagt Lauren und steckt sich eine Babykarotte in den Mund.
»Ach ja? Das hat eher was mit den ganzen Blasinstrumenten zu tun, die überall eure Spucke verteilen. Außer Blut, Schweiß und Tränen kommen bei unseren Schlaginstrumenten keine Körperflüssigkeiten vor.«
Unser Geplänkel sorgt dafür, dass sich der Knoten in meinem Magen, den ich seit der Probe habe, endlich löst. Während ich im Geschichts- und Spanischunterricht saß, bin ich den Morgen immer wieder im Kopf durchgegangen, bis sich die ganze Sache so aufgebauscht hat, dass sie sich in ein Godzilla-großes Ungeheuer verwandelt und alles andere plattgemacht hat.
Doch hier an unserem Tisch, während sich Lauren und Andy den nächsten Schlagabtausch liefern und Kristin Angst hat zu lachen, es aber trotzdem tut, kommt es mir nicht mehr so schlimm vor. Das Schuljahr fängt gerade erst an. Noch habe ich genug Zeit, um alles in Ordnung zu bringen. Die schwarzen Schatten haben sich erübrigt.
Als es zum Ende der Mittagspause klingelt, bin ich fast davon überzeugt, dass alles gut ist. Dann spüre ich ein Prickeln, als würde mich jemand beobachten, und da ist Weston Ryan, die Lederjacke über der Schulter und lehnt an der Backsteinmauer im großen Treppenhaus.
Ein unbekanntes Gefühl überkommt mich, als meine braunen Augen auf seine blauen treffen, aber es ist nicht unangenehm. Es ist überhaupt nicht unangenehm.
»Äh, ich muss mit ihm reden«, sage ich Lauren und deute mit dem Kopf auf Weston. »Wir sehen uns gleich im Kursraum. Kannst du mir mein Mathebuch aus meinem Schließfach mitbringen?«
Lauren hat ihren Blick auch auf Weston gerichtet, aber sie kneift dabei die Augen zusammen. »Der Typ ist seltsam, Anna. Echt seltsam. Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll?«
Ich reiße meinen Blick von Weston los und dreh mich ein Stück weg, damit er nicht sehen kann, dass sich meine Lippen bewegen. »Warum sagen das alle immer dauernd?« Ich bin selbst überrascht, wie genervt meine Stimme klingt, wie verteidigend. »Ist es wegen der Lederjacke?«
»Wegen seiner ganzen Art. Du weißt doch, dass alle Jessica sofort mögen, ohne sie überhaupt zu kennen?«
Ich denke an die hübsche, quirlige Trompeterin und nicke. »Ja, und?«
Laura senkt ihre Stimme zu einem eindringlichen Flüstern. »So geht es allen, wenn sie ihn sehen, nur dass es hier darum geht, wie seltsam er ist und nicht wie wunderbar.«
Die Art wie die Leute über Weston reden, kommt mir unglaublich ungerecht vor, selbst wenn ich es nicht genau benennen kann. Na und, dann trägt er eben eine Lederjacke. Er liest auch Bücher und bringt Geckos in Sicherheit. Und er hat mich nicht rausgeschmissen, als ich in den Musikraum gestürzt bin und ihn um Hilfe angefleht habe.
Er kann nicht ganz schlecht sein. Ich bin sogar davon überzeugt, dass er überwiegend kein schlechter Mensch ist.
»Ich bin auch seltsam«, werfe ich ein, und Lauren gibt einen frustrierten Laut von sich.
»Du bist sozialverträglich seltsam. Das Seltsamste an dir sind deine Weihnachtssocken und vielleicht, dass deine Familie bezaubernd lächerlich ist.«
Dazu habe ich nichts zu sagen. Lauren ist wahrscheinlich meine beste Freundin. Wir kennen uns seit der dritten Klasse. Aber obwohl wir unzählige Mal beieinander übernachtet und viele gemeinsame Stunden zusammen im Band-Bus verbracht haben, frage ich mich doch, ob Lauren wirklich genug Zeit hat, um irgendjemand tatsächlich zu kennen. Egal, um was es auch geht – Marching Band, Geländelauf, ihre Schulleistungen, Tanzgruppe – sie ist immer engagiert, immer hervorragend. Ganz nebenbei macht sie sogar noch bei Schwimmwettkämpfen mit.
Sie ist ständig unterwegs, und manchmal fühlt es sich so an, als würde ihr unsere Freundschaft erst wieder einfallen, wenn ihr Tagespensum erledigt ist. Deswegen habe ich ihr Hilfsangebot auch nicht angenommen, denn selbst wenn sie es im Moment wirklich so meint, wird sie später keine Zeit haben.
Das geht mir gegen den Strich, doch sorgt auch dafür, dass ich meine Stimme wiederfinde. »Ich komm schon zurecht. Ich will nur kurz mit ihm reden. Bringst du mein Buch mit?«
Lauren verdreht die Augen und nimmt mir meine Brotdose aus den Händen. »Okay. Die tue ich auch in dein Schließfach, aber nur, damit deine Eltern gleich all deine Sachen zusammen haben, wenn du vor lauter Seltsamkeit verendest.«
»Jetzt geh schon«, sage ich.
Wir haben nur fünf Minuten bis der Unterricht beginnt und zwei davon sind schon für unseren Flüsterstreit draufgegangen.
Bevor ich mich zu ihm umdrehe, weiß ich, dass Weston immer noch auf mich wartet, weil ich seinen Blick weiterhin spüren kann. Als ich auf ihn zugehe, kann ich sehen, wie er mich – nur einmal – von oben bis unten anguckt, von meinem blauen T-Shirt von der Kirchentagung letztes Jahr bis hin zu meinen Lieblingsjeans und meinen Turnschuhen.
Mir geht der absurde Gedanke durch den Kopf, dass ich jetzt gerne mein Shirt mit den flatternden Ärmeln anhätte. Als würden Jungs auf so was wie Ärmel achten.
Als ich vor ihm stehe, brennt mein ganzes Gesicht. Er richtet sich nicht auf, lehnt weiter an der Wand, und ich bin dankbar, weil er dann nicht so groß wirkt, kaum größer als ich.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Gehirn setzt total aus. Vor mir sehe ich gleichzeitig die katastrophale Probe heute Morgen und Westons weit aufgerissene Augen, als ich gestern in den Musikraum gekommen bin.
Dann sage ich das Erste, was mir durch den Kopf geht.
»Lässt du deine Haare wieder wachsen?«
Ist das peinlich. Gut gemacht, Anna. Echt gut, bei jedem Gespräch mit seinen Haaren anzufangen.
Seine Miene klärt sich auf, die Sonne guckt zwischen den Wolken hervor, an einem trüben Tag, von dem man nichts als Dunkelheit erwartet hat, und er legt den Kopf zur Seite. »Möchtest du das?«
Irgendetwas an dem Ausdruck in seinen Augen und an der Art wie er mich anstarrt, lässt mich übermäßig bewusst den Rucksack auf meinen Schultern spüren.
»Was ich möchte, ist, dass du mir sagst, wann wir uns treffen können, um das Duett zu üben.«
Seine Miene bewölkt sich. Oh, oh!, denke ich. Sieht nach Regen aus.
»Ich kann dir nicht helfen.«
Mein Herz stolpert. »Du kannst nicht oder du willst nicht?«, frage ich.
Er öffnet den Mund, um zu antworten, aber ich lasse ihn nicht zu Wort kommen: »Wehe, du lügst«, und er schließt ihn wieder.
»Alle lügen«, sagt er nach einer Weile.
Es klingelt zum Unterricht, aber wir bewegen uns nicht.
»Was ist, wenn wir abmachen, uns gegenseitig nicht anzulügen?«, sage ich. »Uns die Wahrheit zu sagen, selbst wenn es furchtbar ist?«
Als ich klein war, war ich in einen Piraten verliebt, aus einer pädagogischen Zeichentricksendung, die Jenny immer geguckt hat. Er sollte eigentlich der Bösewicht sein, der Schurke, aber etwas an der Art wie sich sein höhnisches Grinsen in ein Lächeln verwandelte, entschuldigte all seine Missetaten: den Buchstaben-Diebstahl, die Zerstörung aller Drei- und Vierecke.
Westons langsames Lächeln lässt mich an ihn denken: ein Piratenlächeln. Ein Schurken-Lächeln. Es führt dazu, dass sich meine Beine fragen, wofür sie eigentlich da sind.
»Möchtest du, dass ich mir die Haare wachsen lasse?«
Seine Stimme ist zu tief, als dass das spielerisch gemeint sein könnte, der Ausdruck in seinen Augen zu ernsthaft.
»Du kannst machen, was immer du …«
»Du hast es versprochen«, sagt er. »Die Wahrheit.«
Ich ringe nach einer Antwort, als es zum letzten Mal klingelt. Noch mal Glück gehabt.
»Unterricht.« Ich zeige in Richtung Flur. »Bei Mrs Benson darf ich nicht zu spät kommen.«
»Stimmt.« Seine Stimme ist so tief. »Aber Anna?«
Ich will mich gerade abwenden, halte inne. »Ja?«
»Meine Haare? Gefallen sie dir länger besser?« Weston hebt die Augenbrauen.
Ich gehe einen winzigen Schritt nach vorne. »Und wenn?«
Er zuckt mit den Schultern. »Dann lass ich sie wachsen.«
Ich werde zu spät kommen, aber ich muss einfach fragen. »Warum?«
»Weil ich weiß, wer du bist, Anna James«, sagt er.
Und dann ist er weg, macht sich auf den Weg zum Unterricht.
Erst als die Mathestunde schon halb rum ist, wird mir klar, dass er nicht wirklich beantwortet hat, ob er mir mit dem Duett helfen wird.
Drei
Weston
Ich bin so ein Idiot.
Nachdem ich Mr Brant im Musikraum helfen sollte – was ein totaler Witz war –, bin ich direkt los, um Anna noch vor Ende der Mittagspause zu erwischen. Ich wusste ganz genau, was ich sagen wollte. Ich war vorbereitet. Ich habe es sogar vorher einstudiert. Ich kann dir nicht helfen. Du wirst mir noch dafür danken, dass ich nicht alles noch schlimmer gemacht habe.
Aber ihre Augen haben geleuchtet und etwas an der Art wie sie glänzten, wie sie keine Angst hatte, mit mir gesehen zu werden und Laurens offensichtliche Bedenken abgewehrt hat, hat mir den Magen umgedreht. Ich konnte kein einziges Wort davon sagen.
Und dann schien sie sich irgendwie wieder für meine Haare zu interessieren, so als wäre ich ihr schon früher aufgefallen, so als wäre ihr das wichtig, und ich konnte nicht aufhören zu lächeln.
Was am Ende der Mittagspause passiert ist, darf nicht noch mal passieren. Ich darf mich nicht von ihr ablenken lassen, so wie eben. Davon wie ihre Ohren rot geworden sind, weil sie gemerkt hat, dass ich sie beobachte oder wie sie mich angesehen hat: als wollte sie sich mein Gesicht genau einprägen.
Ratio kann ihr helfen.
Und ich kann ganz sicher nicht noch mehr Zeit darauf verschwenden, über ihr Haar nachzudenken … oder an ihre Beine in den Shorts, die sie während der Proben trägt … oder wie süß ihre Ohren sind, wenn sie nicht rot sind.
Scheiße.
Es ist die erste Dienstagabend-Probe der Saison, aber, noch viel wichtiger, es ist mein erstes Mal im Enfield Stadion nach allem, was letztes Jahr passiert ist.
Und es riecht genauso und sieht genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. In Erwartung der Dämmerung flackern überall die Flutlichter auf und rücken kleine Klumpen des Kunstrasens unter meinen Schuhen grell in mein Blickfeld. Der langanhaltende Geruch von Footballspieler-Schweiß liegt in der Luft, ihre Trainingsstunde haben sie abgekürzt, damit die Marching Band das Feld einnehmen kann.
Die Tribüne ragt gen Himmel, das Metall fängt die letzten Sonnenstrahlen und das blendende Scheinwerferlicht ein, reflektiert noch mehr Hitze auf das sowieso schon heiße Feld. Noch sitzt da niemand, aber sobald die Probe anfängt, werden genug Band-Eltern auftauchen, um die ersten zwei Reihen zu füllen und uns dabei zuzugucken, wie wir wieder und wieder die gleichen Nummern durchlaufen.
Abgesehen von Ratio und Landon ist das Feld leer, sie stehen nebeneinander und gucken in die Marschaufstellung.
Landon ist ein Gimpel, und Ratio hilft ihm, natürlich.
»Ich verstehe einfach nicht, wie ich in der Zeit von der Fünfzig-Yard-Linie«, Landon hält inne, um sich seine Position anzugucken, »zu der Dreißig-Yard-Linie kommen soll. Wie soll ich das hinkriegen? Riesige verdammte Monsterschritte machen?«
»Ja«, sagen Ratio und ich gleichzeitig.
Landon stöhnt, während Ratio mich angrinst.
»Dehn dich lieber noch mal ordentlich, bevor es losgeht«, sagt Ratio und gibt Landon sein Heftchen mit der Marschaufstellung zurück. »Du wirst es brauchen.«
Während sich Landon zurück auf den Weg in den Musiksaal macht, helfe ich Ratio dabei sein Podium aufzubauen. Wir arbeiten in friedlicher Stille, etwas, was mir letztes Jahr in Bloom echt gefehlt hat.
Ratio, Jonathan und ich haben bei einem verhängnisvollen Zweifeldball in der ersten Klasse zueinander gefunden, und auch wenn man nicht behaupten kann, dass wir seitdem unzertrennlich sind, so hat uns doch über die Jahre einiges zusammengeschweißt: Wochenenden voller Videospiele, Fahrten mit dem Quad meines Dads, und wir haben – ein- oder zweimal – im Wald um unser Haus herum unsere Instrumente so laut wie nur möglich gespielt, zwei Waldhörner und ein Euphonium schmetterten in die Nacht und haben sogar das andauernde Geheul der Präriehunde zum Schweigen gebracht.
Moms Haus, erinnere ich mich. Dad lebt jetzt in Bloom und den kümmerlichen Baum direkt neben seinem Wohnwagen kann man kaum als Wald bezeichnen.
»Speed Racer«, begrüßt mich Ratio ganz offiziell.
»Ich habe doch gesagt, du sollst mich nicht so nennen, Horatio.«
»Na schön.« Ratio lacht. »Aber du musst schon zugeben, die Leute aus Bloom wissen zwar nicht, wie man richtig marschiert, aber ihre Spitznamen lassen einen nicht so schnell los.«
»Das gilt auch für Läuse, und trotzdem will sie keiner haben«, sage ich.
Speed Racer. Den Spitznamen habe ich mir verdient, als ich zurück zu meiner Position gerannt bin, nachdem der Banddirektor in Bloom zu einem weiteren Durchlauf aufgerufen hatte, von was immer wir da gerade geprobt haben. Hier, unter Mr Brants strengem Regiment, ist zurückzujoggen ganz selbstverständlich. Es spart Zeit. Es ist gut für dein Kardiotraining. Und wenn du dem nicht nachkommst, heißt das eine extra Runde drehen oder Liegestütze für alle aus der Band, den Ärger, den das nach sich zieht, inklusive. Ich hatte das so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders konnte, obwohl die Leute aus der Bloom-Band immer nur gemächlich auf ihre Positionen zurückgeschlendert sind. Es gab meinen neuen Mitschülern die Gelegenheit, hinter ihren Instrumenten und vorgehaltener Hand über mich zu kichern.

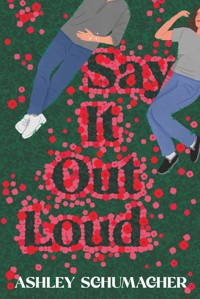














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












