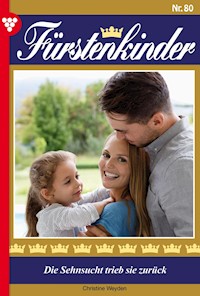
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkinder
- Sprache: Deutsch
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkinder" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Ihre Lebensschicksale gehen zu Herzen, ihre erstaunliche Jugend, ihre erste Liebe – ein Leben in Reichtum, in Saus und Braus, aber oft auch in großer, verletzender Einsamkeit. Große Gefühle, zauberhafte Prinzessinnen, edle Prinzen begeistern die Leserinnen dieser einzigartigen Romane und ziehen sie in ihren Bann. Nur flüchtig hatte Markus von Hohenkamp das Bild in sich aufgenommen: eine dichte Staubwolke, die sein eigener Wagen noch verstärkt hatte, darinnen eine kleine Gruppe von Menschen und einige Meter weiter ein kleiner Wagen, am Straßenrand geparkt. War ein Unfall geschehen? Wurde Hilfe gebraucht? Er hielt seinen Wagen an und ließ ihn dann die abfallende Straße zurückrollen, vorbei an dem kleinen Auto, das keineswegs das neueste Modell war, bis zu der Menschengruppe, die, wie er jetzt sehen konnte, aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern bestand. Der Staub hatte sich noch immer nicht verzogen. Hatte es denn hier schon monatelang nicht geregnet? Bei dem Zustand der Straße! einen Unfall deutete zum Glück gar nichts hin. Trotzdem fragte er: »Kann ich helfen?« Es gab ganz sicher hier nichts zu helfen, aber er stellte die Frage sogar noch ein zweites Mal. Warum? Um einen Grund zu haben, einige Augenblicke länger hier stehenbleiben zu können, gab er sich selbst offen zu. Denn da waren zwei blaue Augen... Gab es das wirklich, ein solches Blau? Da war langes Blondhaar, das aus Sonnenstrahlen gesponnen zu sein schien. Er verspottete sich selbst im stillen wegen dieses allzu poetischen Vergleichs. Und da waren zwei kleine Hände, die schützend ein Mädelchen an sich drückten, das Gesichtchen des Kindes im Kleid bergend. »Es tut mir wirklich schrecklich leid«, sagte eine junge Männerstimme, und Markus von Hohenkamp wandte sich unwillkürlich dem Sprecher zu. »Ja, es tut uns schrecklich leid«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkinder – 80 –Die Sehnsucht trieb sie zurück
Unveröffentlichter Roman
Christine Weyden
Nur flüchtig hatte Markus von Hohenkamp das Bild in sich aufgenommen: eine dichte Staubwolke, die sein eigener Wagen noch verstärkt hatte, darinnen eine kleine Gruppe von Menschen und einige Meter weiter ein kleiner Wagen, am Straßenrand geparkt.
War ein Unfall geschehen? Wurde Hilfe gebraucht?
Er hielt seinen Wagen an und ließ ihn dann die abfallende Straße zurückrollen, vorbei an dem kleinen Auto, das keineswegs das neueste Modell war, bis zu der Menschengruppe, die, wie er jetzt sehen konnte, aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern bestand.
Der Staub hatte sich noch immer nicht verzogen. Hatte es denn hier schon monatelang nicht geregnet? Bei dem Zustand der Straße!
Jetzt war er bei dem Menschen-
trüpplein angekommen, hielt an, stieg aus, kam sich aber im nächsten Augenblick etwas überflüssig vor, denn auf
einen Unfall deutete zum Glück gar nichts hin.
Trotzdem fragte er: »Kann ich helfen?«
Es gab ganz sicher hier nichts zu helfen, aber er stellte die Frage sogar noch ein zweites Mal. Warum? Um einen Grund zu haben, einige Augenblicke länger hier stehenbleiben zu können, gab er sich selbst offen zu. Denn da waren zwei blaue Augen... Gab es das wirklich, ein solches Blau? Da war langes Blondhaar, das aus Sonnenstrahlen gesponnen zu sein schien. Er verspottete sich selbst im stillen wegen dieses allzu poetischen Vergleichs. Und da waren zwei kleine Hände, die schützend ein Mädelchen an sich drückten, das Gesichtchen des Kindes im Kleid bergend.
»Es tut mir wirklich schrecklich leid«, sagte eine junge Männerstimme, und Markus von Hohenkamp wandte sich unwillkürlich dem Sprecher zu.
»Ja, es tut uns schrecklich leid«, kam das Echo einer Kinderstimme, und Markus sah hinunter, woher sie gekommen war, sah wieder zum Sprecher zurück und hatte Mühe, ein Lächeln zu unterdrücken. Denn einer solchen Ähnlichkeit, die sich nicht nur auf die Gesichtszüge beschränkte, sondern sich auch in einer gewollten Gleichheit des Haarschnittes – einer Pagenfrisur von brandroter Farbe – ausdrückte, war er noch nie begegnet. Daß er darüber den Kopf schüttelte, wußte er gar nicht.
Der junge Mann neben ihm, den er auf Mitte der Zwanzig schätzte, nickte aber dazu nur sehr verständnisvoll, als ob er sagen wollte: Dein Erstaunen erstaunt uns nicht, daran sind wir schon gewöhnt. Laut aber gab er von sich:
»Wenn Sie sich über unsere Ähnlichkeit wundern, dann sehen Sie sich erst das mal an!« Und er deutete auf das Kindergesicht, das sich jetzt aus den Kleiderfalten der jungen Frau mit blinzelnden Augen löste.
Markus schaute gehorsam und konnte nur wieder den Kopf schütteln: nochmals ganz unwirklich blaue Augen, nochmals blonde Locken wie gesponnenes Gold, eine Zug für Zug gleiche Miniaturausgabe der jungen Frau, an die sich das Mädelchen jetzt mit dem Rücken drückte. Mit offenem Mäulchen und großen Augen staunte es dann, wie eben Markus noch gestaunt hatte. Und dann lachten sie plötzlich alle fünf, froh, herzlich und ohne jede Spur von Mißverständnis und Gekränktsein, zu dem vielleicht der junge Mann und sein kleines Ebenbild schon öfter Grund gehabt haben mochten.
»Till eins und zwei!« stellte der kleine Mann sich und seinen Begleiter vor.
»Vater und Sohn!« meinte Markus von Hohenkamp.
»Nein! Wäre nicht ganz aufgegangen«, lachte Till eins ein so jungenhaft fröhliches Lachen, daß man nur mehr die lustigen wasserblauen Augen sah und nicht mehr den brandroten halblangen Haarschopf und die dicht gesäten Sommersprossen auf Wangen und Nasenrücken. »Zweiundzwanzig und neun.
Rechnen Sie selbst! Der hoffnungsvolle Knabe hier heißt eigentlich Hans-Friedrich. Stell dich vor, mein Sohn!«
»Till zwei von Hohenkamp!« sagte der Kleine mit einer artigen Verbeugung, daß der rote Haarschopf in der Sonne funkelte.
»Nein!« sagte Markus und schüttelte den Kopf.
Der Kleine bezog das Nein auf seinen von ihm selbst aus abgöttischer Liebe zum großen Bruder gewählten Vornamen und korrigierte ein bißchen seufzend:
»Hans-Friedrich von Hohenkamp. Aber Till zwei ist mir lieber!« Ein Blick grenzenlosen Stolzes ging zu Till eins.
Der fuhr ihm mit der Hand über das Haar, zog sie aber rasch wieder zurück, als ob er sich dieser Bezeugung von Zärtlichkeit schämte.
»Ich habe mich nicht über deinen Vornamen, sondern über deinen Nachnamen gewundert«, erklärte Markus. »Ich heiße nämlich wie du, nur statt Till Markus: Markus von Hohenkamp.« Die Verbeugung, die den Namen begleitete, galt dem Goldhaarmädchen.
»Liliane von Ruyk«, war die Erwiderung. Ein kleines Lächeln zu dem Mädelchen hinab: »Liliane eins und zwei.«
»Schwestern!« sagte Markus überzeugt.
»Nein. Diesmal Mutter und Tochter.«
Nun hielt es Till aber für an der Zeit, die Situation zu klären.
»Mein Esel hat sich schlecht benommen.«
»Esel?« fragte Markus und sah sich nach einem Grautier um.
Doch Till deutete die Straße entlang zu seinem kleinen Wagen hin.
»Mein Esel hat einen derartigen Sandsturm auf dieser wunderschönen Straße entfesselt, daß die kleine Dame hier« – ein bedauernder Blick ging zu dem Mädelchen – »die Augen und wohl auch den Mund voll Sand bekam und zu weinen und zu husten begann. Wir sahen es im Rückspiegel.«
»Es tat uns schrecklich leid!« beteuerte Till zwei nochmals.
»Mein Wagen tat leider das gleiche«, bedauerte Markus. »Ich sah zu spät, daß Fußgänger auf der Straße waren, um das Tempo noch verringern zu können. So habe ich den Sandsturm noch verstärkt.«
»Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich mit dem Kind nicht zu Fuß gegangen«, erklärte Liliane. »Am Bahnhof bekam ich kein Fahrzeug irgendwelcher Art, dafür sagte man mir, die Straße sei einmalig schön und romantisch und kaum befahren, ich würde keinem einzigen Wagen begegnen. So wagte ich den Fußmarsch, denn wir gehen gern und viel, Lili und ich. Jetzt tut es mir leid.«
»Ist ja schon wieder gut, Mami!« tröstete der kleine blonde Engel, rieb sich aber doch noch einmal die Augen. »Es tut gar nicht mehr weh.«
»Wirklich nicht?« fragte Markus und hob das Kind auf seine Arme.
»Wirklich nicht!« beteuerte Lili und strahlte den großen, eleganten Mann aus ihren sommerhimmelblauen Augen an.
»Wohin soll Ihr Weg denn führen, Frau –?«
»Ruyk«, ergänzte Liliane. »Zur Burg.« Sie wandte den Kopf und sah zu der Turmspitze hinauf, die in der Ferne gerade noch über die Baumwipfel hinausragte.
»Zur Burg?« Tills zwei Stimme schnappte vor Erstaunen über. »Zur Burg Hohenkamp?«
»Ja, zur Burg Hohenkamp.« Liliane sah Till eins nachdenklich an. »Sie heißen auch Hohenkamp«, stellte sie noch einmal fest. »Meine Großmutter erzählte mir öfter von einem Cousin, mit dem sie als Kind gespielt hatte. Er hatte solches Haar wie Sie, erinnerte sie sich. Sie hatte ihn später ganz aus den Augen verloren und dies sehr bedauert. Sie liebte ihn sehr. So sagte sie mir. Meine Großmutter hieß mit ihrem Mädchennamen auch Hohenkamp.«
»Ja, gibt’s denn das?« wunderte sich Till eins. »Haben wir hier ein Verwandtentreffen veranstaltet? Wenn Sie von einem Cousin sprechen, einem Cousin Ihrer Frau Großmutter, auch Hohenkamp mit Namen und einem Feuerschopf wie dem meinen, dann kann es sich doch nur um meinen Großvater handeln – gehandelt haben.«
»Er hieß auch Till«, erinnerte sich Liliane.
»Till der Große! So nannten wir ihn. Er war zwei Meter hoch, aber nicht nur groß an Gestalt.« Till drückte den Jungen kurz, aber innig an sich. Ein liebevoll mitleidiger Blick auf das Kind, einige Sekunden Pause, dann fuhr Till fort, aber seine Stimme schien jetzt nicht ganz fest zu sein: »Wenn wir einander vor ein paar Monten begegnet wären, hätte ich ihn noch fragen können. Jetzt bin ich Hans-Friedrichs Vormund.«
Mit diesem einen kurzen Satz war sehr viel gesagt.
Er ist allein wie ich, dachte Liliane, hat wahrscheinlich nur den Jungen, so wie ich Lili habe, und sonst niemanden mehr auf der Welt.
Sie sah den scheuen Blick, den das Kind, anscheinend ganz ungewohnt, Hans-Friedrich genannt zu werden, auf den Bruder heftete.
Irgendwie schien sich das Leben für ihn zu verändern, empfand der kleine Till. Das hatte schon mit dem Tag begonnen, da sie ihren abgöttisch geliebten Großvater verloren hatten, der ihnen Vater und Mutter, eine ganze Familie ersetzt hatte. Der große Till hatte dann wie ein Löwe um die Vormundschaft über den Kleinen gekämpft und sie auch erhalten.
Seither waren sie ganz und gar unzertrennlich, die beiden Brüder. Till schmuggelte sogar den Kleinen in die Abendvorlesungen in die Hochschule hinein – er konnte sie nur am Abend weiterbesuchen, bei Tag arbeitete er in einem Büro, um für sich und den kleinen Bruder einen besseren Lebensunterhalt zu verdienen. Dort saß dann Hans-Friedrich mit schmunzelnd wohlwollender Miene von Tills Kollegen betrachtet, nicht auf, sondern unter der Bank, von wo ihn Till öfter schon schlafend am Ende der Vorlesung hervorzog.
»Hallo! Noch weit bis zur Burg?« kam von der Straßenmitte eine Stimme.
Sie wandten sich alle um und staunten den Radfahrer an, der seinerseits die Gruppe bestaunte. Das hätte er besser nicht getan. Ein Buckel, eine Rinne – und da lag der kühne Sportler, der anscheinend bis jetzt die Steigerung der Straße nicht neben, sondern auf dem Fahrrad bewältigt hatte.
Der kleine Till stürzte hilfsbereit auf ihn zu und hob erst einmal das Fahrrad auf, unter das der junge Mann zu liegen gekommen war.
»Haben Sie sich weh getan?«
Statt einer Antwort auf diese Frage stellte der Mann fest:
»Bis gestern hat mein Gehirn noch richtig funktioniert. Solle sich das geändert haben?« Er sah zwischen dem großen und dem kleinen Till hin und her. Als dann noch Liliane mit Lili neben ihm auftauchte, blieb er einfach auf der Straße sitzen.
»Da spukt’s!« stellte er fest. »Läuft hier jeder in einer großen und einer kleinen Ausgabe umher? Aber es ist doch noch heller Tag und keine Geisterstunde. Und daß sich Gespenster außerhalb ihres sonst gewohnten Bereiches aufhalten, habe ich auch noch nicht gehört. Oder sollten Sie vielleicht doch Gespensterbeziehungen zur Burg haben, die hier irgendwo in der Nähe sein soll?«
»Es scheint, wir haben sie alle«, lächelte Liliane. »Wir sind nämlich auch auf dem Weg zur Burg hinauf.«
»Sie auch?« wunderte sich der junge Mann und bequemte sich endlich, aufzustehen. »Wenn ich wirklich in keine Geistergesellschaft geraten bin, dann darf ich mich vielleicht vorstellen: Heino von Hohenkamp mein Name.«
»Mach den Mund zu, Hans-Friedrich!« mahnte Till. »Man staunt höchstens mit den Augen.«
»Warum staunst du, mein Junge?« wollte Heino wissen.
»Stell dich vor, Hans-Friedrich!« befahl der große Bruder.
»Till zwei von… Nein, Hans-Friedrich von Hohenkamp. Und das ist mein Bruder Till.«
»Und ich heiße Markus von Hohenkamp, aber ich will nicht zur Burg«, stellte dieser sich dem Radfahrer Heino vor.
»Obwohl Sie Hohenkamp heißen?« mußte Hans-Friedrich wieder staunen.
»Obwohl ich Hohenkamp heiße«, bestätigte Markus. »Ich fahre nur zu meinem Onkel, der kein Burgbesitzer ist.«
»Und ich bin auf dem Weg zur Burg, obwohl ich Liliane van Ruyk und nicht Hohenkamp heiße«, ergänzte Liliane.
»Und was sollen wir eigentlich alle auf der Burg?« erkundigte sich Heino.
Es stellte sich heraus, daß das keiner wußte. Sie alle hatten eine Einladung erhalten, das Wochenende – oder auch einige Tage darüber – auf Burg Hohenkamp zu verbringen, und unterzeichnet war diese Einladung mit »Tante Elisabeth«. Keiner von ihnen aber hatte jemals von einer Tante Elisabeth gehört.
»Ob das ein Aprilscherz sein soll?« mutmaßte Heino.
»Aprilscherz im Juni?« hielt Till dagegen.
»Ich glaube, am besten wäre es, sich an Ort und Stelle davon zu überzeugen, daß kein Scherz hinter dieser Einladung steckt. Sollte es aber doch der Fall sein, dann lade ich Sie alle zu meinem Onkel ein, damit Sie sich vor der Rückfahrt ein wenig erholen können«, schlug Markus vor. Sein Blick ging dabei zu Liliane.
»Ihr Onkel würde kaum Freude an einer solchen Invasion haben«, meinte Till, doch Markus lächelte nur dazu.
»Mein Onkel liebt junge Menschen. Ich habe ihm immer meine Freunde aus der Schule bringen dürfen, und wenn es noch so viele waren. Sein Haus ist groß genug. – Aber jetzt schlage ich vor, daß wir unseren Weg fortsetzen. Ich bringe Sie selbstverständlich zur Burg hinauf.« Diese Worten galten Liliane.
»Oh, das wäre wunderbar! Danke!« Die Augen der jungen Frau blickten ihn dankbar, fast innig an.
Markus wurde der Atem ein bißchen knapp. Er griff sich an den Hals, aber er hatte ja gar keine Krawatte genommen; er trug einen leichten Rollkragenpullover.
»Wenn Sie Ihren Drahtesel gegen meinen Esel vertauschen wollen«, lud Till Heino ein, aber dieser hatte Sportlerehrgeiz. Er dankte.
»Sie werden es bereuen!« prophezeite Markus.
»Ist’s so schlimm?« erkundigte sich Heino.
»Ich habe diese Straße noch nie in gutem Zustand kennengelernt. Und das letzte Stück zur Burg hinauf wird sogar Tills Esel, vermute ich, Schwierigkeiten bekommen.«
Heino wollte es trotzdem wagen, die Straße zu besiegen.
Markus war mit Liliane und Lili vorausgefahren, ein bißchen schnaufend und spuckend folgte ihnen der »Esel«. Den Abschluß bildete Heino, Till behielt den vermutlichen Vetter durch den Spiegel im Auge. Und als er nach einer Weile den Wagen anhielt und wartete, bis Heino nachgekommen war und dann stillschweigend das Fenster herunterkurbelte, griff der stolze Sportler ebenso gern wie wortlos nach der Fensterkante und ließ sich mitziehen, bis auch der liebe »Esel« streikte.
Markus, der die Tücken der sonst tatsächlich wunderschönen Waldstraße kannte, hatte nur auf diesen Augenblick gewartet. Er fuhr die Straße zurück, stieg aus, holte ein Seil aus seinem Wagen und befestigte es an Tills Auto. Blinzelnd schob Heino seinen Drahtesel heran und brachte ihn auf ein ermunterndes Lächeln von Markus im Kofferraum unter. Wohlig machte er sich dann neben Lili auf dem Rücksitz breit und streckte die schmerzenden Beine von sich, so weit es nur ging. So hielten Tante Elisabeths Gäste Einzug auf der Burg.
Sie sahen an den hohen, trutzigen Mauern hoch, an denen der Zahn der Zeit schon sein erhebliches Zerstörungswerk begonnen hatte, bis hinauf zu den Dächern, durch die an manchen Stellen der Himmel in die Dachkammern hineinschauen konnte. Und aus einer dieser ungeplanten Luken fuhr eben ein Kopf heraus – nein, das konnte doch wirklich nicht möglich sein! Till hatte das Gefühl, in seinem ganzen Leben nicht so viel Grund zum Staunen gehabt zu haben wie in der vergangenen Stunde.
»Mach den Mund zu, Hans-Friedrich!« glaubte er wieder den kleinen Bruder ermahnen zu müssen, doch dieser gab zurück: »Hast ihn ja selber auch offen gehabt, Till!«
Der Kopf in der Dachluke verschwand für Sekunden, man hörte eine aufgeregte Stimme: »Peter! Petra! Kommt schnell! Schaut euch das an!« Und dann fuhren gleich drei Köpfe aus der Luke, daß ein Stück Ziegel ausbrach, über das Dach kollerte und in den Hof fiel.
»He! Macht die Burg nicht kaputt!« rief Heino zu den dreien hinauf, dann griff er sich aber an den Kopf. »Nein! Ich sehe schon wieder doppelt!«
Eingerahmt von zwei Köpfen mit Haaren wie blauschwarze Rabenschwingen, neigte sich ein brandroter Pagenkopf weit vor, daß Till unwillkürlich schrie: »Nicht springen! Bis zu uns herunter ist’s zu tief!«
Ein dreifaches fröhliches Lachen antwortete, die Köpfe verschwanden aus dem Dach, wobei wieder ein Ziegel herabpolterte, dann gab es nach Sekunden irgendwo ein Getrappel von flinken Beinen, eine Tür flog auf, daß Heino glaubte, sie würden gleich bei ihnen, wie die Ziegel, im Hof landen – und da standen sie nun in voller Größe, die drei, denen die schwarzen und der rote Haarschopf gehörten: rechts, links zwei, groß, schlank, mit strahlendblauen Augen. Zwei Jungen? Zwei Mädchen? In ihrer Mitte ein kleines zartes Persönchen, das den Kopf schief geneigt hatte und keinen Blick von Till ließ, als ob es sonst niemanden hier gäbe. Das rote, seidigglänzende Haar umrahmte ein schmales Gesichtchen, aus dem übergroße grüne Augen schauten, über deren eigenartiger Schönheit man die vielen Sommersprossen auf dem feinen Näschen übersah.
Wie von ihm angezogen, ging Till auf das rothaarige Persönchen zu, während Heino noch immer kopfschüttelnd die beiden Schwarzköpfe betrachtete – besonders den einen, der ein so liebes, schalkhaftes Lächeln zeigte, als ob über das ganze feine Gesichtchen Sonne gebreitet läge.
»Ich bin Kathrin!« sagte der rothaarige Pagenkopf und fragte mit selbstverständlicher Natürlichkeit: »Und du?«
»Ich bin Till!« strahlte der große Junge.
»Und ich auch!« drängte sich der Kleine heran.
»Mein Bruder!« erklärte Till schnell, um nur ja kein Mißverständnis aufkommen zu lassen wie vorhin auf der Waldstraße.
Der schwarze Lockenkopf mit dem lieben Sonnenlächeln begann zu zählen.
»Sind wir jetzt alle? Nein, eine fehlt noch. Dafür aber ist einer zuviel!«
»Der bin ich! Leider!« sagte Markus.
»Er ist aber auch ein Hohenkamp!« ergriff Hans-Friedrich für ihn Partei. »Gehört er nicht zu uns?«
»Du bist lieb!« sagte Markus und drückte den Jungen an sich. »Nein, ich gehöre nicht zu euch. Vielleicht darf ich aber als Gast wiederkommen, wenn es die sagenhafte Tante Elisabeth gestattet.«
»Wieso sagenhaft? Wer zweifelt denn daran, daß es sie gibt?« fragte eine Stimme von der Tür her, aus der vorhin der Rotschopf und die beiden Schwarzköpfe gepoltert waren.
Sie wandten sich alle der Stimme zu, sahen eine schlanke Frau in einem eleganten Lodenkostüm unter dem Torbogen stehen, der von wildem Wein umwachsen war, das braune Haar von weißen Fäden durchzogen, glatt zu-rückgekämmt und zu einem schweren Knoten im Nacken zusammengefaßt. Das Gesicht mit den feinen Zügen ließ aber ahnen, wie schön diese Frau einst gewesen sein mußte.
Schön war sie eigentlich auch heute noch. Große braune Augen, in denen Wärme und Humor standen, beherrschten das Gesicht.
Mit einem lieben, ja, gütigen Lächeln betrachtete sie die Schar im Hof, und keiner konnte auch nur ahnen, was Elisabeth von Hohenkamp in diesem Augenblick dachte: Wie lieb sie alle sind! Wie glücklich ich bin, sie hier zu haben! Laß sie mich nicht enttäuschen, lieber Gott! Gib, daß diese Jungen hier nicht so sind, wie ihre Urgroßeltern waren!
Mit langsamen Schritten, die beinahe etwas feierliches Schicksalwendendes an sich hatten, ging sie auf die junge Generation zu, setzte zum Sprechen an, brachte aber zunächst kein weiteres Wort heraus. Was wußten sie denn alle, wie sie hier standen, was in ihr vorging? Schmerz, dessen Ursache nun schon so viele Jahrzehnte zurücklag, Bitterkeit, ja, noch immer und trotz allen Bemühens Bitterkeit, doch über allem Freude! Freude an den jungen Menschen vor ihr, die sie alle, ganz stumm geworden, unsicher und mit fast scheuen Augen betrachteten, ohne zu wissen, was ihnen das Sprechen genommen hatte. Vor dieser Frau mußte man Achtung haben, sehr große Achtung. Nur das spürten sie in diesem Augenblick.
»Kinder«, begann Elisabeth von Hohenkamp endlich, um dann, nach sekundenlanger Pause impulsiv fortzufahren: »Ich bin glücklich daß ihr da seid! Daß ihr alle gekommen seid, ohne zu wissen, warum ihr kommen solltet, ja, nicht mal zu wem. Alle! Ich kann es kaum fassen! Alle seid ihr gekommen. Zu einem Menschen, den ihr nicht kennt, bis heute nicht gekannt habt!«
»Doch, eine sagenhafte Tante!« mußte Heino sagen. Vielleicht sollte es ein bißchen keck klingen, um eine ihm ganz unverständliche plötzliche Rührung abzureagieren, aber die Stimme schwankte, und die Erklärung dafür kam gleich nach: »Ich verstehe es nicht, wie das möglich sein könnte, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber Sie…«
»Du«, verbesserte Tante Elisabeth.
».... du siehst meiner Mutter ähnlich. Du hast ihre braunen Augen mit den Goldpünktchen und die Nase und die Stirn mit den schmalen Augenbrauen. Sie war so schön – und so gut.«





























