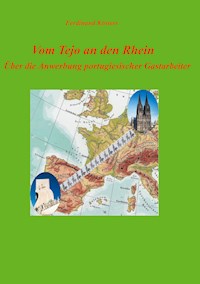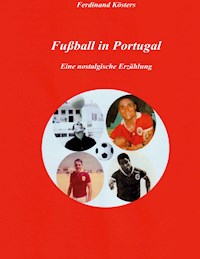
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Buch wird die Geschichte eines jungen Deutschen erzählt, über seine Erlebnisse als aktiver Fußballer in portugiesischen Fußballclubs und über seine Erlebnisse und seine Freundschaft mit dem berühmten portugiessichen Fußballstar Eusébio da Silva Ferreira, dem Torschützenkönig der Fußballweltmeisterschaft 1966 in England.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Söhne Rafael und Raimund und meine Enkel Antonio, Jona und Leon Ferdinand
Dank an meine Frau Rosemarie für manchen Verzicht
INHALT
Vorbemerkung
Happy Birthday to Eusébio
Beim Vitória Clube de Lisboa
In der „Primeira categoría“
Schulzeugnis für den Fußball
Benfica gegen Real
Final-Niederlage gegen Casa Pia
Interview mit einem Weltstar
Benficas schwärzeste Stunde
Begegnungen mit Eusébio
Als Spion verdächtigt
Wechsel zu Sport Lisboa e Olivais
Feste feiern
Schottische Begeisterung am Tejo: Celtic gewinnt den Europapokal
Die Hitzeschlacht im Jamor-Tal
Mit Eusébio in Deutschland
Letzte Saison bei Olivais: Drei Tore zum Geburtstag
Der Abschied
Träume am Kamin
Über den Autor
Nachtrag
Vorbemerkung
Diese Aufzeichnungen entstanden unmittelbar nach der Beendigung unseres Aufenthaltes in Portugal. Sie schildern daher zeitnah die Verhältnisse in den 1960er-Jahren. Damals herrschten andere Umstände als die, die uns heute so vertraut vorkommen. Es erscheint daher notwendig, auf die Verhältnisse der damaligen Zeit hier kurz einzugehen.
Es gab noch keine Europäische Union, seit 1957 bestand die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit den sechs Ländern Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg. Es existierten noch Staatsgrenzen und wenn wir mit dem Auto von Deutschland nach Portugal fuhren, mussten wir die deutsch-belgische, die belgischfranzösische, die französisch-spanische und die spanisch-portugiesische Grenze mit allen Grenz- und Zollkontrollen passieren. Für die Reise, die in der Regel drei Tage dauerte, brauchten wir Devisen in belgischen und französischen Francs, in spanischen Pesetas und in portugiesischen Escudos. Bestimmte Gegenstände durften nur in begrenzter Zahl mitgeführt oder mussten verzollt werden. Auch bei Flugreisen wurde man am Flughafen jeweils vom Zoll kontrolliert. Für einen längeren Aufenthalt in Portugal benötigten wir eine besondere Aufenthaltserlaubnis, die sogenannte „Residência“, die von der portugiesischen Geheimpolizei PIDE (Polícia International e de Defesa do Estado) ausgestellt wurde. Die PIDE war als geheime Staatspolizei nach dem Vorbild der Gestapo im nationalsozialistischen Deutschland aufgebaut worden.
In Portugal herrschte seit 1932 eine Diktatur unter dem Ministerpräsidenten António Salazar. Wir als Ausländer bekamen davon nicht allzu viel mit, obwohl wir manchmal das Gefühl hatten, beobachtet zu werden. Über unsere portugiesischen Freunde erfuhren wir hinter vorgehaltener Hand von den Untaten des Regimes, das Oppositionelle einfach verschwinden ließ.
Wir erhielten unser Geld in Portugal in Escudos, wobei es für eine D-Mark 7,2 Escudos gab. Portugal gehörte damals der europäischen Freihandelszone EFTA an, gewissermaßen ein Gegenpol zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Aber dennoch wurden ausländische Konsumgüter hier mit sehr hohen Zöllen belegt und wir hatten den Eindruck, dass für uns das Leben in Portugal teurer war als etwa in Spanien, wo ebenfalls eine Diktatur unter General Franco herrschte.
Das örtliche Telefonnetz war in Portugal, zumindest in den Städten, sehr gut ausgebaut. In Lissabon verfügte, anders als zur damaligen Zeit in Deutschland, fast jeder Haushalt über einen Telefonanschluss. Die internationalen Telefonverbindungen hatten allerdings noch Steinzeit-Format. Eine Verbindung nach Deutschland dauerte tagsüber meist etwa zwei Stunden, da die Verbindungen handvermittelt wurden. Kam die Verbindung zustande, hörte man in der Leitung die Stimmen der beteiligten Telefonistinnen in Spanien, Frankreich und Deutschland. Man wurde gewissermaßen „weitergereicht“.
Flugreisen nach Deutschland waren sehr teuer und entsprachen im Wert der Höhe eines Monatsgehalts. Es gab auch nur sehr wenige Direktverbindungen, oft musste man über Madrid, London, Nizza oder Genf fliegen.
Alle diese Einschränkungen hören sich an wie die Geschichten aus einer anderen Welt, aber damals waren die Verhältnisse so und man hätte sich nie vorstellen können, wie sich die Welt in den letzten Jahrzehnten verändern würde.
Happy Birthday to Eusébio
Im Hotel „Vale de Lobos“, etwa 30 Kilometer nördlich von Lissabon gelegen, gingen die Lichter aus. Die Musikband im großen Ballsaal spielte einen Tusch, und Eusébio da Silva Ferreira, der Torschützenkönig der Fußballweltmeisterschaft 1966 in England, blies mit einem einzigen Atemstoß 25 brennende Kerzen auf einer riesigen Geburtstagstorte aus, die mit einem aus Marzipan gegossenen Benfica-Wappen verziert war.
„Viva Eusébio!“ jubelte die Menge und brachte dem „berühmtesten lebenden Portugiesen“ ein Ständchen dar: „Felicidades!“ nach der bekannten Melodie „Happy Birthday to you“. Der Weltstar feierte seinen 25. Geburtstag.
Allerdings war dies nicht der 25. Januar, Eusébios wirklicher Geburtstag. An diesem Tage weilte der geplagte Starspieler mit seiner Vereinsmannschaft Benfica auf Tournee in Südamerika. So konnte er seine Freunde und Bekannten erst nach dieser strapazenreichen Reise einladen, und dass die Feier ausgerechnet in die Karnevalszeit fiel, erhöhte die Stimmung der Eingeladenen, aber auch die Spesenrechnung des Gastgebers. Karneval wurde auch in Portugal ausgiebig gefeiert.
Eusébio, zu dessen Freunden ich mich zählen durfte, hatte uns in das Hotel „Vale de Lobos“ eingeladen, in dem sich die portugiesische Nationalelf auf die Weltmeisterschaft in England vorbereitet hatte. In einem separaten Speisezimmer wurde zum Souper gebeten, an dem etwa 20 Personen teilnahmen. Mit von der Partie waren Eusébios Klubkameraden Mario Coluna, der „grande capitão“ der portugiesischen Nationalmannschaft, und Hilário, bei der Weltmeisterschaft 1966 als einer der besten Verteidiger der Welt gefeiert. Mit Perídis und Ferreira Pinto waren weitere aktive Fußballstars vertreten, die den Höhepunkt ihrer Laufbahn aber bereits überschritten hatten.
Nach dem opulenten Essen begab sich die Gesellschaft, in der meine Frau und ich die einzigen Ausländer und zusammen mit zwei anderen portugiesischen Ehepaaren die einzigen Weißen waren, in den vom närrischen Volk gefüllten Ballsaal, wo ein Tisch für Eusébio reserviert war. Hier durfte dann auf Eusébios Rechnung getrunken und zu späterer Stunde nochmals gegessen werden, was das Herz begehrte.
Nach dem Geburtstagsständchen des Volkes für seinen Fußballkönig Eusébio spielte die Kapelle zum Tanz auf. Zwischendurch sangen einige der bekanntesten Fado-Sänger Portugals ihre hingebungsvollen folkloristischen Weisen. Der Tanz, der Alkohol, die ganze Stimmung im Saal steigerten die Ausgelassenheit, und immer wieder drängten sich mutige junge Damen vor, um mit Eusébio tanzen zu dürfen. Auch ich wurde von den hübschesten Portugiesinnen bedrängt, die es aber nicht auf mich abgesehen hatten, sondern beim Tanz oder an der Bar mich flehentlich baten, ihnen doch einen Tanz mit Eusébio zu vermitteln. „Berühmt müsste man sein“, aber dieser Gedanke wurde gleich wieder weggeweht angesichts des Rummels, den Männlein und Weiblein um den armen Eusébio machten.
Ich zog mich mit Coluna und meiner Frau an die Bar zurück, wo wir beim Whisky fachsimpelten. „Hier begann alles“ sagte ich und meinte damit den großartigen Erfolgsweg der portugiesischen Nationalelf, die 1966 erstmals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen und dabei sensationell den 3. Platz erobert hatte.
Erst am hellen Morgen, als die Milchhändler schon mit ihren Kannen klapperten, fanden wir den Weg nach Hause. Zuvor hatte uns Eusébio noch um 7 Uhr in der Frühe zu einem Whisky in seine Wohnung eingeladen und sich dabei sehr ungehalten über diejenigen gezeigt, die dieser Einladung zu dieser ungewöhnlichen Stunde nicht mehr gefolgt waren.
Beim Vitória Clube de Lisboa
Im Juni hatte ich in Madrid die Nachricht von meiner Versetzung nach Lissabon erhalten. Ich war hierüber hoch erfreut, denn die Tätigkeit, die ich dort auszuüben hatte, war ortsgebunden. Die lästige Reiserei, die mich zwar durch ganz Spanien in fast alle größeren Städte dieses Landes geführt hatte, die aber infolge der Reisebedingungen, insbesondere der klimatischen Verhältnisse, ungeheuer strapazierend war, würde damit beendet sein. Außerdem bot die auch ansonsten schönere Stadt Lissabon auch etwas, was man in der Sommerhitze der kastilischen Hochebene beinahe schmerzhaft vermisste: Wasser! Das Meer, der Atlantik mit seinen vielen Stränden in der Umgebung der portugiesischen Hauptstadt versprach auch während der heißesten Tag Abkühlung. Für uns sonnenhungrige Mitteleuropäer winkte nunmehr gewissermaßen jedes Wochenende Urlaub.
Es dauerte einige Zeit, bis ich mich an das fremde Land und die neue Umgebung gewöhnt hatte. Zunächst gab es in unserer völlig neu und aus dem Nichts heraus eingerichteten Dienststelle soviel Arbeit, dass ich froh war, an den freien Wochenenden mit meiner Frau und mit Kollegen und bald auch mit portugiesischen Freunden ans Meer flüchten zu können. In der übrigen Freizeit machten wir uns auf zu Entdeckungsfahrten, denn wir wollten ja möglichst viel von unserem neuen Wohnort kennenlernen.
Die ersten Wochen wohnten wir im Hotel, wo wir mit unserem Spanisch ganz gut zurecht kamen. Bekanntlich verstehen die Portugiesen die Spanier, umgekehrt verstehen die Spanier nicht das etwas fremd und eigenartig klingende Portugiesisch. An Fußball dachte ich erst wieder im Spätsommer, als wir eine Wohnung gemietet und uns an den Lebensrhythmus und die Lebensgewohnheiten unserer neuen Umgebung angepasst hatten.
Wie in Spanien, so informierte ich mich auch hier erst einmal aus der Presse über die portugiesischen Fußballverhältnisse. Weltberühmt war der zweifache Europapokalsieger Benfica Lissabon, dessen Name richtig „Sport Lisboa e Benfica“ lautete. Die Namen der Benfica-Stars waren auch dem deutschen Fußballfreund geläufig: Eusébio, Coluna, Costa Pereira, Germano, Cavem, Cruz, Simões, Torres, José Augusto, Santana. Benfica hatte gerade ein glänzendes Double geschafft und war Meister und Pokalsieger geworden.
Der andere große Verein war Rekordmeister Sporting Clube de Portugal, der mit seinem Sieg im Europapokal der Pokalsieger einen großen Triumph gefeiert hatte. Die Rivalität der beiden Vereine entsprach der zwischen Real und Atletico in Madrid. Beide Clubs verfügten über eine riesige Mitgliederzahl. Sporting hatte etwa 25 000 Mitglieder und Benfica brachte es auf nahezu 40 000 „sócios“. Mir war klar, dass ich mich einem solchen Verein nicht würde anschließen können, zumal beide, sowohl Benfica wie auch Sporting, nur zwei Profi-Seniorenmannschaften und je eine Junioren-, Jugend- und Schülermannschaft am Spielbetrieb teilnehmen ließen. Für mich kam also nur ein kleinerer Verein in Frage.
Ein Kraftfahrer unserer Dienststelle, dem ich gesagt hatte, wie gern ich wieder Fußball spielen möchte, fuhr mich eines Tages zu einem Fußballplatz im Ortsteil Picheleira. Es war einer jener typischen Plätze, wie ich sie auch von Spanien her kannte. Hartplatz, graue, karge Zuschauerwälle, eine Umkleidekabine aus Stein, weißgekalkt, ein Lichtmast für das Wintertraining im Dunkeln. Aber jetzt war noch alles vom Sonnenlicht grell überflutet, so dass mir die Augen schmerzten. Der Platzwart zeigte mir die Installationen, es war alles fein säuberlich aufgeräumt. An einem Regal voller blank gewienerter Schuhe erkannte ich einige Namen: Jorge, Lopes, José, Roque. Ob hier auch bald mein Name prangen würde? Ob ich überhaupt in einer solchen Mannschaft bestehen könnte? Immerhin spielte der Verein mit Namen Vitória Clube de Lisboa in der dritthöchsten portugiesischen Klasse, der 1. Division des Fußballverbandes Lissabon. Ich dachte nach und beschloss schließlich, mir das Training der Mannschaft einmal anzusehen.
Mein erstes Training nach vielen Monaten fiel mir sehr schwer. Trainer der Mannschaft war ein sympathischer blonder Portugiese, der etwas Englisch sprach, weil er früher einmal zur See gefahren war. In der Glut des sich der Nacht zuneigenden Tages floss bei mir der Schweiß in Strömen. Aber den Mitspielern erging es ebenso, und das war ein Trost für mich.
Meine fußballerischen Leistungen schienen bereits an diesem ersten Tage Eindruck gemacht zu haben, denn der Trainer lud mich sogleich für ein Trainingsspiel ein, das am folgenden Sonntag gegen die Nachwuchsmannschaft des Europapokalsiegers der Pokalsieger, Sporting Lissabon, ausgetragen werden sollte.
Auf der Rückfahrt vom Training, dem mein Kollege, unser Kraftfahrer Senhor Melo, zugeschaut hatte, meinte dieser, am Abend würde es sich wie ein Lauffeuer durch die Straßen Picheleiras verbreiten, dass sich bei Vitória ein Deutscher angemeldet habe. Die Sensationsmeldung für diesen vom pulsierenden Zentrum Lissabons weit abgelegenen Vorort, in dem sich niemals Touristen verlaufen, würde an diesem Abend von Mund zu Mund gehen: „O Vitória têm um Alemão (Vitória hat einen Deutschen)“.
Die Begegnung mit Sporting war für Sonntag um 11 Uhr vorgesehen. Um 10 Uhr sollte bereits Treffpunkt sein, und so machte ich mich mit meiner Frau schon früh auf den Weg nach Picheleira. Aber wir trafen auf dem Sportplatz niemanden an, weil wir uns infolge noch bestehender Sprachschwierigkeiten um eine Stunde vertan hatten. Portugal hatte die Uhrumstellung zur Sommerzeit kurzfristig abgeschafft und dies über die Radiosender verkündet. Da wir kein Radio hörten, hatten wir dies auch nicht erfahren. Wir nutzten nun diese Zeit, indem wir etwas durch dieses Stadtviertel bummelten. In einem der auch am Sonntag geöffneten Lebensmittelgeschäfte, auf die der Ausdruck Krämerladen besser zutraf, beobachteten wir, wie einem zuvor noch quicklebendigen Huhn, das gerade verkauft werden sollte, der Hals herumgedreht wurde. Das war kein angenehmer sonntäglicher Auftakt.
Endlich war es soweit. Die Kameraden trafen alle rechtzeitig ein und unser Trainer verteilte die Trikots. Das schien in Portugal eine geheiligte Zeremonie zu sein. Strümpfe, Schuhe und Hosen nahm sich jeder selbst, die Ausgabe der Trikots war dem Trainer, der meist „Mister“ genannt wurde, vorbehalten. Dabei bemerkte ich eine Besonderheit. Im Gegensatz zu uns in Deutschland, wo die Stutzen „fußlos“ waren, hatten die Strümpfe hier auch „Füße“.
Ich erhielt das Trikot mit der Nummer 12, was bedeutete, dass ich erst in der 2. Halbzeit zum Einsatz kommen würde. Die erste Spielhälfte verbrachte ich auf der Reservebank, und unser Trainer gab uns Handtücher, mit denen wir uns gegen die stechend heiße Sonne schützen konnten.
Nach der Pause kam es für mich zum Debüt in einer portugiesischen Mannschaft. Ich spielte Mittelstürmer und versuchte durch Rochieren und Zurückweichen meinen Gegenspieler Lino, einen Juniorennationalspieler, mürbe zu machen. Zweimal hatte ich eine Torgelegenheit: das erste Mal bei einem Dribbling aus dem Mittelfeld heraus, das zweite Mal bei einem Zuspiel von hinten. Dabei täuschte ich meinen Gegner nach links an, schob den Ball aber rechts an ihm vorbei und hätte dadurch freie Bahn zum Tor gehabt, wenn nicht einige Minuten zuvor ein kühlender Gewitterregen niedergegangen wäre, der den Platz aufgeweicht hatte. So blieb der Ball im Morast stecken.
Wir verloren das Spiel nur knapp mit 1:2, was ein äußerst achtbares Ergebnis war, denn zuvor hatte man von einer Niederlage mit fünf bis sechs Toren Unterschied gesprochen. Der Wimpel und die Vereinsnadel, die ich nach dem Spiel erhielt, blieben eine schöne Erinnerung an diesem für mich denkwürdigen Tag.
Mein Kollege Melo hatte sich während und nach dem Spiel umgehört und die Meinung der Zuschauer eingefangen. Besonders aufgefallen war mein Laufpensum, und die Zuschauer hatten gemeint: „O Alemão não pare“, was soviel bedeutet wie „Der Deutsche steht nicht herum, sondern ist dauernd in Bewegung“. Mir war allerdings klar, dass ich bei dieser Spielweise nur für eine Halbzeit ausreichend Kondition hatte, so dass mir im Training noch sehr viel Arbeit bevorstand.
Zunächst musste ich für meine Spielerlaubnis sorgen. Ich unterschrieb im vereinseigenen Klubheim von Vitória, dessen Trainer Ricardo Ferraz da Costa zugleich der Direktor des Klubs war, eine Unmenge Formulare. Dann musste ich eine Geburtsurkunde vorlegen und eine Bescheinigung meiner Dienststelle über die Art der Beschäftigung und die Höhe meines Einkommens. Mehrere Passbilder und die Ablichtung meiner Aufenthaltserlaubnis gehörten zu den weiteren Unterlagen, die der Verein benötigte, damit ich in Meisterschaftsspielen eingesetzt werden konnte.
Vitória Clube de Lisboa, eine Fusion aus Palmeiras und Picheleira Clube de Futebol, forderte über den Regional- und Nationalverband meine Spielerunterlagen in Spanien an. Ich selbst wandte mich schriftlich an den Vorsitzenden meines früheren Vereins Agrupación Deportivo de AEG in Madrid mit der Bitte, für eine schnelle Übersendung der Unterlagen Sorge zu tragen, was er mir in einem Antwortbrief versprach. Schließlich waren er und ich nach der langen Transfer-Wartezeit in Spanien gewarnt. Aber wiederum vergingen einige Wochen, ohne dass etwas geschah.
(Anmerkung: In Spanien hatte der Spanische Verband es versäumt, meine Freigabe beim Deutschen Fußballbund rechtzeitig zu beantragen, was zu einer monatelangen Verzögerung geführt hatte.)
Portugal verfügte über eine 1. Profiliga mit lediglich 14 Vereinen. Nur vier Klubs in diesem Lande waren jemals Meister geworden: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon, der FC Porto und Beleneses Lissabon, der Verein des einstigen Wunderstürmers Matateu.
Die 2. Division war in eine Nord- und Südgruppe unterteilt. Darunter gab es die Ligen der 16 Regionalverbände, von denen die größten bis zu drei Spielklassen mit mehreren Gruppen hatten. Dazu kamen noch die Amateurvereine, die nur im Sommer spielten. Schließlich musste auch noch eine Vielzahl von Betriebsmannschaften und privaten Teams hinzugezählt werden, die über eine eigene Organisation verfügten, aber nicht dem Verband angehörten.
Der Vereinspokal wurde hier genau wie in Spanien nur zwischen den Profiklubs der 1. und 2. Liga ausgespielt, und ebenfalls in Hin- und Rückspielen, so dass auch in diesem Wettbewerb die „Großen“, wie Benfica und Sporting, den Ton angaben. Den ersten Pokalgewinn hatte allerdings eine Mannschaft aus der Provinz erzielt, der Studentenverein Académica de Coimbra. Da dieses Pokalsystem zu einer gewissen Sterilität führte, forderte man immer stärker, vor allem seitens der Presse, diesen Modus zu ändern und wie in England nur ein Spiel pro Runde einzuführen, wodurch der Reiz des Wettbewerbs ohne Zweifel erhöht würde.
Eine besondere Note erfuhr der Vereinspokal auch dadurch, dass die jeweiligen Pokalsieger der portugiesischen Überseeprovinzen in den Wettbewerb eingreifen durften. Da diese Mannschaften aus Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guinée, Madeira oder von den Azoren aber oft das Geld für die weite Reise ins Mutterland fehlte, verzichteten sie fast immer auf die Teilnahme. Wenn dennoch einmal einer dieser Klubs teilnahm, verlor er gegen die Vertreter aus Europa meist recht eindeutig.
Interessant war auch, dass mit Ausnahme der ersten beiden Ligen das Auswechseln eines Spielers bis zur 44. Minute erlaubt war. Der Torwart durfte sogar während des ganzen Spiels ausgewechselt werden. Zu dieser Zeit stritt man sich in Deutschland noch um den Spieleraustausch, weil man befürchtete, ein Verein könnte damit eine Unsportlichkeit begehen, indem er einen Spieler auswechselte, der nicht ernsthaft verletzt war.
Während ich auf meine Spielerlaubnis wartete, trainierte ich wie ein Besessener. Nach dem allgemeinen Training legte ich noch zusätzliche Spurts bis zu 50 Meter ein, um körperlich voll da zu sein. Mein Spielverständnis fand bei unserem Trainer großen Anklang und es kam hin und wieder vor, dass er im Training das Spiel unterbrach, wenn ich ein taktisch kluges Spielverhalten, hauptsächlich ohne Ball, gezeigt hatte, um dies den anderen Mitspielern zu erläutern. Darüber freute ich mich jedes Mal riesig. Die portugiesischen Kicker erschienen mir sehr ballverliebt, übertrieben oftmals das Dribbling und sahen den frei stehenden Nebenmann nicht immer rechtzeitig. Das Spiel ohne Ball oder ein Spiel in den freien Raum schien ihnen völlig fremd zu sein. Zudem fiel mir eine fast schon übertriebene Härte auf, die oftmals die Grenzen zur Unfairness überschritt.
Beim Training hatte ich mir eine Verletzung an der Achillessehne zugezogen, die dadurch zustande gekommen war, weil wir mit Stoffturnschuhen trainiert hatten und nach dem Lauftraining mit diesen Schuhen auch Ball gespielt hatten. In Portugal gab es wegen hoher Schutzzölle keine Fußballschuhe der deutschen Marken adidas oder Puma. Ich war der Einzige, der über solche wertvollen „Treter“ verfügte.
Dann schien es endlich soweit zu sein. Vom spanischen Verband waren mein Spielerpass und die Freigabe gekommen. Mein Verein musste eine Ablösesumme von 500 Escudos zahlen, was einem Wert von etwa 70 D-Mark entsprach. Genau wie in Spanien stand auch in Portugal vor der Erteilung der Spielerlaubnis eine ärztliche Untersuchung. Zunächst kurvte ich mit einem Vorstandsmitglied durch die engen Gassen Picheleiras zum Fluss hinunter, wo ich von einem praktischen Arzt untersucht wurde. Dabei gewann ich einen Einblick in eine recht altmodisch eingerichtete Arztpraxis, in der vornehmlich Angehörige der unteren Bevölkerungsschichten behandelt wurden. Was ich im Laufe der Zeit, auch durch meine berufliche Tätigkeit, über das Medizinwesen in Portugal erfuhr, ließ mir oft das kalte Grauen kommen. Wie fortschrittlich lebten wir dagegen in unserem oft so geschmähten System in Deutschland, das wirklich zu den besten in der Welt gehörte.
Der privaten Untersuchung folgte eine offizielle im Medizinischen Zentrum des Portugiesischen Fußballverbandes. Auch hier wurde man mehr oder weniger als Mensch 3. Klasse behandelt, etwa bei der unwürdigen Abnahme der Urinprobe. Bei mir jedenfalls stellten die Ärzte, nachdem ich zwei volle Stunden zumeist mit Warten verplempert hatte, keine krankhaften Symptome, die ein Spielverbot zur Folge gehabt hätten, fest. So konnte es nach monatelangen Wartens endlich losgehen.
Es war mittlerweile November geworden, in dem auch in Portugal die Abende recht früh dunkeln. Da wir auf unserem Platz nur einen Flutlichtmast zum Trainingsbetrieb zur Verfügung hatten, versuchte der Vereinsvorstand, Trainingsspiele gegen Mannschaften abzuschließen, die über eine komplett beleuchtete Spielfläche verfügten. In der Woche, in der ich spielberechtigt wurde, hatte der Verein eigens für mich ein Spiel gegen die Juniorenmannschaft des Sporting Clube abgeschlossen.