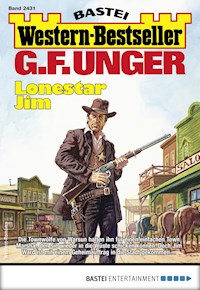
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western-Bestseller
- Sprache: Deutsch
Lonestar Jim
Die Townwölfe von Warsun halten ihn für einen einfachen Town Marshal, den sie wieder in die Wüste schicken können. Doch Jim Ward ist mit einem Geheimauftrag in die Stadt gekommen ...
Ein Western von einer Eindringlichkeit, wie sie nur ein Meister-Autor wie G.F. Unger vermitteln kann!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Lonestar Jim
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Salvador Faba/Norma
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8727-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Lonestar Jim
Sam Troop löst das Reserverad. Dann bückt er sich steif und holt den Hebebaum unter dem Wagen hervor. Er sieht sich nach einem Stein um und findet einen, der gewiss gut einen Zentner wiegt. Doch der alte Mann schleppt ihn noch ohne große Anstrengung. Er legt ihn sich zurecht, setzt den Hebebaum an und nickt seiner Tochter zu.
»Also, Jenny, nimm das verdammte Rad herunter, und setz das neue ein. Du wirst es schaffen – du bist so stark wie ein großer Junge. Los, Jenny!«
Und er drückt mit ganzer Kraft und seinem vollen Gewicht auf den Hebebalken. Er hebt den schweren Planwagen hoch, sodass das Vorderrad frei wird. Die Adern an seinem Hals treten hervor, und dann erzittern plötzlich seine Arme. Aus Mund und Nase kommt Blut. Der große alte Mann fällt, von der Hebelwirkung hochgeworfen, schlaff in sich zusammen.
Jenny braucht einen Augenblick, um das Schreckliche zu begreifen. Ihr Vater ist tot! Sie bedeckt ihr Gesicht mit beiden Händen. Ihre Schultern beben.
»Dad – o lieber Dad«, weint sie. Sie erinnert sich, dass er sich immer einen raschen Tod gewünscht hat. Und jetzt hat er ihn bekommen. Durch die Anstrengung muss dem alten Mann die Hauptschlagader geplatzt sein.
Jenny ist jetzt ganz allein – nur sie ist noch übrig von dem kleinen Wagenzug, der nach Warsun wollte. Und sie weiß, dass sie verloren ist, wenn sie hier untätig bei ihrem Vater sitzen und weinen würde. Sie muss handeln.
Als sie aufblickt, sieht sie fünf Comanchen-Krieger …
Jenny bückt sich langsam und zieht den Colt des Vaters aus dem Waffengurt. Sie bleibt in kniender Stellung und wartet.
Die fünf roten Reiter bewegen sich immer noch nicht.
Die tief stehende Sonne beleuchtet ihre nackten und mit Ocker und Kobalt beschmierten Oberkörper.
So starren sie sich eine Weile an – die fünf Krieger und das Mädchen. Jennifer stößt seufzend den Atem aus, und sie wundert sich, warum die Roten noch warten.
Schließlich schiebt sie den Colt in den Hosenbund, erhebt sich und ergreift die Schaufel. Sie beerdigt ihren Vater und häuft über dem Grab einen Hügel an. Dabei beobachtet sie unaufhörlich die fünf Indianer.
Plötzlich hört sie von Osten her den Hufschlag eines beschlagenen Pferdes. Der Wagen versperrt ihr die Sicht. Sie tritt deshalb vom Pferd weg und hinter das Ende des Wagens.
Und da sieht sie den Reiter kommen – einen Weißen, obwohl sein Gesicht fast so dunkel getönt ist wie ein unbemaltes Indianergesicht.
Aber er trägt die Tracht eines Weidereiters, und da sein Hut an der Windschnur auf seinem breiten Rücken hängt, sieht Jennifer das feuerrote Haar des Fremden in der Abendsonne leuchten. Es ist fuchsrotes Haar – und es leuchtet wie ein Signal.
Es ist ein großer, sehniger und hart wirkender Mann auf einem hässlichen Rappen.
Ganz langsam kommt er herangeritten und scheint die fünf Indianer gar nicht zu beachten.
Jennifer Troop weiß jetzt, warum die fünf Roten noch gewartet haben.
Sie seufzt etwas erleichtert, aber dieses Gefühl ist nur ganz kurz in ihr. Sie erinnert sich, dass der Wagenzug, den ihr Vater führte, von mehr als hundert Kriegern immer wieder angegriffen wurde, dass sie auf einer wasserlosen Ebene umzingelt wurden und dann in der Nacht einen Durchbruch machten. Und nur sie und ihr Vater konnten durchbrechen. Alle anderen Wagen blieben zurück als Beute der Roten.
Der fremde Reiter ist nun ganz nahe. Jennifer sieht in zwei klare, eisgraue und ruhige Augen.
Der Fremde hält an, hebt leicht die Linke und nickt.
Seine Stimme ist sanft und lässig.
»Nun, Junge«, sagt er, »diese fünf dort oben sind nur die Späher einer großen Kriegshorde. Selbst wenn du eine Goldladung im Wagen hättest, müsstest du alles zurücklassen. Das sind ehrgeizige Comanchen, die eine begonnene Arbeit richtig zu Ende führen. Wahrscheinlich werden sie nicht eher damit aufhören, bis sie auch uns erwischt haben. Setz dich aufs Pferd, Junge!«
Er reitet langsam auf die andere Seite des Wagens, sieht dort das Grab und das beschädigte Rad.
»War das dein Vater, Junge?«
»Yeah«, murmelt Jennifer, wendet ihm den Rücken zu und geht zu dem Pferd. Als sie aufsitzt, beobachtet sie der Mann, und er zuckt zusammen, weil er erst jetzt erkennen kann, dass sie ein Mädchen ist.
»Oh, bitte um Entschuldigung, Lady«, sagte er verblüfft und starrt sie verwundert an. Dann wischt er sich übers Gesicht und schüttelt leicht den Kopf. Sein Blick ist ernst und voller Wärme.
»Dieses Land ist hart zu Frauen«, murmelt er. »Aber Sie müssen alles zurücklassen, Miss. Es wird Nacht. Vielleicht entkommen wir der Bande. Reiten wir!«
Er setzt sein Pferd in Bewegung und wieder schenkt er den fünf Roten auf der Bodenwelle keinen einzigen Blick.
Jennifer Troop folgt ihm.
Bald reiten sie Steigbügel an Steigbügel nach Norden. Sie reiten viele Meilen.
Am Himmel sind kalte Sterne.
Irgendwo jagt ein Wolfsrudel in der Nacht.
Jennifer folgt dem Fremden, und sie verspürt das gute Gefühl eines festen Vertrauens in sich.
Als sie einmal rasten, um ihre Pferde verschnaufen zu lassen, sagt sie leise: »Ich bin Jennifer Troop, Mister. Wir wollten nach Warsun. Dort hat mein Bruder eine Frachtlinie errichtet, während mein Vater in Santa Fe noch wichtige Geschäfte abwickelte. Wir wollten in Warsun noch einmal neu beginnen, weil Vater auf dem Santa Fe Trail durch Banditen und Indianer große Verluste erlitt. Ja, wir wollten noch einmal neu beginnen – in einem neuen Land.«
»Es gibt überall Banditen, Indianer und Verdruss. Man muss überall kämpfen und für seine Rechte eintreten. Aber ich habe gehört, dass die Frachtzugtrecks auf dem Santa Fe Trail immer wieder vernichtet werden«, antwortet er.
Er dreht sich eine Zigarette und sieht in der Sternennacht auf das Mädchen nieder.
»Mein Name ist Jim Ward«, sagt er schließlich. »Ich bin ebenfalls nach Warsun unterwegs. Seltsamer Name für eine Stadt, nicht wahr? Kriegssonne! Nun, vielleicht sind Sie in drei Tagen bei Ihrem Bruder, Jennifer, wenn wir Glück haben. Sie sind ein tapferes Mädchen. Reiten wir! Ich muss unsere Fährte noch mehr verwischen, damit die roten Gentlemen morgen etwas zu tun bekommen. Wahrscheinlich werden sie uns den Weg verlegen wollen, und wir müssen einen großen Bogen schlagen. Nun, Jennifer …«
Er steckt die Zigarette an, und er schützt dabei das kleine Flämmchen so geschickt, dass man den Widerschein auf seinem Gesicht nur sehr schwach sieht.
»Ich wundere mich immer noch«, murmelt das Mädchen ernst, »dass es die fünf Krieger nicht allein versucht haben.«
»Sie kennen mich – sie kennen mich gut«, erwidert Jim Ward sanft. »Ich habe einige Herden von Texas nach Abilene gebracht, und dann habe ich Wagenzüge nach Kansas City und nach Fort Laramie geführt. Yeah, sie kennen mich gut.«
Er drückt die Zigarette aus und tritt an sein Pferd.
Auch Jennifer sitzt auf.
Bevor sie jedoch anreitet, fragt sie: »Und was führt Sie nach Warsun, Jim Ward?«
»Die Stadt hat mich angeworben. Ich habe einen Vertrag mit der jungen Stadt. Ich bin der neue Marshal. Und ich habe noch einen Namen: Man nennt mich auch Lonestar Jim.«
Das Mädchen macht einen schnellen Atemzug.
»Ich habe einige Legenden von Ihnen gehört, Jim«, murmelt sie. »Sie sollen ein einsamer Wolf sein, der sich immer wieder einen Stern ans Hemd steckt und ganz allein für eine Sache kämpft. Sie sollen so einsam unter den Männern sein, Jim, wie ein einzelner Stern am Himmel. Sie sind also Lonestar Jim!«
Sie sieht, wie im Sternenlicht seine weißen Zähne aufblitzen.
☆☆☆
Sie reiten die ganze Nacht und den halben Tag. Dann verbergen sie sich und schlafen bis zur Dunkelheit.
Sie reiten dann nochmals eine Nacht und tauchen in eine enge Schlucht ein.
Hier ist Wasser, etwas Gras, und Büsche und Felsen geben immer wieder Deckung und Schutz.
Das Mädchen schläft nach einer kalten Mahlzeit sofort ein. Die Tage im Sattel wären auch für harte Männer genug gewesen. Ihre Pferde sind sehr erschöpft.
Als Jennifer Jim Wards Hand auf der Schulter spürt, öffnet sie die Augen.
Sie will etwas fragen, aber die Hand liegt nun auf ihrem Mund.
Jim Ward liegt dicht neben ihr und flüstert kaum hörbar: »Ruhig bleiben, Jenny, sie haben uns gestellt. Es sind unsere fünf alten Freunde. Aber heute werden sie versuchen, uns aufzuhalten, damit wir der großen Kriegshorde nicht entkommen. Wir müssen kämpfen, Mädel.«
Erst nach diesen Worten nimmt er seine Hand von ihrem Mund.
Jennifer erschaudert leicht. Dann setzt sie sich langsam auf.
Es ist Spätnachmittag.
Zwischen zwei Felsen hindurch kann das Mädchen ein Stück der Schluchtsohle übersehen, aber dort ist nirgendwo Bewegung.
Hinter ihr, in einer Aushöhlung der Schluchtwand, bewegen sich leise die beiden erschöpften Pferde.
Das Mädchen hebt den Blick und sucht den oberen Rand der gegenüberliegenden Schluchtwand ab.
Und da sieht sie den aufsteigenden Rauchpilz.
Jim Ward kauert immer noch neben ihr.
»Yeah, das ist es«, sagt er sanft. »Sie haben herausbekommen, dass wir hier in der Schlucht stecken. Einer ist auf die jenseitige Hälfte des Plateaus geklettert und gibt dort Rauchsignale, damit die Horde sich mehr beeilt. Und die anderen vier stecken irgendwo hier in nächster Umgebung. Jenny, haben Sie Angst?«
Sie sieht den Mann kurz an, und sie begreift plötzlich, welch ein furchtloser Kämpfer er ist. Obwohl er ernst und angespannt wirkt, strömt eine starke Zuversicht von ihm aus.
Es kommt ihm wahrscheinlich nie in den Sinn, denkt sie, dass er einmal unterlegen sein und getötet werden könnte.
Eine feste Zuversicht ist plötzlich in ihr.
Sie schüttelt den Kopf und beantwortet seine Frage: »Jim, Sie sind bei mir, wie könnte ich da Furcht haben! Und ich bin mit der Waffe vertraut.«
Sie ergreift den Waffengurt des Vaters und hängt ihn sich schräg über die Schulter, sodass der Kolben der Waffe wie aus einem Schulterholster zwischen Arm und Rippen sichtbar und greifbar ist.
Jim Ward rollt schnell die Decken zusammen.
Gebückt gleiten sie zu den Pferden.
Das Mädchen sieht sofort, dass die Tiere bereits gesattelt und reitfertig sind. Dies muss Jim Ward getan haben, als sie noch schlief.
Jim schnallt die Decken hinter dem Sattel fest.
»Wir müssen also hier raus, bevor die ganze Bande hier angelangt ist. Nehmen Sie die Pferde rechts und links kurz an den Zügeln. Bleiben Sie immer zwischen den Tieren in Deckung. Ein Indianer tötet nur ungern ein Pferd, denn es ist für ihn immer der höchste Besitz. Folgen Sie mir in zwanzig Schritten Abstand, Jenny! Jetzt!«
Er zieht mit einem schnellen Griff sein Gewehr aus dem Sattelschuh, nimmt es in die Linke und geht davon.
Er hat einen leichten und gleitenden Schritt. In den Schultern ist er sehr breit, aber in den Hüften schmal. Seine Beine sind lang und leicht gekrümmt. Sein schwarzer Stetson hängt wieder auf seinem Rücken. Und das rote Haar leuchtet wie ein Fanal.
So geht er davon.
Das Mädchen schluckt schwer, nimmt die beiden Pferde kurz an den Zügeln und folgt dem Mann.
So kommen sie aus der Felsgruppe heraus und wenden sich auf der Schluchtsohle nach rechts.
Jennifer behält ständig den Mann im Auge, und sie kann erkennen, wie wachsam und lauernd er sich bewegt.
Wie ein schleichender Wolf oder ein Tiger, denkt sie, und sie wundert sich, dass er nur wenig den Kopf bewegt.
Die Schlucht geht plötzlich in einen Canyon über, der mit Felsgruppen, Waldinseln und viel Buschwerk angefüllt ist. Ein silberner Creek sucht sich seinen Weg.
Die Hänge steigen in Terrassen an, und der Wald reicht bis hinauf zu den oberen Rändern.
Irgendwo ertönt die Stimme einer Wachtel.
Jim Ward, der sich in diesem Moment noch inmitten der Schluchtmündung befindet, springt plötzlich wie ein Hirsch vorwärts und in den Canyon hinein. Dann hechtet er über einen hüfthohen Felsbrocken hinweg und verschwindet raschelnd in einem Busch.
»Bleib in der Schlucht!«, klingt seine Stimme scharf zu Jennifer herüber.
Und das Mädchen hört plötzlich das scharfe Zischen einiger Pfeile, und die Kugel eines Sharps-Gewehrs schlägt an die obere Kante des Felsbrockens.
Das Mädchen drängt die Tiere gegen die Felswand der Schlucht, beobachtet jedoch weiterhin gespannt die Dinge im Canyon.
Die Schluchtmündung liegt wie eine Bühne vor ihr – und in dem Canyonausschnitt, der gewissermaßen den Hintergrund der Bühne bildet, spielt sich nun alles ab.
Die Pfeile zischen immer noch scharf, man hört es ganz deutlich. Sie fahren von drei verschiedenen Seiten immer wieder in den Busch hinein, in den Jim Ward über den Stein hinweg hechtete.
Von weiter oben am Rand des Canyonhanges kracht in kurzen Abständen das Gewehr.
In Jennifer steigt plötzlich die heiße Furcht auf, dass Jim Ward schon getroffen worden ist.
Sie stößt einen leisen Ruf aus, lässt die Pferde los und nimmt die neue Winchesterbüchse des Vaters aus dem Sattelfutteral.
Als sie damit die Deckung der Pferde und der Schluchtwand verlassen will, hört sie die scharfen Schüsse von Jims Winchester. Es sind drei Schüsse, die ungewöhnlich schnell hintereinander folgen.
Und nach dem dritten Schuss ertönt ein schriller Schrei, der jäh abbricht.
Dann ist es still.
Jennifer zögert einen Moment, dann bewegt sie sich schnell und erreicht das Ende der Schlucht. Bevor sie sich hier dicht an der Felswand hinter einen Stein kauern kann, singt pfeifend eine Kugel heran und schlägt dicht neben ihrem Kopf gegen die Wand.
Steinsplitter verletzen sie leicht an der Wange. Sie spürt das Blut – aber sie kauert nun hinter einer guten Deckung und schiebt den Gewehrlauf über den Stein.
Nochmals schlägt eine Kugel über ihr gegen die Felswand. Der Schütze muss sich ihr genau gegenüber auf der mittelsten Terrasse des Canyonhanges befinden.
Plötzlich hört sie wieder Jim Wards Winchester bellen – zweimal kurz hintereinander.
Oben auf der Terrasse taumelt ein Roter hinter einem Baum hervor und dreht sich halb zur Seite.
Bevor er wieder in Deckung springen kann, aus der ihn der Schmerz einer Verwundung trieb, kracht Jim Wards Gewehr schon wieder.
Der Comanche fällt kraftlos zusammen.
»Oh!«, seufzt das Mädchen, und dann sieht sie Jim Ward aus dem Busch kommen.
Geduckt gleitet er leichtfüßig über den Boden. Er hat sein Gewehr zurückgelassen und hält nur den Colt in der Hand.
Pfeile schwirren an ihm vorbei und bohren sich irgendwo in den Boden.
Die beiden Bogenschützen befinden sich nicht in Jennifers Blickfeld.
Aber sie sieht, wie Jim Ward plötzlich anhält, auf ein Knie fällt und in rasender Folge seinen Colt leert. Es ist kaum eine Pause zwischen den einzelnen Schüssen.
Ein stöhnender Laut von irgendwoher ist zu hören.
Jim rollt sich über den Boden und findet hinter einem kleinen Baum dicht am Ufer des Creeks notdürftig Deckung. Aber es zischen keine Pfeile mehr heran.
Jennifer atmet befreit auf.
Sie begreift alles.
Dieser Mann ist furchtlos vor ihr in den Canyon gelaufen und hat darauf vertraut, dass die Indianer erst zu schießen beginnen, wenn auch das Mädchen mit den Pferden die Schlucht verlassen hat. Und damit sie es nicht tat und die Roten endlich ihre Stellungen verraten sollten, sprang Jim Ward plötzlich wie ein Hirsch davon und warf sich in einen Busch.
Und dann kämpfte er es aus.
Jennifer kann ihn einigermaßen beobachten. Sie weiß, dass er seinen Colt neu lädt.
Und sie muss seine Furchtlosigkeit bewundern. Er ist in Richtung der beiden letzten Gegner losgerannt. Er muss gewusst haben, dass sie ihm ihre Pfeile entgegenschicken würden.
Dennoch tat er es, bis er ihre Position genau erkannt hatte. Und dann war er schon so nahe, dass ihm sein Colt genügte.
»Lonestar Jim«, flüstert das Mädchen, »du bist wirklich ein Mann, der nur seinem Stern vertraut und ganz allein gegen jede Gefahr angeht.«
Sie beobachtet, wie er sich erhebt und mit dem Colt in der Hand zu jenem Busch zurückgeht, in dem er sein Gewehr ließ.
Er beobachtet dabei ständig die oberen Ränder der Schluchtmündung, die den steilen Hang des Canyons wie ein gewaltiger Riss durchbricht.
Erst als er den Colt geholstert hat und sein Gewehr wieder in den Händen hält, ruft er zu dem Mädchen hinüber: »Kommen Sie jetzt mit den Pferden, Jenny!«
Sie gehorcht.
Als sie bei ihm ist, sagt er schnell: »Weiter! Gehen Sie immer weiter mit den Tieren. Und warten Sie erst nach hundert Yards auf mich.«
Wieder gehorcht sie schweigend. Als sie sich einmal nach ihm umsieht, sieht sie, dass er rückwärts gehend folgt.
Lonestar Jim lässt die oberen Ränder der Schluchtmündung immer noch nicht aus den Augen und hält das Gewehr halb im Anschlag.
Das Mädchen denkt jetzt ebenfalls an den fünften Indianer, der oben auf dem Plateau ist und der dort das Signalfeuer angezündet hat.
Nachdem sie hundert Yards gegangen ist, hält sie mit den Pferden an.
Jim Ward geht jetzt seitwärts.
Und als er bei ihr ist, taucht auf dem Schluchtrand die Gestalt eines bemalten Kriegers auf. Er schüttelt drohend sein Gewehr – und verschwindet wieder.
Jim Wards Lächeln ist hart und bitter, als er das Mädchen ansieht.
»Reiten wir!«, sagt er. »Die Bande hat es tatsächlich fertig bringen können, uns den Weg nach Warsun zu verlegen. Aber jetzt schaffen wir die Sache. Wir haben Glück gehabt, Jenny.«
Sie sitzen auf und reiten davon.
Eine Stunde später öffnet sich der Canyon auf eine weite Ebene.
Sie reiten noch einige Meilen sehr schnell.
Dann kommt die Nacht und breitet wieder ihren schwarzen Mantel aus.
☆☆☆
Als die ersten Sonnenpfeile von Osten her zur Erde fallen, rasten sie auf der kahlen Wasserscheide eines Passes. Sie blicken in ein mächtiges Tal nieder, das von einer langen Hügelkette in zwei fast gleiche Hälften der Länge nach geteilt wird.
Am Südhang der langen Hügelkette, die das Tal in zwei Hälften teilt, liegt die Stadt Warsun.
Der Mann und das Mädchen blicken lange schweigend hinunter. Dann hebt Jim Ward die Hand und zeigt.





























