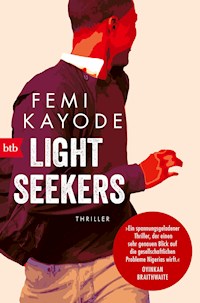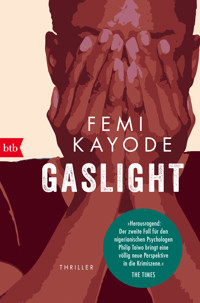
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Psychologe Dr. Philip Taiwo ermittelt
- Sprache: Deutsch
»Herausragend: Der zweite Fall für den nigerianischen Psychologen Philip Taiwo bringt eine völlig neue Perspektive in die Krimiszene.« The Times
Der forensische Psychologe Dr. Philip Taiwo ermittelt wieder in seiner Heimat: Bischof Jeremiah Dawodu ist das wohlhabende Oberhaupt einer nigerianischen Megachurch. Als seine junge Ehefrau verschwindet, wird Dawodu des Mordes an ihr verdächtigt und verhaftet. Die Festnahme findet sensationsheischend in aller Öffentlichkeit statt und bedeutet die maximale Bloßstellung für den mächtigen Kirchenmann. In ganz Lagos verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer – doch Bischof Dawodu beharrt auf seiner Unschuld.
Philip Taiwos Schwester ist Mitglied der Gemeinde und bittet ihren Bruder, den Namen des Bischofs reinzuwaschen. Taiwo hält zwar wenig von dieser Art streng hierarchischer Massenkirche, aber seiner Schwester zuliebe beginnt er zu recherchieren. Doch weder Behörden noch das Kirchenumfeld sind hilfreich bei den Ermittlungen. Hier wird mehr verschleiert als aufgedeckt. Wer will wem die Schuld in die Schuhe schieben? Als auch Taiwos eigene Familie bedroht wird, ist klar, dass die Drahtzieher vor nichts zurückschrecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der aus den USA zurückgekehrte Psychologe Philip Taiwo ermittelt wieder in seiner Heimat Nigeria: Bischof Jeremiah Dawodu ist das wohlhabende Oberhaupt einer Megachurch. Als seine junge Ehefrau verschwindet, wird Dawodu des Mordes an ihr verdächtigt und verhaftet. Die Festnahme findet sensationsheischend in aller Öffentlichkeit statt und bedeutet die maximale Bloßstellung für den mächtigen Kirchenmann. In ganz Lagos verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer – doch Bischof Dawodu beharrt auf seiner Unschuld.
Philip Taiwos Schwester ist Mitglied der Gemeinde und bittet ihren Bruder, den Namen des Bischofs reinzuwaschen. Taiwo hält zwar wenig von dieser Art streng hierarchischer Massenkirche, aber seiner Schwester zuliebe beginnt er zu recherchieren. Doch weder Behörden noch das Kirchenumfeld sind hilfreich bei den Ermittlungen. Es wird mehr verschleiert als aufgedeckt. Wer will wem die Schuld in die Schuhe schieben? Als auch Taiwos eigene Familie bedroht wird, ist klar, dass die Drahtzieher vor nichts zurückschrecken.
Femi Kayode wuchs in Nigeria auf, wo er Klinische Psychologie an der University of Ibadan in Lagos studierte, bevor er eine Karriere in der Werbebranche begann. Daneben hat er erfolgreich fürs Fernsehen gearbeitet. 2017 schloss er das renommierte Creative Writing Programm der University of East Anglia mit Auszeichnung ab. Nach seinem hochgelobten Debütroman »Lightseekers«, u. a. nominiert für den renommierten Gold Dagger Award, ist »Gaslight« der zweite Band um den nigerianischen Psychologen Philip Taiwo. Der Autor lebt mit seiner Familie in Windhoek, Namibia.
Femi Kayode bei btb
Lightseekers. Thriller
Femi Kayode
Gaslight
Thriller
Aus dem Englischen von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Gaslight« bei Raven Books/Bloomsbury Publishing PLC, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe November 2024
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Femi Kayode
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: ©Shutterstock / DC Studio
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
Redaktion: Eva Wagner
MK · Herstellung: KH
ISBN 978-3-641-25603-6V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Nneka.
Für den Raum
und alles darin.
Für die Liebe
und alles, was sie möglich gemacht hat.
Für immer.
Ursprung
Sie sollen ihn während des Sonntagsgottesdienstes holen.
Lass sie noch warten, während er an den Altar tritt. Während er sich vergewissert, dass die Kameras so platziert sind, wie er es während der Proben angeordnet hat. Lass ihm Zeit, ein paar unverständliche »Gebete« zu brabbeln. Ein paar Gemeindemitglieder werden in Ohnmacht fallen, und die Kirchendiener werden aufspringen, um sie aufzufangen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt.
Es steht eine Menge auf dem Spiel. Bischof Jeremiah Dawodu während seiner im Fernsehen übertragenen Predigt zu verhaften, ist kein Scherz. Das Timing und die Abfolge der Schritte sind von entscheidender Wichtigkeit, also halte dich bitte an den vereinbarten Plan.
Fang an mit meinem Verschwinden. Er dürfte allen erzählt haben, ich sei verreist, weil ich allein sein möchte. Lass die Polizei wissen, dass dies eine Lüge ist, die erklären soll, warum Anrufe an mein Handy auf die Mailbox geleitet werden. Wenn sie das als irrelevant abtun, dann mach sie darauf aufmerksam, dass der Fahrer mich nie abgeholt hat und mein Wagen noch in der Garage steht. Sie werden vielleicht behaupten, es sei noch nicht genug Zeit vergangen, um von einem Verbrechen auszugehen. Das ist in Ordnung. Sorg nur dafür, dass sie ins Haus kommen. Überlass den Rest mir.
Warte beim Sonntagsgottesdienst, bis er die Gemeinde aufgefordert hat, Platz zu nehmen. Warte, bis er die Zuschauer zu Hause an den Fernsehgeräten begrüßt und alle aufgefordert hat, ihre Bibeln an der Stelle aufzuschlagen, die er an diesem Tag zu missdeuten gedenkt. Je sicherer er sich ist, dass er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht – der Gesalbte des Herrn –, desto besser.
Er wird seine Empörung verbergen, wenn sie kommen. Seine Leibwächter werden herbeieilen, um ihren Mann Gottes zu verteidigen. Die Ältesten werden protestieren. Der eine oder andere wird die Polizisten beiseitenehmen und ihnen etwas anbieten. Lass sie gewähren. Das Ziel ist dann schon erreicht. Die unheilvolle Hand des Verdachts schwebt über dem Bischof.
Wenn sie ihn abführen, dann hoffentlich in Handschellen. Das sollte ihn Demut lehren. Es wird ihn daran hindern, in gespielter Gelassenheit zu winken und seine Kirche zu bitten, für ihn zu beten. Die Faust zu recken und zu erklären, dass der Teufel ein Lügner ist. Und wenn du das nicht erreichen kannst, macht es auch nichts. Von diesem Punkt an wirst du vieles nicht mehr in der Hand haben.
Die kommenden Wochen durchzustehen, wird nicht leicht sein, aber sorge dich nicht. Ich werde bei jedem Schritt an deiner Seite sein. Vertrau mir. Alles ist vorbereitet. Es ist an der Zeit.
Machen wir uns ans Werk.
Buch I
Der Gesamtdruck einer Mischung idealer Gase ist gleich der Summe ihrer Partialdrücke.
Daltonsches Gesetz
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen.
Johannes 1,5
Brüder und Schwestern
Ich kann den Blick nicht von der Gegenfahrbahn wenden. Von dem Stau, in dem wir nachher selbst feststecken werden. Mir graut jetzt schon davor.
»Kannst du wenigstens ein bisschen Interesse heucheln?«, sagt Kenny gereizt.
Ich wende mich vom Anblick des stehenden Verkehrs in Richtung Lagos ab. »Sehe ich etwa gelangweilt aus?«
Kenny beäugt mich von der Seite und zischt: »Wir sitzen jetzt schon fast anderthalb Stunden im Auto, und …«
»Zweiundachtzig Minuten, um genau zu sein. Aber ich kann mich nicht beklagen, da du ja Folake benutzt hast, um…«
»Ich habe niemanden benutzt!«
Ich bin immer noch beleidigt, weil sie sich an meine Frau gewandt hat, um meine Hilfe zu erbitten. »Und warum bist du dann nicht gleich zu mir gekommen?«
»Weil du mir jedes Mal, wenn es um die Kirche geht, das Gefühl gibst…«
»… eine verschrobene Eskapistin zu sein?« Ich hebe eine Augenbraue.
»Siehst du?« Sie funkelt mich an. »Deswegen habe ich mich zuerst an Folake gewandt.«
»Nein, Kenny Girl.« Sie hasst Dads Spitznamen für sie, sogar noch mehr, als ich es hasse, wenn er mich »Kenny Boy« nennt. »Du bist zu Folake gegangen, weil du weißt, dass ein Mord mir eine Steilvorlage liefert, um sagen zu können: ›Ich hab’s doch gleich gesagt‹.«
»Er hat seine Frau nicht ermordet«, flüstert Kenny und deutet mit einem Nicken auf den kahl geschorenen Kopf ihres Fahrers.
Ich schnaube verächtlich, senke aber dennoch die Stimme. »Das weiß doch jeder.«
»Aber nicht von mir.«
Ich atme ein – einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig – und wieder aus. »Er ist in diesem Moment so was wie der berühmteste Mordverdächtige der Welt.«
»Wobei die Betonung auf verdächtig liegt«, kontert Kenny.
»Dass du es nicht verstörend findest, wenn ein Pastor des Mordes verdächtigt wird, gibt mir schwer zu denken.«
»Da ist der Teufel am Werk. Warum sollte Bishop seine Frau umbringen? Nichts, aber auch gar nichts deutet darauf hin, dass sie tot ist. Es ist eine Verschwörung.« Sie schnalzt vernehmlich mit den Lippen. »Es gibt so viele Hater da draußen.«
Ich blinzle verwirrt. Es fällt mir schwer, diese kultivierte Karrierefrau von Ende vierzig mit einer Ausdrucksweise zusammenzubringen, wie ich sie von meiner fünfzehnjährigen Tochter erwarten würde. Der religiöse Eifer meiner jüngeren Schwester irritiert mich zutiefst. Wie konnte es so weit kommen?
»Du kennst die Welt nicht, Philip«, fährt Kenny fort in dem mitleidigen Ton, in dem man mit besonders naiven Zeitgenossen spricht. »Sie ist fest in der Hand des Teufels.«
»Und diese Welt hat die Frau eures Pastors irgendwo versteckt?«
»Er ist Bischof«, korrigiert sie mich. Mein Sarkasmus stört sie weniger als der falsche Titel.
»Wie auch immer. Seine Frau wird vermisst, und auch wenn er Gottes persönlicher Assistent ist – der Hauptverdächtige ist immer der Ehegatte.«
»Deswegen brauchen wir ja deine…« Kennys Handy klingelt. »Wir stecken immer noch im Verkehr fest, Sir«, sagt sie mit ehrerbietiger Stimme ins Telefon. »Es ist nicht allzu schlimm, aber wir kommen trotzdem nur langsam voran.«
Es ist schlimm. Auf der Straße, der ich den Spitznamen »Highway der Evangelikalen Kirchen Nigerias« verpasst habe, herrscht das reinste Chaos. Der Verkehr stockt schon kurz vor dem Schild »Auf Wiedersehen in Lagos« und kommt fast völlig zum Stillstand, als eine weitere Plakatwand uns im Bundesstaat Ogun willkommen heißt.
»Es geht schon wieder weiter«, fährt Kenny fort. »Der Verkehr lichtet sich ein wenig. Wir dürften in etwa einer halben Stunde da sein …«
Ich pruste sarkastisch, während ich mich resigniert umsehe. Wenn wir nicht von einem Hubschrauber abgeholt werden, dürfte ihr Optimismus verfehlt sein. Die Megachurches, die die Straße zu beiden Seiten säumen, sind das Einzige, was einen Eindruck von Ordnung vermittelt. Ein Stadtplaner würde einen Anfall bekommen angesichts des wilden Wirrwarrs von Tankstellen, Läden, Marktständen und Bushaltestellen, die ein Kirchengrundstück mit dem nächsten verbinden. Es liegt keine Methode in dem Wahnsinn, der bis auf die Straße überschwappt und ihre auf drei Autos ausgelegte Breite auf bestenfalls zwei verengt.
»Ah, er fühlt sich geehrt, oo. Es macht überhaupt keine Umstände.«
Mein Seitenblick sagt mehr als tausend Worte. Kenny ignoriert mich, und ich wende meine Aufmerksamkeit wieder der Straße zu. Neben den Anwesen der Megachurches zeichnet sich die Straße auch durch eine außergewöhnliche Dichte von Bildungseinrichtungen aus. Von Kindergärten über Highschools mit angeschlossenen Internaten bis hin zu Universitäten – hier ist alles versammelt. Die Schul- und Studiengebühren prangen auf großen, knallig bunten Schildern, und riesige Plakatwände listen die jeweiligen Einrichtungen und Angebote auf. Die beeindruckenden Eingangstore der Schulen sollen den angehenden Schülern anscheinend den Eindruck vermitteln, dass sie vor dem Tohuwabohu auf der Straße geschützt sein werden. Ob mit Erfolg, das wage ich zu bezweifeln.
Kenny beendet das Gespräch. »Die Ältesten warten schon.«
»Sie können die Zeit nutzen, indem sie für ein Wunder beten.«
»Lass das.«
Ich halte den Blick auf die Straße gerichtet, damit sie mein Grinsen nicht sehen kann.
Zwei Stunden und dreiundzwanzig Minuten später, in einem luxuriösen Besprechungsraum, der besser zu einem Großkonzern als zu einer Kirche passt, starren uns neun Männer und vier Frauen an, als ob wir gerade eine hitzige Debatte über fallende Aktienkurse unterbrochen hätten. Die Anspannung im Raum ist höher als im Situation Room des Weißen Hauses während der Tötung von Osama bin Laden.
»Guten Tag, Sir«, sagt Kenny, während sie knicksend um den breiten, langen Konferenztisch herumgeht. Ich versuche den Rang der Ältesten daran abzulesen, wie tief sie vor jedem in die Knie geht.
Die Begrüßungen setzen sich fort, bis Kenny den Mann erreicht, der am nächsten zu dem leeren Ledersessel am Kopfende des Tischs sitzt. Anfang bis Mitte fünfzig. Man könnte ihn gutaussehend nennen, wenn er nicht so finster dreinschauen würde. Dunkelhäutig, glatt rasiert. Sein graumeliertes Haar und die Art, wie er die Hände verschränkt, verleihen ihm die Aura eines strengen Schuldirektors. Kennys Knie berühren den Boden. Der Vize-Jesus, jede Wette.
»Ist er das?« Das dröhnende Organ eines Mannes, der es gewohnt ist, zu großen Menschenmengen zu sprechen. »Der Psychologe?«
»Ja, Sir.« Kenny sieht mich an, und die tiefe Zuneigung, die von ihr ausstrahlt, wärmt mir das Herz. »Das ist mein Bruder, Dr. Philip Kehinde Taiwo. Er ist investigativer Psychologe«, erklärt sie.
Ich hebe die Hand zum Gruß, unangenehm berührt vom Stolz in ihrer Stimme wie auch von der Nennung meines vollen Namens und meines Berufs. Kenny geht weiter zu der Frau neben dem Vize-Jesus. Sie macht Anstalten, niederzuknien, doch die ältere Frau hält sie zurück und schließt sie stattdessen in die Arme.
»Ich habe den anderen gerade gesagt, sie hätten dich nicht behelligen sollen«, sagt die Frau, den Blick auf mich gerichtet.
»Ach, Auntie, mich nicht behelligen, ke? Wie kann ich ruhig sein, wenn der Teufel keine Ruhe gibt?« Kenny sieht mich an, während sie der Frau die Arme um die Schultern legt. »Phil, das ist Bishops Schwiegermutter, Mrs Kikelomo Bucknor.«
Ich versuche meine Überraschung zu verbergen. Dass die Mutter des potenziellen Opfers anwesend ist, bringt mich aus dem Konzept. Ich werde mit größerer Behutsamkeit vorgehen müssen und nicht wie geplant mit uneingeschränkter Offenheit.
Mrs Bucknor mustert mich kritisch. Außer dass sie erschöpft wirkt, kann ich aus ihrer Miene nichts lesen. Ihr Gesicht ist frei von erkennbarem Make-up, und abgesehen von der Abgespanntheit um die Augen glänzt ihre helle Haut vor Gesundheit. Ihr traditionelles Kostüm aus Iro und Buba würde protzig wirken, wäre da nicht der schlichte Knoten des dazu passenden Gele auf ihrem Kopf. Kein Schmuck. Kein Ehering. Der Wohlstand, den sie aus jeder Pore ausströmt, scheint die einzige Zierde zu sein, die sie braucht.
»Dann sind Sie also auch ein Zwilling«, bemerkt eine der Ältesten, als ob sie Kennys Behauptung anzweifeln würde.
»Ja, Ma«, erwidere ich steif. Es ist nicht leicht, die Regeln der Höflichkeit zu wahren, wenn dreizehn Augenpaare auf einen gerichtet sind.
Mrs Bucknor wendet sich Kenny zu. »Zwei Zwillingspaare in einer Familie. Was für ein Segen!«
Während ich bezweifle, dass meine Mutter dem beipflichten würde, finde ich die Art, wie Mrs Bucknor gesprochen hat, bemerkenswert. Ihr Tonfall war ausdruckslos, ohne das Erstaunen, das ich fast schon erwarte, wenn mein Stammbaum zur Sprache kommt. Aber schließlich wird der Schwiegersohn dieser Frau beschuldigt, ihre Tochter ermordet zu haben. Nicht gerade ein Hurra-Moment.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz«, fordert der Vize-Jesus mich auf.
Ich komme der Bitte nach und finde mich ihm gegenüber.
»Mein Name ist Pastor Abayomi George. Ich bin der stellvertretende Superintendent der Grace Church.«
Ich habe richtiggelegen. Die Nummer zwei in der Hierarchie.
»Darf ich Ihnen die Ältesten vorstellen?« Er deutet auf Mrs Bucknor. »Das ist Mrs Bucknor, wie Sister Kenny bereits sagte, die Mutter unserer First Lady …«
Jahrzehnte der nonverbalen Kommunikation zwischen Geschwistern fließen in den Blick ein, den ich Kenny quer durch den Raum zuwerfe: Du gehst in eine Kirche, in der die Frau des Pastors »First Lady« genannt wird? Sie kneift die Augen zusammen – eine tadelnde Geste, die mich auf merkwürdige Weise an unsere Mutter erinnert. Ich wende mich wieder Pastor George zu.
»Neben ihr sitzt Pastor Richard Nwoko. Er leitet unsere Finanzabteilung …«
Im Interesse meiner geistigen Gesundheit beschließe ich, mir die Namen und Titel erst später einzuprägen, wenn – falls – ich den Fall übernehme. Ich blicke mich im Raum um, während Pastor George die Vorstellungen herunterrattert. Alle im mittleren Alter oder darüber. Die weiblichen Ältesten tragen traditionelle Waxprint-Kostüme, die guten Geschmack und hochwertige Schneiderarbeit widerspiegeln. Die Männer sehen adrett aus in ihren Dreiteilern und Krawatten. Es ist mir unbegreiflich, wie sie sich darin wohlfühlen können. Trotz der kühlenden Wirkung der Klimaanlage löst die angespannte Atmosphäre im Raum in mir den Wunsch aus, mein Hemd aufzuknöpfen.
»Zu unserer Kirchenleitung gehören noch viele weitere Personen, darunter etliche Abteilungsleiter in aller Welt. Aber wegen des heiklen Charakters dieses Auftrags hielten wir es für klug, die Angelegenheit fürs Erste … ähm … diskret zu behandeln.« Pastor George blickt in die Runde, wie um sich zu vergewissern, dass er seine Rede wie vereinbart vorgetragen hat.
Alle nicken, bis auf Mrs Bucknor. Die anderen wirken wie Kinder, die nachsitzen müssen – man sieht ihnen an, dass sie es kaum erwarten können, von hier zu entfliehen.
Um die Spannung zu lösen, setze ich mein gewinnendstes Lächeln auf und lüge: »Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
First Lady
»Dr. Taiwo, Sie sind sicherlich im Bilde über unsere aktuelle Lage«, beginnt Pastor George. »Unser Superintendent wurde gestern wegen des Verdachts, in das Verschwinden seiner Ehefrau verwickelt zu sein, verhaftet.« Er hält inne und blickt sich wieder in der Runde um, als suche er Bestätigung. Allgemeines Nicken, begleitet von unterschiedlich tiefen Seufzern. »Das ist für uns als Kirchenleitung eine Angelegenheit von großer Tragweite. Bei aller Sorge um unsere First Lady …«
Mrs Bucknor hebt eine Hand. »Ich halte diese Sorgen nach wie vor für unbegründet.« Sie wendet sich nach links zu Kenny. »Sie wird sicher bald wieder auftauchen, und dann wird es der Polizei noch sehr leidtun.«
Bevor Kenny etwas erwidern kann, berührt Pastor George leicht Mrs Bucknors rechte Schulter. »Wir haben doch darüber gesprochen, und Sie waren einverstanden.«
Mrs Bucknor sieht Pastor George nicht an, stattdessen geht ihr Blick von Kenny zu mir. Lese ich da eine Bitte in ihren Augen? Oder eine Herausforderung?
»Es scheint mir nur Zeitverschwendung zu sein, da wir doch alle die Wahrheit kennen.« Mrs Bucknor neigt sich näher zu Kenny, als wollte sie sich dafür entschuldigen, dass man sie mit der Bitte, mich hinzuzuziehen, behelligt hat. Wieso beschleicht mich das Gefühl, dass sie mich hier nicht haben will?
»Und die Wahrheit ist …?«, frage ich, an Pastor George gewandt.
»Uns allen ist klar, dass der Druck, der auf der Gattin eines Superintendenten lastet, seinen Tribut fordern kann«, sagt er. »Unsere First Lady nimmt sich mehrmals im Jahr eine Auszeit, um ein wenig für sich zu sein. Wir haben uns deswegen noch nie Gedanken gemacht. Wir gewähren ihr einfach den Freiraum.«
»Sie meinen, es ist möglich, dass sie sich an einem Ort aufhält, wo es weder Fernsehen noch Mobilfunk noch Internet gibt, keinerlei Zugang zu irgendwelchen Medien, die über die Verhaftung ihres Ehemanns berichtet haben?« Ich gebe mir Mühe, nicht sarkastisch zu klingen, doch die Art, wie Pastor Georges finstere Miene sich noch weiter verfinstert, zeigt, dass es mir nicht gelungen ist.
»Wir wissen, wie sich das für einen Außenstehenden anhören muss, aber es ist allseits bekannt, dass First Lady sich öfter zur Einkehr zurückzieht. Da können Sie alle hier fragen.« Pastor George blickt erneut in die Runde. Das allgemeine Kopfnicken ermuntert ihn, fortzufahren. »Wir alle gehen davon aus, dass sie ihre Reisepläne vor ihrem Aufbruch mit Bishop bespricht, aber niemand hat jemals ihre Entscheidung infrage gestellt, sich auf diese Weise zurückzuziehen, wann immer ihr danach ist.« Die Runzeln in seiner Stirn glätten sich, während er spricht, und seine Miene wird so neutral wie sein Tonfall. Ich glaube, er mag die First Lady nicht besonders.
»Sind Sie davon ausgegangen, dass sie ihrem Mann Bescheid gesagt hätte – aber sie hat es nicht getan? Er weiß also auch nicht, wohin sie gegangen ist?« Ich blicke in die Runde.
»Nein«, antwortet Pastor Nwoko lauter als notwendig. Die Ältesten murmeln zustimmend. »Die Polizei ist in unsere Kirche eingefallen und hat diese gotteslästerliche Tat begangen, und wir haben keine Möglichkeit, zu beweisen, dass First Lady lediglich an einem unbekannten Ort Erholung sucht und bald wieder nach Hause zurückkehren wird.«
»Der Pastor gibt also zu, dass er nicht weiß, wo seine Frau ist?«, frage ich nochmals und fixiere dabei Pastor George.
»Der Bischof«, korrigiert er mich und fährt nahtlos fort: »Und nein, er weiß es nicht. Er sagte, sie sei abgereist, während er sich hier im Kirchenkomplex aufhielt, aber sie hätten nicht über ihre bevorstehende Abreise gesprochen.«
»Wie viele Tage war der Bischof von zu Hause weg?«
»Wir hatten ein spezielles Programm. Sieben Tage Fasten und Gebete«, antwortet Pastor Nwoko. Sein Ton ist abwehrend, als ob meine Frage einen Vorwurf implizierte. »Es ist bekannt, dass Bishop manchmal tagelang die Kathedrale nicht verlässt, wenn er auf ein prophetisches Wort des Herrn wartet…«
»Und Sie können alle bezeugen, dass der Bischof in den Tagen vor seiner Verhaftung« – ich halte inne und blicke in die Runde – »durchgehend nicht zu Hause war?«
»Allerdings«, sagte Pastor Nwoko so laut, dass er die allgemeinen Bekundungen der Zustimmung übertönt.
»Zweifellos«, fügt Mrs Bucknor mit nicht ganz so viel Nachdruck hinzu.
»Es ist wahr«, sagt Kenny. »Wann immer meine Arbeit es zuließ, habe auch ich an dem Programm teilgenommen. Bishop hat Graceland in diesem Zeitraum nie verlassen.«
»Ihre First Lady war bei einer so wichtigen Veranstaltung nicht anwesend?«, frage ich in die Runde. »Und das fand niemand seltsam?«
Die Ältesten sehen einander an wie Schauspieler, die herauszufinden versuchen, wer gerade an der Reihe ist.
Schließlich schüttelt Pastor Nwoko den Kopf wie der unwillige Überbringer einer unangenehmen Nachricht. »Unsere First Lady ist jung und recht impulsiv.«
Mrs Bucknor wirft ihm einen Blick zu, der kochendes Wasser zum Gefrieren bringen könnte.
»Es tut mir leid«, sagt er, doch es klingt wenig glaubwürdig. »Aber wenn wir wollen, dass Dr. Taiwo uns hilft, müssen wir die Dinge so darstellen, wie sie sind, und nicht so, wie wir sie gerne hätten.« Er wendet sich mir zu. »Unsere First Lady ist eine wunderbare Frau, aber in letzter Zeit neigt sie zu jugendlichem Überschwang und unberechenbaren Launen. Was wir ihr wegen ihres Alters verzeihen.«
Ich sehe verstohlen zu Mrs Bucknor, doch ihre Miene verrät keinerlei Regung.
»Wie alt ist die First Lady?«, frage ich.
»Sie wird in zwei Monaten dreißig«, antwortete eine der Ältesten im Bemühen, die Peinlichkeit der Situation zu zerstreuen. »Ich bin diejenige, die die Frauenkonferenz zur Feier ihres Geburtstags organisiert.«
Dreißig ist nicht besonders jung, aber für die »First Lady« einer Megachurch vielleicht schon, wie ich zugeben muss. Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass diese Ältesten vor einer Frau kuschen, die mindestens zwei Jahrzehnte jünger ist als das Durchschnittsalter in diesem Raum.
»Und der Bischof?« Ich bringe es nicht fertig, den Artikel vor dem Titel des Mannes wegzulassen, so wenig, wie die Ältesten aufhören können, den Titel Bishop wie einen Vornamen zu verwenden. Ihre Verehrung für ihn ist offensichtlich, auch in der Art, wie sie mich jetzt anstarren. Als wären sie nie auf die Idee gekommen, dass ihr Anführer etwas so Menschliches wie ein Geburtsdatum haben könnte.
»Zweiundfünfzig«, kommt Kennys Stimme vom anderen Ende des Raums. Sie hat die Hand wieder auf Mrs Bucknors Schulter gelegt und tätschelt sie tröstend.
»Ist das seine erste Ehe?«
»Selbstverständlich«, antwortet Pastor Nwoko hörbar verärgert. »Er war ganz auf seine priesterlichen Pflichten konzentriert, während er darauf wartete, dass der Herr ihm die passende Gefährtin zuführte.«
Der blinde Eifer des Mannes ist ermüdend. Ich mache mir rasch ein paar Notizen, um meine Ungeduld zu kaschieren. »Kinder?«
Keine Reaktion. Ich blicke von meinem Notizbuch auf.
»Bishop und seine Frau warten noch darauf, dass der Herr ihnen eine Leibesfrucht schenkt«, antwortet Pastor George mit ernster Stimme.
»Und wie lange sind sie verheiratet?«
»Fünf Jahre und zwei Monate«, antwortet Kenny leise, da aller Blicke auf Mrs Bucknors ausdrucksloses Gesicht gerichtet sind.
Ich konsultiere meine Notizen. »Also, die Frau des Bischofs wird vermisst…«
»Ihr Name ist Sade. Fo-la-sa-de«, wirft Mrs Bucknor in scharfem Ton ein.
»Und sie wird nicht vermisst«, fügt Pastor Nwoko hinzu.
»In Ermangelung eines besseren Ausdrucks«, erkläre ich an ihn gewandt, während ich Mrs Bucknor einen entschuldigenden Blick zuwerfe. Ich würde auch nicht wollen, dass die Existenz meiner Tochter auf ihren Familienstand reduziert wird. Um von meiner Verlegenheit abzulenken, konzentriere ich mich auf Pastor Nwoko. »Wir kennen ihren Aufenthaltsort nicht, was strenggenommen bedeutet, dass sie als vermisst gilt.« Ich lese weiter von meinen Notizen ab. »Die First Lady wird seit drei Tagen vermisst, und ihr Ehemann, der in dieser Zeit nicht zu Hause war, kann nicht sagen, wo sie ist. Sie alle erklären, das sei normal, und doch hat gestern – also insgesamt fünf Tage nachdem sie das letzte Mal gesehen wurde – die Polizei den Bischof unter Mordverdacht verhaftet?«
Nun herrscht Schweigen, bis Pastor Nwoko mit ungewohnt ernster Stimme sagt: »Das dürfte eine angemessene Zusammenfassung der gegenwärtigen Situation sein.«
»Könnte sie entführt worden sein?«, mutmaße ich vorsichtig. »Vielleicht…«
Pastor George schüttelt den Kopf. »Wir haben diese Möglichkeit in Betracht gezogen. Aber bis jetzt ist keine Lösegeldforderung eingegangen.«
»Und wieso können Sie dann nicht entweder warten, bis Ihre First Lady wieder auftaucht und die ganze Sache sich von selbst klärt, oder aber einen Suchtrupp aussenden, während Sie zugleich die Polizei davon zu überzeugen versuchen, dass keine Straftat begangen wurde? Der zweite Weg wäre mit einem guten Anwalt sicherlich leichter.«
Mrs Bucknor entspannt sich ein wenig und schenkt mir einen dankbaren Blick. »Habe ich das nicht die ganze Zeit gesagt?«
Ich habe richtig vermutet: Sie will mich hier nicht haben.
»So einfach ist es nicht, Dr. Taiwo«, sagt Pastor Nwoko. »Angesichts des öffentlichen Charakters von Bishops Verhaftung müssen wir der Gemeinde beweisen, dass wir mit der gebotenen Sorgfalt vorgehen. Wir brauchen Antworten. Wir müssen wissen, wer hinter der Behauptung steckt, First Lady werde vermisst oder, schlimmer noch, sie sei ermordet worden. Die Polizei behauptet, es sei ein anonymer Hinweis eingegangen.« Sein verächtliches Schnauben und seine abschätzige Miene lassen keinen Zweifel daran, was er von dem unchristlichen Gebaren der Gesetzeshüter und des unbekannten Hinweisgebers hält.
Ich runzle die Stirn. »Glauben Sie nicht, dass es ein anonymer Hinweis war?«
»Nein, das glauben wir nicht«, sagt Kenny und schenkt Mrs Bucknor ein beruhigendes Lächeln. Es ist merkwürdig, dass sie die zwiespältige Einstellung der Frau bezüglich meiner Anwesenheit nicht wahrnimmt. Aber so ist meine Schwester nun mal. Bedingungslose Loyalität. Uneingeschränkte Hilfsbereitschaft.
»Es sind Feinde am Werk«, fügt Pastor Nwoko hinzu, doch er blickt sich dabei um, als ob der Schuldige anwesend wäre. »Leute, die alles tun würden, um den Mann Gottes zu Fall zu bringen. Wir wollen wissen, wer diese Leute sind und was sie der Polizei erzählt haben. Unser Gott wird sie strafen.«
Ein Gemurmel geht durch den Saal, ich höre immer wieder »Amen« und »in Jesu Namen«. Die Ironie des Ganzen – jemanden für die Suche nach Schuldigen zu engagieren, um diese dann einem gütigen Gott zur Bestrafung zu überantworten – scheint ihnen entgangen zu sein. Ich schreibe etwas in mein Notizbuch, hauptsächlich um der dramatischen Wirkung willen, während ich darauf warte, dass ihre lautstarken Glaubensbekundungen abebben.
Als wieder Ruhe einkehrt, sehe ich Mrs Bucknor an. »Verzeihen Sie, Ma, aber ich muss Sie das fragen: Was ist, wenn die Polizei recht hat?«
»Phil!«, ruft Kenny, während die Ältestenrunde kollektiv nach Luft schnappt.
Ich halte den Blick auf Mrs Bucknor gerichtet und fahre mit ruhiger Stimme fort: »Um der Sache auf den Grund gehen zu können, muss ich in Betracht ziehen, was die Polizei weiß und warum sie ihn verhaftet hat. Und ob sie glaubt, dass die First Lady … ähm … wohlauf ist…«
»Meiner Tochter ist nichts zugestoßen.« Mrs Bucknors Blick ist unverwandt, ihr Tonfall scharf.
Die Ältesten pflichten ihr mit wiederholten »Amen«-Rufen bei, hier und da wird ein »Der Teufel ist ein Lügner« eingestreut. Ihre Mienen sagen: Wage nicht, uns zu widersprechen.
Ich kann nicht nachgeben. »Die Polizei muss doch irgendetwas in der Hand haben, was auf ein Verbrechen hindeutet. Wenn das der Fall ist…«
»Aber wer sollte First Lady nach dem Leben trachten?«, wirft Pastor Nwoko mit lauter Stimme ein. Mrs Bucknor zuckt zusammen, und Kenny zieht sie näher an sich heran. Die Ältesten richten tadelnde Blicke auf Pastor Nwoko, der nun hilfesuchend Pastor George ansieht.
»Wenn wir diese Möglichkeit in Betracht ziehen«, sagt Pastor George, »dann fürchte ich, dass wir auch die Frage stellen müssen, wer Bishop ein solches Verbrechen anhängen will.«
Wenn ihm etwas angehängt wird, was er nicht getan hat. Ich spreche das nicht laut aus, doch die Art, wie mich der Vize-Jesus ansieht, lässt mich vermuten, dass er das Gleiche denkt.
Ärger zu Hause
Es ist fast neun Uhr abends, als wir zum Tor des Graceland-Kirchenkomplexes hinausfahren und uns in das Verkehrschaos stürzen, um zurück nach Lagos zu gelangen. Es ist nicht schlimmer, als ich befürchtet habe, aber jetzt beschäftigt mich etwas anderes. Ich frage Kenny über die Ältesten aus, und die Zeit vergeht wie im Flug, während sie mir die Hierarchie und die Dynamik der Führungsstrukturen der Grace Church erläutert. Ihre Ausführungen bestätigen meinen Verdacht: Es wird alles andere als einfach sein, herauszufinden, wie und warum Bischof Dawodu in das Verschwinden seiner Frau verwickelt sein könnte.
»Sister Kikelomo betrachtet sich als Mutter der Kirche«, sagt Kenny, als ich sie nach Mrs Bucknor frage.
»Sie gehört nicht zu den Ältesten?«
Kenny schüttelt den Kopf. »Nein, jedenfalls nicht offiziell. Ich habe sie kennengelernt, als ich anfing, den Gottesdienst in der Grace Church zu besuchen. Wir waren beide in der Aktionsgruppe der berufstätigen Frauen.«
Kikelomo Bucknor wirkte auf mich nicht wie eine Karrierefrau, aber die Menschen sind in den seltensten Fällen das, was ihr Aussehen, ihre Redeweise oder ihre Kleidung vermuten lassen. Oder das, als was sie sich selbst bezeichnen. Das musste ich erst mühsam lernen. »Was ist sie denn von Beruf?«
»Sie hat als Ingenieurin im Bauministerium gearbeitet. Aber inzwischen ist sie im Ruhestand.«
Ah! Ich habe also nicht ganz so weit danebengelegen. »Seit wann?«
Kenny runzelt die Stirn. »Ich glaube, es war, nachdem Sade Bishop geheiratet hat.«
»Dann ist ihr Status in der Kirche also nach der Heirat ihrer Tochter gestiegen.«
Kenny wirft mir einen strengen Blick zu. »Sag das nicht so. Ja, sie hat in der Kirche mehr Verantwortung übernommen, als Sade First Lady wurde, aber sie wäre ohnehin um diese Zeit in Rente gegangen.«
»Kein Ehemann?«
Kenny schüttelt den Kopf. »Er ist verstorben. Schon vor längerer Zeit, soviel ich weiß.«
Eine Witwe, die nicht wieder geheiratet hat und keinen Ehering trägt. Das wird ja immer interessanter. »Wie ist ihr Verhältnis zum Bischof?«
»Sehr eng«, antwortet Kenny, ohne zu zögern. »Bishop nennt sie seine Mutter, und er ermuntert auch alle anderen, sie so zu sehen. Das ist der Grund, weshalb sie den ganzen Unsinn nicht glauben kann, den die Polizei erzählt.«
Und das könnte vielleicht ihre Zurückhaltung erklären, was meine Anwesenheit betrifft. Ihr Glaube an die Unschuld ihres Schwiegersohns ist eng verknüpft mit ihrer Loyalität ihm gegenüber als ihrem Seelsorger. Aber sollte beides ihre Sorge um den Verbleib ihrer Tochter überlagern?
»Pastor George«, sage ich und rufe mir in Erinnerung, wie nüchtern und emotionslos er über Sade Dawodu gesprochen hat. »Wie kommt er mit der Frau des Bischofs aus?«
Kenny zuckt mit den Schultern. »Da knirscht es schon manchmal, aber nicht so, dass es ein Störfaktor wäre. Es ist zum einen der Altersunterschied. Sade ist jung und dynamisch. Sie hat spannende Ideen für Jugendprogramme, sie will Sexualaufklärungs-Workshops für alleinstehende Frauen und dergleichen mehr. Pastor George ist da eher traditionell, aber er ist gezwungen, den Respekt zu wahren, weil sie die First Lady ist. Da sind schon Spannungen spürbar, wenn sie im selben Raum sind. Wir machen uns aber nicht allzu viele Gedanken deswegen, weil uns klar ist, dass es hauptsächlich ein ideologischer Konflikt ist.«
»Und du?«
Wir haben gerade die Stadtgrenze von Lagos erreicht, und die Verkehrslage hat sich ein wenig entspannt. Es ist immer noch chaotisch, aber es geht voran.
»Was soll mit mir sein?« Kenny zieht argwöhnisch eine Augenbraue hoch.
Die Unbefangenheit, mit der sie den Vornamen der First Lady benutzt, wenn sie über sie spricht, ist mir nicht entgangen. »Wie ist dein Verhältnis zu ihr?«
Kenny holt tief Luft und wendet sich ab. Ich lasse ihr Zeit, ihre Gedanken zu ordnen. Wenn sie nicht gerade vom Feuer des Heiligen Geists beseelt ist, kann meine Schwester ausgesprochen scharfsinnig sein. Als Wirtschaftsprüferin – und zwar eine sehr erfolgreiche in einer männlich dominierten Branche – verfügt sie über analytische Fähigkeiten, wie sie nur wenigen gegeben sind. Fähigkeiten, die sie einzubüßen scheint, sobald es um Kirchenangelegenheiten geht.
»Sie ist nicht glücklich«, sagt Kenny nach einer langen Pause.
»Das hat sie dir gesagt?«
Kenny wendet sich mir zu, und selbst im Halbdunkel des Wageninneren sehe ich, wie sehr es ihr widerstrebt, darüber zu sprechen. Da kann ich ihr leider nicht helfen.
»Woher weißt du, dass sie unglücklich ist?«, hake ich nach.
»Weil ich es ganz einfach weiß«, erwidert sie gereizt. Sie seufzt, als mein Schweigen ihr klarmacht, dass ich nicht lockerlassen werde. »Verstehst du, sie ist so etwas wie meine Freundin, obwohl sie Bishops Frau ist. Sie betrachtet mich als eine Art Tante …«
»Hat sie keine Freundinnen in ihrem Alter?«
Kenny wirft mir einen mahnenden Seitenblick zu und fährt fort: »Bestimmt hatte sie welche, bevor sie Bishop geheiratet hat. Aber danach ist es den meisten Leuten wohl schwergefallen, die Beziehung zu ihr aufrechtzuerhalten. Besonders im vergangenen Jahr hatte ich den Eindruck, dass sie sich mehr und mehr zurückzieht. Wir haben immer viel Zeit miteinander verbracht, vor allem im Anschluss an die Gebetstreffen, nachdem alle anderen gegangen waren. Mit alldem war vor einigen Monaten plötzlich Schluss, und wenn ich sie fragte, sagte sie immer, es sei alles in Ordnung und sie habe einfach nur viel zu tun. Auch wenn ich ahnte, dass sie nicht die Wahrheit sagte, wollte ich ihr den Freiraum lassen. Aber ich habe gespürt, dass sie einsam ist.«
»Und sie zieht sich regelmäßig zur Einkehr zurück?«
Kenny sucht in meiner Miene nach Anzeichen von Ironie. Als sie keine findet, zieht sie die Stirn in Falten und beißt sich auf die Unterlippe, wie sie es immer tut, wenn sie ihre Worte mit Bedacht wählt. »Die Kirche kann ein sehr belastendes Umfeld sein, Phil. Du hast diese Ältesten kennengelernt. Die ständigen Streitereien, die politischen Manöver. Bishop kann das aushalten. Er ist älter, erfahrener und reifer. Außerdem geht er in seinem Priesteramt auf. Dem Ruf Gottes zu folgen, ist sein Leben. Sade hat um all das nicht gebeten. Sie will nur ihr Leben leben. Das kann nicht leicht sein für so einen jungen Menschen.«
»Du magst sie«, stelle ich mit einem Lächeln fest. Meine Schwester sieht das Gute in jedem Menschen – eine ungewöhnliche Eigenschaft bei einer Frau, die darin geschult ist, die Schwachstellen in Trends und Zahlen zu erkennen.
»Dann übernimmst du den Fall?«, fragt Kenny hoffnungsvoll.
Ich lasse mich nicht gerne nötigen. »Ich denke darüber nach.«
»Dann denk schnell«, gibt sie gereizt zurück und lässt damit die Atmosphäre geschwisterlicher Verbundenheit gleich wieder verpuffen. »Bishop siecht im Gefängnis dahin.«
»Ach, ich bitte dich! Es ist gerade mal ein Tag.«
»Eine Nacht in einem Gefängnis in Lagos kann einem vorkommen wie zehn Jahre. Vor allem, wenn man unschuldig ist!«
»Er kommt sicher auf Kaution frei«, sage ich zuversichtlich.
Kenny schüttelt den Kopf. »Er sagt: Keine Kaution. Bishop will, dass das Recht seinen Lauf nimmt.«
Welcher Mensch, der nicht sträflich leichtsinnig oder naiv ist, würde einen solchen Standpunkt einnehmen? »Aber er hat doch zumindest Anspruch auf eine Anhörung.«
»Seine Wege sind nicht unsere Wege«, verkündet Kenny so kryptisch, dass ich nicht weiß, ob sie von Gott oder dem Bischof spricht. »Ich bin sicher, dass er dir seine Gründe nennt, wenn du mit ihm sprichst.«
»Falls ich mit ihm spreche.«
»Ach, komm schon, Philip. Du weißt, wie viel mir das bedeutet.«
Meinen Bedenken zum Trotz ist meine professionelle Neugier geweckt. Es langweilt mich zunehmend, an der Polizeiakademie Vorlesungen zu halten, während ich auf das Ende von Folakes Sabbatical warte. Außerdem ist seit der Nahtoderfahrung bei meinem letzten Fall fast ein Jahr vergangen. Es wird Zeit, meinen Lebenslauf in Vorbereitung auf unsere Rückkehr in die Staaten ein wenig anzureichern. Manche meiner ehemaligen Kollegen bei den Strafverfolgungsbehörden würden ihre eigene Großmutter verkaufen, um einen Fall wie diesen bearbeiten zu dürfen.
»Ich werde Pastor George morgen meine Entscheidung mitteilen.« Ich versuche, unverbindlich zu klingen, als wir die Mitarbeitersiedlung auf dem Campus der University of Lagos erreichen.
»Es ist zu spät, um noch mit reinzukommen«, sagt Kenny, als der Fahrer vor meinem Haus hält.
Ich stecke mein Notizbuch und den Stift ins Seitenfach meiner Laptoptasche. »Ich grüße alle von dir. Und grüß du mir Dele und die Kinder.«
»Ich richte es dem keferi aus.«
Ich lache, weil Kenny ihren Mann mit dem Yoruba-Ausdruck für »Ungläubige« belegt. Dele Bhadmus ist ein Atheist, wie er im Buche steht. Der Erfolg ihrer Ehe sollte als das achte Weltwunder gelten. Aus ihr sind vier Kinder hervorgegangen, die zu ungewöhnlich ausgeglichenen Teenagern herangewachsen sind, und sie sorgt bei Familientreffen immer noch für Staunen und Erheiterung.
»Das ist, als ob Hillary Clinton und Ronald Reagan ein Paar wären«, hat Folake einmal über die Ehe meiner Schwester bemerkt. »So undenkbar, wie es faszinierend wäre.«
Ich bedanke mich beim Fahrer mit einem 1000-Naira-Schein. Er protestiert, nimmt das Geld aber an, als ich darauf beharre, dass es für seine Kinder ist, als kleine Entschädigung dafür, dass wir ihren Vater so lange mit Beschlag belegt haben. Kenny bringt ihre Dankbarkeit im Namen ihres Fahrers mit einer Flut von Gebeten auf Yoruba zum Ausdruck, die ich mit einer Handbewegung abwehre, während ich auf meine Veranda zueile.
»Wenn du meinst, dass das hier eine von deinen Disney-Familienserien ist, liegst du aber gewaltig schief, junge Dame!« Folakes Zorn ist laut und unverkennbar. Meine Hand verharrt am Türknauf. »Wir knallen in diesem Haus keine Türen zu, bloß weil etwas nicht so läuft, wie wir wollen!«
Lara. Wieder mal. Was würde ich nicht darum geben, die Zeit bis vor ihren fünfzehnten Geburtstag zurückdrehen zu können. Nach diesem anstrengenden Tag habe ich wirklich keine Lust, mich mit der mürrischen Fremden herumzuschlagen, in die sich meine fröhliche Tochter verwandelt hat. Ich hole tief Luft, zähle bis zehn und drehe den Türknauf.
»Außer wenn ich jemals so mit meiner eigenen Mutter geredet hätte, hast du kein Recht, mich auch nur so anzuschauen.«
Wenn Folake in die Rolle der nigerianischen Mutter zurückfällt und in ihrem Akzent und Satzbau nichts mehr daran erinnert, dass sie über zwei Jahrzehnte in den USA gelebt hat, dann ist Ärger angesagt.
»Sprich du mit deiner Tochter – ich bin mit meinem Latein am Ende!«, sagt Folake, kaum dass sie mich erblickt.
»Was ist passiert?«, frage ich Lara, die trotzig mitten im Wohnzimmer steht.
»Sie hat angefangen, Dad, ich habe bloß…«
»Wer hat was angefangen? Bin ich vielleicht eine von deinen Schulfreundinnen?«, donnert Folake.
Lara ist klug genug, nicht zu antworten.
Ich werfe Folake unseren »Ich regle das«-Blick zu. Sie stürmt an mir vorbei und geht nach oben.
»Was wolltest du sagen?«, frage ich, sobald ich höre, wie unsere Schlafzimmertür ins Schloss fällt.
»Nichts.« Lara ist wie eine Miniversion ihrer Mutter, wie sie da mit verschränkten Armen steht und den unsicheren Teenager hinter der trotzigen Fassade versteckt.
»Du wolltest es mir doch gerade eben erklären.«
»Und ich hab Redeverbot gekriegt, oder nicht? Also, es ist nichts passiert.«
Wo ist mein kleines Mädchen, das mir um den Hals gefallen wäre, sobald sie mich erblickt? Wo ist unsere geniale Bastlerin, die jedes elektronische Gerät in kürzerer Zeit zusammenbauen konnte, als sie gebraucht hat, um es auseinanderzunehmen? Unser Bücherwurm, der Tolkien zitierte, während sie ihre Brüder bei Minecraft vernichtend schlug? Obwohl ich gesagt habe, dass ich die Sache regeln würde, weiß ich jetzt nicht, was ich zu dieser Fremden sagen soll.
»Omolara«, beginne ich behutsam. »Sprich mit mir. Warum bist du so wütend?«
Die Art, wie Lara die plötzlich hervorquellenden Tränen wegwischt, bricht mir das Herz. Ich trete näher, um sie in den Arm zu nehmen und zu trösten. Doch sie weicht zurück und entzieht sich mir. Das trifft mich tief.
»Du hast versprochen, dass wir nach Hause kommen würden!«, wirft Lara mir vor, und ihre Augen schleudern wütende Blitze.
»Nach Hause? Wie meinst du …«
»Als wir die Staaten verlassen haben, habt ihr beide gesagt, dass wir nach Hause kommen würden.«
»Aber es stimmt doch«, sage ich ein wenig erleichtert. Meine Tochter vermisst ihr Leben in den USA. Das kann ich nachvollziehen.
»Nein, es stimmt nicht. Das hier ist nicht unser Zuhause. Die Leute sind gar nicht nett. Es ist heiß und laut. Alle reden immer gleichzeitig. Alles ist voller Staub. Die Straßen sind ein Albtraum. Das Internet ist sogar noch langsamer als der Verkehr, was bedeutet, dass man nirgendwo hinkommt. Ist doch so! Und das Essen wird überschätzt. Wer braucht denn so viele Gewürze, tagaus, tagein?«
»Aber in der ersten Zeit hier hast du das doch nicht so gesehen?«, frage ich, als ihr die Puste auszugehen scheint.
»Tja, aber jetzt seh ich es so. Ich vermisse meine Freunde. Meine Schule. Unser Viertel. Ich will nach Hause.«
»Nigeria ist dein Zuhause«, sage ich und komme mir vor wie ein Schwindler.
»Nein. Ihr wollt das irgendwie erzwingen, aber das ist es nicht!«
Ich habe schon öfter über diese Sache nachgedacht, als gut für mich ist, also setze ich zu meiner Verteidigungsrede an. »Erstens: Egal wie verärgert du bist, schrei mich nicht an. Zweitens: Niemand erzwingt irgendetwas. Mums Sabbatical ist bald um, und wir…«
»Ich will jetzt zurück«, bettelt sie unter Tränen.
»Warum?« Keine Antwort. »Warum jetzt, Lara?«
So stehen wir uns gegenüber – weniger als eine Minute, aber es fühlt sich viel länger an. Lara sagt nichts, doch ihr Blick warnt mich davor, weiter in sie zu dringen. Ich bin müde.
»Vielleicht solltest du jetzt auf dein Zimmer gehen. Wir können morgen reden, wenn du dazu bereit bist.«
Lara zuckt mit den Schultern – von mir aus –, und ich habe nicht die Kraft, sie zu warnen. Ich befürchte, dass sie etwas tun wird, womit sie ihre Mutter noch wütender macht. Wenn das passiert, kann niemand – weder ihre Brüder, die sich jetzt in ihren Zimmern verstecken, noch ich selbst – sie vor Folakes Zorn retten.
»Omolara«, rufe ich, als sie schon mitten auf der Treppe ist.
Sie bleibt stehen und funkelt mich an, als ob ich der Grinch wäre, der Weihnachten gestohlen hat.
»Was immer du tust, knall deine Tür nicht zu.«
Wahrheit oder Pflicht
Der Duft von Räucherstäbchen dringt aus dem Badezimmer. Folake nimmt ein ausgiebiges Bad – ihr bevorzugtes Ritual, um runterzukommen. Vielleicht ist es besser so. Ich bin mir nicht sicher, ob sie schon bereit ist, von Laras Sinneswandel hinsichtlich unserer Rückkehr nach Nigeria zu hören. Außerdem hat mich die Erfahrung gelehrt, zu warten, bis ihr juristisch geschulter Verstand ein Problem verarbeitet hat. Andernfalls wird es mit ziemlicher Sicherheit zu einem Streit kommen, aus dem sie als Siegerin hervorgeht. Wer sich mit Professorin Afolake Taiwo anlegt, tut gut daran, sich sorgfältig vorzubereiten. Wenn sie in die Enge getrieben wird, kann meine Frau gnadenlos sein. Gibt man ihr jedoch Zeit, die Dinge zu durchdenken, dann ist sie vielleicht gnädig und lässt einen nur den Streit und nicht auch noch das Gesicht verlieren.
Ich setze mich aufs Bett und lasse den Kopf in die Hände sinken. Laras Wutanfall hat mich stärker getroffen, als ich mir eingestehen mag. Mehr noch – ihre Worte geben wieder, was ich über unser »nigerianisches Experiment«, wie ich es insgeheim nenne, tatsächlich denke.
Sind wir hier zu Hause? Und wollen wir dies unser Zuhause nennen, zumal wir doch die Wahl haben?
Ich blicke mich im Schlafzimmer um. Wir haben uns große Mühe gegeben, den Raum wohnlicher zu gestalten, als er es mit der Standardmöblierung der Universität war, aber es ist immer noch ein himmelweiter Unterschied zu unserer Wohnung in San Francisco. Direkt neben dem Einbauschrank ist ein Riss in der Wand, so tief, dass ich schon des Öfteren von Albträumen geplagt wurde, in denen ich das Haus in zwei Teile zerbrechen sah. Und wir können die Decke noch so oft überstreichen, nichts kann kaschieren, wie die Balken sich absenken, aufgequollen von Alter und Fäulnis. Unsere Eingabe an die Instandhaltungsabteilung der Universität liegt dort schon, seit wir vor siebzehn Monaten eingezogen sind.
Das hier ist nicht unser Zuhause. Ich weiß das. Aber jetzt, da es nur noch fünf Monate bis zum Ende von Folakes Sabbatical sind, beschleicht mich das Gefühl, dass sie mir in diesem Punkt nicht zustimmen wird. Ihr Schweigen zu unserer Zukunft macht mir Sorgen, und genau deshalb spreche ich das Thema nicht an. Es erscheint mir klüger, die Zeit über unsere nächsten Schritte entscheiden zu lassen, zumal der Grund, weshalb wir die Staaten verlassen haben, immer noch zwischen uns steht. Eine unüberwindbare Kluft, die jeden Einfluss, den ich vielleicht haben könnte, schwächt, während sie Folakes Entschlossenheit stärkt.
Der Schlaf will sich nicht einstellen, also schlüpfe ich in mein altes USC-T-Shirt und eine Jogginghose und begebe mich in den Vorratsraum, den wir, so gut es eben ging, in ein Arbeitszimmer umgewandelt haben.
Ich google »Sade Dawodu«.
Es nervt, dass fast alle Erwähnungen der vermissten Frau im Zusammenhang mit ihrem superberühmten Ehemann stehen. Ich scrolle durch die Social-Media-Websites und finde zahlreiche Artikel über die Grace Church, in denen die First Lady nur am Rande erwähnt wird. Auf den Fotos steht sie fast immer neben dem Bischof – er lächelt mit leutseligem Charme in die Kameras, während sie fast schüchtern wirkt, als ob sie sich scheut, ihm etwas vom Rampenlicht zu stehlen.
Und das könnte sie, wenn sie wollte, denn Folasade Dawodu sieht umwerfend aus. Sie ist schlank und steht fast Schulter an Schulter mit dem Bischof, der selbst kein kleiner Mann ist. Ihre hellbraune Haut strahlt vor Gesundheit, und selbst mit ihrem perfekten Make-up ist die Ähnlichkeit mit ihrer Mutter so frappierend, dass sie als Schwestern durchgehen könnten.
Ich hätte die Dokumentation fast übersehen, wäre da nicht das Hashtag #PrayforFirstLady gewesen, das vom Tag der Verhaftung des Bischofs an viral ging, zusammen mit #IstandwithBishop. Es handelt sich um ein altes Zwölf-Minuten-Video, in dem die Arbeit einer Nichtregierungsorganisation namens »Girls in Control« vorgestellt wird. Eine jugendfrische Sade Dawodu erscheint. Laut der Einblendung ist sie eine der Kuratorinnen der NGO.
»Girls in Control will jungen Mädchen helfen, Handlungskompetenz zu erwerben und sie aktiv zu nutzen«, sagt Sade Dawodu in die Kamera. Sie glüht vor Eifer, gekleidet in ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift »#CONTROL« und Bluejeans. Meilenweit entfernt von der ultraglamourösen Gattin von Bischof Dawodu. Ihre Stimme ist wohlklingend, mit einem singenden Tonfall und gepflegter Aussprache, die auf eine Privatschulerziehung schließen lässt. »Wir leben in einer Welt, in der Traditionen, die Kultur und die Eltern einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie junge Menschen die Welt sehen und welchen Weg sie einschlagen. Auf Mädchen lastet dabei ein viel größerer Druck, und es fällt ihnen schwer, den Erwartungen gerecht zu werden, die oft im Konflikt mit ihren Bedürfnissen oder ihren selbst gesteckten Zielen stehen.«
Ich spule vor, als ein anderes Kuratoriumsmitglied erscheint und die verschiedenen Aktivitäten vorstellt, mit denen Girls in Control Mädchen zwischen acht und achtzehn in ihrer Selbstwirksamkeit unterstützen will. Ich bin beeindruckt. Die Programme sind praxisorientiert: Beratungsangebote, Peer-Review-Modelle und sogar Familientherapie zur Unterstützung von Teenagern, die Probleme bei der Kommunikation mit ihren Eltern haben. Ich sollte das Folake zeigen. So, wie sich die Dinge mit Lara entwickeln, hätte ich nichts dagegen, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen.
»Ich engagiere mich mit Begeisterung für Girls in Control, denn als junges Mädchen wollte ich Ärztin werden, weil es das war, was meine Eltern für mich wollten. Ich habe nie überlegt, was ich selbst wollte, und ich habe dafür mit vielen unglücklichen Jahren bezahlt.« Sade Dawodus Stimme wird mit Bildern von jungen Mädchen bei verschiedenen Aktivitäten unterlegt. »Deswegen liebe ich die Arbeit, die wir bei Girls in Control machen. Denn wenn es so etwas gegeben hätte, als ich so jung war, hätte mich das sicher in die Lage versetzt, eigenständig zu denken und für meine eigenen Interessen einzustehen, und vielleicht hätte ich dann meine Vorstellungen davon, was die Gesellschaft von mir erwartet, hinterfragen können.«
Ich sehe mir das Datum an. Hochgeladen vor zwei Jahren, aber ich kann nicht feststellen, wann es produziert wurde. Weitere Kuratorinnen und Freiwillige kommen zu Wort, und das Video endet damit, dass Sade Dawodu, die Mitarbeiterinnen und mehrere junge Mädchen in die Kamera winken und rufen: »I am in control!«
Die Sade Dawodu in diesem Video passt nicht zu meinem Bild der »First Lady« einer Megachurch. Nicht ein einziges Mal hat sie aus der Bibel zitiert oder ist irgendwie belehrend rübergekommen. Ich kann verstehen, dass Kenny sie mag. Ich mag sie auch, jedenfalls diese Version von ihr. Ich hoffe, dass die Polizei falschliegt und die Ältesten zu Recht davon ausgehen, dass sie wohlauf ist.
Ich tippe »Bischof J. Dawodu« in das Suchfeld. Die ersten Treffer beziehen sich alle auf die Verhaftung. Offenbar haben etliche Teilnehmer des mittlerweile zu zweifelhaftem Ruhm gelangten Gottesdienstes Videos hochgeladen. Manche haben die Aufnahme gestartet, als die Polizei daran gehindert wurde, an die Kanzel heranzutreten. Andere haben auf den Bischof gehalten, als er seine Predigt unterbrach und die Polizisten aufforderte, näher zu kommen. Viele Videoclips mit dem Tag #IstandwithBishop zeigen ihn, wie er hoheitsvoll die Hände ausstreckt, um sich die Handschellen anlegen zu lassen.
»Gott ist gut!«, brüllt der Bischof, während die Kameras entweder zu den geschockten Gesichtern der Ältesten oder zu der laut klagenden Kirchengemeinde schwenken.
Ich klicke einige der Predigten des Bischofs an. Es ist viel die Rede von einem gütigen Gott, der allein den Gläubigen und denjenigen, die brav ihren Zehnten entrichten, Wohlstand verheißt. Dazu Motivationsreden zum Thema »Wie komme ich zu Erfolg und Reichtum?«. Nichts Neues. Und doch zieht mich das Charisma des Mannes in seinen Bann. Er redet schlicht, aber mit einer Souveränität, die mich an Barack Obama erinnert, bis hin zum Akzent. Sein Ansatz bei der Auslegung der Schrift ist verständlich, seine Ratschläge sind praktisch. Meiner kritischen Haltung gegenüber modernen pfingstkirchlichen Pastoren zum Trotz höre ich Bischof Dawodu schließlich länger zu, als ich eigentlich vorhatte. Um das zu erklären, ist keine tiefschürfende Selbstanalyse nötig – es genügt ein Name:
Reverend August Freeman.
Es ist Jahre her, seit ich zuletzt an den Pastor der First Baptist Assembly in Downtown Los Angeles gedacht habe. Aber beim Anschauen von Bishop Dawodus Predigten werden Erinnerungen an den Mann wach, den mein Zwillingsbruder für unser ambivalentes Verhältnis zur organisierten Religion verantwortlich macht. Der gleiche singende Tonfall in ihren Predigten. Eine Überzeugungskraft in der Stimme, die an Martin Luther Kings Reden erinnert. Ein Charme, der alle einlädt, ohne Vorbehalt. Esprit, verbunden mit einer pragmatischen, zeitgemäßen Herangehensweise an die Evangelien. Es war schwer, Reverend Freeman nicht zu mögen, und genauso schwer ist es, gegen die Ausstrahlung von Bishop Dawodu immun zu bleiben.
Nein. Lass das. Wenn du an Reverend Freeman denkst, wirst du Kenny und den Ältesten ganz sicher eine Absage erteilen. Lass es sein. Es ist die Vergangenheit. Es ist Jahrzehnte her. Ich bin heute älter. Und klüger, hoffe ich. Weniger leicht zu beeindrucken.
Bist du das wirklich?, flüstert eine kleine warnende Stimme in meinem Kopf.
Ich gebe vor, sie nicht zu hören. Außerdem wird es allmählich spät, und ich muss morgen früh die Kinder in die Schule bringen. Ich will mich gerade ausloggen, als der Bischof den Chor auffordert, mit ihm ein Loblied anzustimmen. Der Gesang setzt ein, bevor die Kamera zu dem Mammut-Chor schwenkt. Die Sänger tragen alle Gewänder aus afrikanischen Waxprint-Stoffen. Der Vorsänger kommt mir bekannt vor, ein gutaussehender Mann in einem enganliegenden grauen Anzug. Der Sound ist von professioneller Qualität, und ich bin ebenso fasziniert von der Musik wie von der Stimmung, die sie in der Gemeinde hervorgerufen hat. Gerade noch hat Bischof Dawodu sie mit seiner dynamischen, eindrucksvollen Präsenz in seinen Bann gezogen, und im nächsten Moment kniet er in Anbetung nieder.
Der plötzliche Stimmungsumschwung von der One-Man-Show des Bischofs zu einer die ganze Gemeinde einbeziehenden Ensembleveranstaltung spiegelt sich im Regiestil des Videos. Schnelle, abrupte Schnitte, kaum eine Einstellung länger als eine Sekunde. Ich klicke auf Pause, ziehe den Cursor ein kleines Stück zurück, regle die Wiedergabegeschwindigkeit herunter und starte erneut.
Da ist es.
Sade Dawodu steht, aber sie hat die Hände nicht erhoben und die Augen nicht in Verzückung geschlossen. Ihr Gesichtsausdruck erinnert mich an den Blick, den ihre Mutter Pastor Nwoko zuwarf, als er sich in der Wortwahl vergriffen hatte. Geringschätzung, vermischt mit etwas, das ich nicht genau benennen kann. Ich lasse die Szene noch einmal ablaufen. Pause, Play. Pause, Play. Der Blick der Frau ist auf ihren knienden Ehemann gerichtet.
Interessant. Ich schaue mir das Upload-Datum an: vor knapp elf Monaten. Ich mache einen Screenshot der Szene und zoome die First Lady heran. Ohne die ablenkende Umgebung ist die Verachtung in ihren Augen unverkennbar. Jetzt scheint sie auf mich gerichtet zu sein. Ich starre das Bild an, als wollte ich es zum Leben erwecken, die Augen zum Blinzeln und die Lippen zum Sprechen bringen.
»Wo bist du?«
Ich klappe schnell den Laptop zu, als ich merke, dass ich die Worte laut ausgesprochen habe.
Erst als ich im Bett liege und mich an Folake gekuschelt habe, gelingt es mir, meine Unruhe abzuschütteln. Aber noch als der Schlaf meinen müden Körper übermannt, verfolgt mich der verächtliche Blick aus Sade Dawodus Augen, in der Zeit erstarrt und nicht bereit, preiszugeben, was zuvor geschah.
Oder was noch bevorsteht.
Ein neuer Fall
Die Spannungen des gestrigen Abends hängen noch in der Luft, auch nachdem Folake zu ihrer ersten Vorlesung des Tages aufgebrochen ist. Die Erleichterung von Tai und Kay angesichts der Tatsache, dass ich heute Schulfahrdienst habe, wäre amüsant, wenn ich nicht so mit der Frage beschäftigt wäre, wie sich meine Entscheidung, den Fall Sade Dawodu zu übernehmen, auf meine Tagesplanung auswirken würde.
Lara kommt die Treppe heruntergestampft, worauf ihre Brüder augenblicklich verstummen. Sie geht zu Kay und legt meine alte Nikon 300 auf den Esstisch.
»Du darfst die Linse nicht mit irgendwelchen alten Lumpen reinigen. Ich habe sie neu eingestellt. Die Fehlermeldung dürfte jetzt nicht mehr erscheinen.«
»Danke!«, sagt Kay und kaut an einem Bissen von dem, was eigentlich sein Pausenbrot sein sollte.
»Sechshundert Naira. Ich will es in bar. Sieh zu, dass du das Geld bis heute Abend beisammenhast.«
Allen am Tisch bleibt der Mund offen stehen. In der ganzen Zeit, die Lara schon unsere hauseigene Reparaturwerkstatt ist, hat sie noch nie verlangt, dafür bezahlt zu werden.
»Aber…«, setzt Kay zum Protest an.
»Kein Aber. Ich habe sämtliche Daten in meine Cloud übertragen und gesperrt. Sobald du zahlst, geb ich sie wieder frei.«
Bevor ich intervenieren kann, wirft mir Lara ein kaum hörbares »Morgen, Dad. Ich warte im Auto« zu und geht hinaus.
»Was ist denn in die gefahren?«, wundert sich Kay und wischt sich Brotkrümel vom Mund, während er sich den Rucksack auf die Schulter hievt. Er geht jetzt vorsichtiger mit der Kamera um. Bevor er sie anfasst, wischt er sich sorgfältig die Hände ab und überprüft alle Einzelteile, ehe er sie in ihrer Spezialtasche verstaut.
»Du musst zugeben, dass sie billiger ist als ein Profi«, meint Tai, während er seine Bücher einpackt, sein Sandwich in Klarsichtfolie einschlägt und es in die Seitentasche seines Ranzens steckt.
Meine Zwillinge sind jetzt siebzehn, äußerlich kaum zu unterscheiden, aber vom Wesen her völlig verschieden. Tai isst zu genau festgelegten Zeiten, Kay, wann immer ihm danach ist – sein Pausenbrot ist gerade zu seinem Frühstück geworden, und ich wette, dass sein Rucksack voll mit Resten ist, die er sich aus dem Kühlschrank geholt hat. Tai hat mehr von mir – er geht Konflikten nach Möglichkeit aus dem Weg. Es stresst ihn schon, wenn er nur Zeuge einer Auseinandersetzung wird. Kay, der nach seiner Mutter kommt, ist der geborene Kämpfer.
»Dad, ich bitte dich!«, fleht Kay. »Sechshundert? Ernsthaft? Wo soll ich das denn …«
»Du hast Ersparnisse, die kannst du dafür nehmen«, erwidere ich mit unnötiger Schärfe. Während ein Teil von mir beeindruckt ist, dass unsere technisch beschlagene Tochter für eine Dienstleistung entschädigt werden will, die wir alle als selbstverständlich betrachtet haben, findet ein anderer Teil die Abruptheit der Forderung besorgniserregend. Ganz zu schweigen von der Erpressung, mit der sie sicherstellt, dass ihr Bruder auch zahlt.
Die Fahrt über den Campus zur Mitarbeiterschule verläuft schweigend. Lara steigt als Letzte aus. Sie blickt starr vor sich hin, sieht nicht zum Schultor. Mein Herz macht einen Sprung. Vielleicht will sie ja reden. Gerade als ich sie dazu ermutigen will, strafft sie die Schultern, murmelt einen Abschiedsgruß und steigt aus.
Ich muss mich sehr beherrschen, um ihr nicht nachzulaufen. Ich schwöre, wenn sie sich auch nur eine Sekunde lang umblickt, werde ich alle meine Pläne für den Tag über Bord werfen und sie irgendwohin mitnehmen, wo wir ein ausgiebiges Vater-Tochter-Gespräch führen können. So wie früher.
Ich halte den Atem an und warte. Aber Lara schaut sich nicht um.
»Das ist gut«, sagt Abubakar Tukur, während er den Kopf wegdreht, um mir seinen Zigarettenrauch nicht ins Gesicht zu blasen. Wir stehen vor seinem Büro, neben einem überquellenden Aschenbecher. »Um nicht zu sagen herporragend.«
Ich arbeite nun schon mehr als ein Jahr mit dem Kommandanten der Polizeiakademie zusammen, aber ich finde es immer noch gewöhnungsbedürftig, wie er des Öfteren ein »p« statt eines »f« oder »v« spricht und umgekehrt, und mich so zwingt, besonders aufmerksam zuzuhören. Mir ist aufgefallen, dass er das öfter macht, wenn er verärgert oder freudig erregt ist.
»Nach der pantastischen Arbeit, die Sie im Fall der Okriki Three geleistet haben, konnten wir zusätzliche Mittel an Land ziehen, die es uns ermöglichten, Ihnen einen Vertrag zu geben …«
»Einen befristeten Vertrag«, korrigiere ich ihn. Es amüsiert mich immer noch, wie die Sympathie, die der Mann für mich hegt, ihn dazu bringt, meinen Status über die Gehaltsklasse eines Teilzeitdozenten zu erheben. Da das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht, klammere ich das Thema meiner unbezahlten Beförderung im Allgemeinen aus. Ich gebe zu, dass ein solides Sparkonto in US-Dollar mir das leichter macht.
Abubakar bückt sich, um seine Zigarette auszudrücken. Als er sich wieder aufrichtet, strahlt sein breites, dunkles Gesicht vor Begeisterung. Seine Polizeiuniform verleiht ihm ein stattliches Aussehen, und er wirkt darin noch größer und breitschultriger als ich mit meinen eins achtundachtzig.
»Wortklauberei. Tatsache ist, dass Sie hier sind. Wenn Sie diesen Fall knacken, sind wir vielleicht auf dem besten Weg, unsere eigene pollwertige Kriminologieabteilung zu bekommen.«
»Zunächst mal: Ich knacke keine Fälle.«
Diesmal ist ein abschätziges Schnauben die Reaktion. »Sie wissen, was ich meine. Obwohl Sie nach dem Okriki-Three-Fall die Fublicity gescheut haben, haben wir doch von denjenigen, die wissen, was Sie geleistet haben, viel Wohlwollen erfahren. Aber bei dieser Geschichte können Sie den Medien nicht entkommen.«
»Malen Sie den Teufel nicht an die Wand!« Ich hebe die Hände, als wollte ich die Vorstellung abwehren, wie die Paparazzi mein Haus und mein Büro belagern. »Außerdem könnte es sein, dass diese Frau morgen schon wieder auftaucht.«
»Morgen ist morgen. Heute sind Sie von einer der größten Kirchen im Land engagiert worden, um sie zu finden.«
»Es geht nicht darum, sie zu finden. Ich sagte Ihnen doch …«
Abubakar macht eine ungeduldige Handbewegung. »Ich weiß, ich weiß. Der Ehemann wird zu Unrecht beschuldigt, Sie sollen rausfinden, von wem und warum. Alles schön und gut, aber wie wollen Sie das machen, ohne dass Sie sie zunächst mal finden?«
Mein Gesichtsausdruck muss wohl verraten haben, dass mir das selbst noch nicht ganz klar ist, denn Abubakar reibt sich in diebischer Freude die Hände und bricht in einen Schwall von Hausa aus.
»Babu wata jayayya daga gareni! Ich bin dabei.«
»Wobei?«
»Bei allem, was Sie von mir wünschen. Deswegen sind Sie doch zu mir gekommen, nicht wahr? Und deswegen lassen Sie sich meine Qualmerei gefallen, obwohl Sie Zigarettenrauch hassen.«
Ich muss laut lachen. Der Kommandant war immer schon schnell von Begriff.
»Das Ermittlerteam. Ich muss wissen, wer ihnen den Hinweis gegeben hat.«
»Sie brauchen die Fallakte?«
Ich nicke. »Die Akte und Kontakt zu den ermittelnden Beamten.«
»Wo ist der Pall angesiedelt? Beim Präsidium oder beim örtlichen Revier?«
Ich schüttle den Kopf. »Keine Ahnung. Ich weiß nur, wo der Bischof festgehalten wird.«
»Das ist doch ein Anfang. Wo?«
Ich konsultiere die Notizen, die ich auf mein Handy übertragen habe. »Im Ikoyi Model Prison.«
Abubakar runzelt die Stirn. »Er wohnt nicht in seinem Kirchenkomplex?«
Ich zucke mit den Schultern und spare mir eine kritische Bemerkung zu der Vorstellung, dass eine Kirche einem einzelnen Menschen gehören könnte. »Er besitzt dort ein Gästehaus. Die Kirche mit dem zugehörigen Anwesen ist als seine Geschäftsadresse registriert, aber wohnhaft gemeldet ist er in Ikoyi.«
Abubakar nickt erneut, und die Falten in seiner Stirn werden tiefer. Ich weiß, dass er gerade im Geist sein beachtliches Netzwerk nach der schnellsten und zuverlässigsten Quelle für die Information durchforstet, die ich benötige. Während er die nächste Zigarette hervorholt, ergreife ich rasch das Wort, bevor er sie anstecken kann.
»Kennen Sie zufällig jemanden in dem Gefängnis?«
Wenige Minuten nachdem ich Abubakars Büro verlassen habe, schickt er mir bereits die Kontaktdaten des Direktors des Ikoyo Model Prison und teilt mir in einer Textnachricht mit, dass er für morgen einen Termin bei Bischof Dawodu für mich vereinbart hat.
Infolgedessen bin ich bei meinem anschließenden Seminar über Befragungstechniken nicht so ganz bei der Sache. Zum Glück stehen heute Rollenspiele und nicht theoretische Grundlagen auf dem Programm, und ich kann mich darauf beschränken, zuzuhören, Ratschläge zu erteilen und die Diskussionen zu moderieren, während ich hoffe, dass es bald vorbei ist und ich mich wieder der Suche nach der vermissten First Lady widmen kann.
In meinem Büro wartet eine E-Mail von Pastor George auf mich. Ein sehr nüchternes Schreiben mit dem Briefkopf der Grace Church, in dem er seine »große Freude« über meine Entscheidung, den Fall zu übernehmen, zum Ausdruck bringt und mich bittet, die angehängte Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen und baldmöglichst zurückzuschicken. Wie fortschrittlich – eine Kirche, die eine NDA verlangt. Ich bin überrascht, dass die Erklärung nicht einmal drei Seiten lang ist, anders als die ellenlange Erklärung, durch die ich mich durcharbeiten müsste, wenn ich einen ähnlichen Fall in den Staaten übernehmen würde. Ich hänge meine elektronische Signatur an und klicke auf »Senden«.
Da ich keine weiteren Veranstaltungen habe und Folake die Kinder abholt, bleiben mir noch ein paar Stunden, ehe ich mich durch den Verkehr nach Hause quälen muss. Ich hole meinen Stapel verschiedenfarbiger Haftnotizen hervor und fange an zu schreiben.