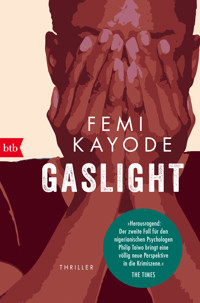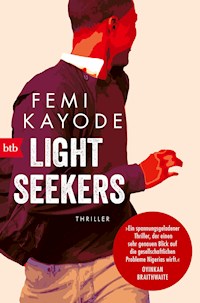
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Psychologe Dr. Philip Taiwo ermittelt
- Sprache: Deutsch
In der nigerianischen Universitätsstadt Port Harcourt werden drei junge Studenten von einem Mob verfolgt und brutal umgebracht – ein Video der grausamen Morde kursiert in den sozialen Medien, und den Tätern wird der Prozess gemacht.
Zu Prozessbeginn wird der Psychologe Dr. Philip Taiwo vom Vater eines der Opfer damit beauftragt, Licht in das Dunkel der schrecklichen Ereignisse zu bringen, die zum Tod seines Sohnes geführt haben. Taiwo, Spezialist für Massenpsychologie und Gewalt, hat lange im Ausland gelebt. In der abgelegenen Provinzstadt angekommen, muss er feststellen, dass ihm vieles fremd geworden ist in seiner Heimat, noch dazu weit weg von der Hauptstadt Lagos. Die Bewohner begegnen ihm mit Misstrauen. Und schnell wird Taiwo klar: Er ist nicht willkommen - und jemand setzt alles daran zu verhindern, dass er die Wahrheit aufdeckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
In der nigerianischen Universitätsstadt Port Harcourt werden drei junge Studenten von einem Mob verfolgt und brutal umgebracht – ein Video der grausamen Morde kursiert in den sozialen Medien, und den Tätern wird der Prozess gemacht.
Zu Prozessbeginn wird der Psychologe Dr. Philip Taiwo vom Vater eines der Opfer damit beauftragt, Licht in das Dunkel der schrecklichen Ereignisse zu bringen, die zum Tod seines Sohnes geführt haben. Taiwo, Spezialist für Massenpsychologie und Gewalt, hat lange im Ausland gelebt. In der abgelegenen Provinzstadt angekommen, muss er feststellen, dass ihm vieles fremd geworden ist in seiner Heimat, noch dazu weit weg von der Hauptstadt Lagos. Die Bewohner begegnen ihm mit Misstrauen. Und schnell wird Taiwo klar: Er ist nicht willkommen – und jemand setzt alles daran zu verhindern, dass er die Wahrheit aufdeckt.
Zum Autor
Femi Kayode wuchs in Nigeria auf, wo er Klinische Psychologie an der University of Ibadan in Lagos studierte, bevor er eine Karriere in der Werbebranche begann. Daneben hat er erfolgreich fürs Fernsehen gearbeitet. 2017 schloss er das renommierte Creative Writing Programm der University of East Anglia mit Auszeichnung ab. Für seinen Debütroman »Lightseekers« erhielt er den UEA Crime Writing Prize. Kayode lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Windhoek, Namibia.
FEMI KAYODE
LIGHTSEEKERS
THRILLER
Aus dem Englischen von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Lightseekers« bei Raven Books/Bloomsbury Publishing PLC, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Juli 2022
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2021 by Femi Kayode
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Arcangel Images / Elisabeth Ansley
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
MK · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-25600-5V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für meine Familie
und die Freunde,
die ein Teil von ihr geworden sind
URSPRUNG
Die Oktobersonne ist heiß wie das Blut des wütenden Mobs.
John Paul folgt der grölenden Menge, die die drei jungen Männer vor sich hertreibt. Man hat sie nackt ausgezogen, ihre Hodensäcke sind vor Angst geschrumpft, die Wunden, die man ihnen schlägt, werden nie vernarben. Stöcke. Steine. Ziegel. Eisen. Knochen brechen, Blut fließt. Aufplatzende Haut lässt kurzlebige Schreie aus erschöpften Lungen entweichen. Die Männer fallen hin, werden aber gleich wieder hochgerissen und durch die Straßen geschleift, zu einem Ort, den niemand ausgewählt hat, den aber alle zu kennen scheinen.
Am Tag zuvor hat es geregnet, und die rote Erde ist an vielen Stellen matschig. Wenn die jungen Männer hier fallen, werden sie noch tiefer in den Dreck getreten, ihr Blut vermischt sich mit dem Schlamm. Als ihnen dann die Autoreifen umgehängt werden wie überdimensionale Halsketten, als der Benzingeruch so stark wird, dass manche in der Menge sich die Nase zuhalten, hat der Wahnsinn den Tag schon im Würgegriff, den er nicht mehr lockern wird.
Ein Streichholz wird angerissen und gebiert eine Flamme, während im gleichen Moment ein Ziegelstein einem der Männer den Schädel zertrümmert. Mit der Hirnmasse entweicht das Leben, weshalb er nicht aufheult und sich windet wie die beiden anderen, als das Feuer an ihrer Haut und ihren Haaren zu züngeln beginnt.
Das Handy vibriert in John Pauls Hand. Die Ladeanzeige blinkt rot. Er lässt das Smartphone sinken und blickt sich um. Er ist nicht der Einzige, der die Hinrichtung digital aufzeichnet. Er überlegt, das Handy zu benutzen, das er einem der brennenden Männer abgenommen hat, bevor der Mob über sie herfiel, aber das wäre zu viel der Ironie. Es ist ohnehin vorbei. Zeit zu gehen.
Als John Paul den Platz verlässt, folge ich ihm im Schatten, doch das Bild des Albtraums, den er geschaffen hat, werde ich nicht mehr los.
Und weil er sich nicht umblickt, kann ich es auch nicht.
ERSTER AKT
Licht strahlt in verschiedene Richtungen ab, wenn es auf eine raue Oberfläche trifft
DAS WARUM, NICHT DAS WAS
Wenn mich nicht alles täuscht, wird in der Abflughalle des Lagos Domestic Airport jeden Moment ein Volksaufstand losbrechen.
»Wenigstens könnte uns mal jemand sagen, was hier eigentlich los ist!«, brüllt ein erzürnter Fluggast einer Airline-Mitarbeiterin ins Gesicht, die den Sprühregen aus Spucke mit unbewegter Miene über sich ergehen lässt.
Na, da kannst du lange warten, denke ich. Ich sitze mit einer Fleischpastete und einer Cola in Mr Biggs’ Restaurant gegenüber dem Check-in von 9ja Air – eine Position, die ich mit Bedacht gewählt habe, um nicht zurückgelassen zu werden, wenn der verspätete Flieger irgendwann doch in Richtung Port Harcourt abhebt.
»Sir, der Flug ist verspätet«, wiederholt die Mitarbeiterin. »Ich sagte Ihnen doch …«
»Warum ist er verspätet?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen, Sir. Wenn Sie sich bitte gedulden würden …«
»Wie lange noch?« Die Frage kommt von einer anderen verschwitzten Passagierin, die gar kein Recht hat, so frustriert zu sein – ich habe schließlich gesehen, wie sie erst knapp dreißig Minuten vor der planmäßigen Abflugzeit die Halle betreten hat. »Wir warten schon seit …«
Drei Stunden und siebzehn Minuten. Aber wenn man die Zeit mitrechnet, seit der Uber-Wagen mich am Flughafen abgesetzt hat, sind es schon über fünf Stunden. Die anderen Fluggäste sind wohl eher nicht von zu Hause geflüchtet, um einer Konfrontation mit dem untreuen Ehepartner aus dem Weg zu gehen. Okay, dem vermutlich untreuen Ehepartner. Dass ich heute in den frühen Morgenstunden so hastig meine Taschen gepackt und das Haus verlassen habe, hatte tatsächlich wenig mit Überpünktlichkeit zu tun, dafür umso mehr mit meinem Wunsch, der Frage auszuweichen, die mich mehr als alles andere beschäftigt:
Hast du eine Affäre?
Es hat mich all meine Willenskraft gekostet, mir heute Morgen diese Frage zu verkneifen, als Folake in ihrem leichten Baumwollhausmantel vor mir stand, die Arme vor der Brust verschränkt. Sie hatte ihre langen Locken aus dem Gesicht zurückgebunden, sodass der Ausdruck von Missbilligung, mit dem sie mir beim Packen zuschaute, nicht zu übersehen war.
»Du willst das wirklich tun?«
»Ja«, brummte ich und tat so, als ob ich Unterhosen abzählte.
»Und es ist dir egal, dass ich es für eine schlechte Idee halte?«
Ich legte die Boxershorts in meinen Koffer und antwortete in einem – wie ich hoffte – besonnenen und neutralen Tonfall: »Das haben wir doch schon ausdiskutiert, Folake.«
»Du bist kein Detektiv, Philip.« Sie betonte meinen Namen, wie sie es immer tut, wenn sie darum ringt, die Geduld zu wahren.
»Dein Vertrauen in mich ist mir Inspiration und Motivation zugleich«, erwiderte ich betrübt.
»Komm mir nicht so! Niemand hat mehr Vertrauen in dich gezeigt als ich!«
»Und du findest, jetzt reicht es allmählich?«
»Du kannst nicht in irgendein Dorf fahren, um einen Fall zu lösen, der schon vor über einem Jahr zu den Akten gelegt wurde, und dann erwarten, dass ich eine rauschende Abschiedsparty schmeiße.«
Ich drehte mich um und sah ihr endlich in die Augen.
»Ich löse keinen Fall. Ich untersuche, warum das, was passiert ist, passiert ist.«
»Was ist das denn anderes als einen Fall lösen? Du kannst doch wohl kaum verstehen, warum etwas passiert ist, ohne zu wissen, was passiert ist?«
Wenn ich in diesem Moment zu einer Erklärung meiner Arbeit als investigativer Psychologe angesetzt hätte, wäre ich jetzt nicht hier, um auf meinen verspäteten Flug zu warten. Obwohl wir uns bei unseren Promotionen gegenseitig unterstützt haben, tut meine Frau, wenn es ihr gerade in den Kram passt, immer noch so, als verstünde sie nicht, was ich mache.
»Folake, das ist eine Chance, meine Fähigkeiten in der wirklichen Welt anzuwenden …«
»In einer wirklich gefährlichen Welt«, unterbricht sie mich scharf.
Nun ja, ganz ungefährlich mag es nicht sein, wenn jemand wie ich, der bis vor acht Monaten den größten Teil seines Erwachsenenlebens in den USA verbracht hat, nach Okriki reist. Aber es wäre nett gewesen, wenn meine Frau stattdessen gesagt hätte: Geh nur, Schatz. Wenn irgendjemand herausfinden kann, warum drei Studenten von einem aufgebrachten Mob verbrannt wurden, dann bist das du. Du hast es drauf.
»Es ist ein waghalsiges Unterfangen, und das weißt du! Mir ist schleierhaft, was du damit beweisen willst.«
»Dass ich mehr bin als nur ein mittelmäßiger Akademiker ohne Festanstellung«, gab ich zurück und musste mich beherrschen, um nicht zu schreien.
»Die Festanstellung bekommst du nicht, indem du deine Familie zurücklässt, um einen dreifachen Mord zu untersuchen«, entgegnete sie in nicht minder schneidendem Ton.
Aber es wird mich davon ablenken, dass du mich wahrscheinlich betrügst.
Das sagte ich natürlich nicht laut. Ich hasse Streit, vor allem, wenn es laut wird. Außerdem gibt es nicht viele Menschen, die sich in einem Wortgefecht mit Professor Afolake Taiwo behaupten können, der jüngsten Professorin für Rechtswissenschaft an der Universität Lagos. In fast siebzehn Jahren Ehe habe ich kaum je in einem Streit mit meiner Frau die Oberhand behalten.
»Okay, Philip. Sagen wir, du gehst dorthin, und du findest heraus, was wirklich passiert ist oder warum es passiert ist. Was dann? Was willst du tun? Ein Buch schreiben?«
»Wir sind hier in Nigeria, Folake«, sagte ich mit sarkastischem Unterton. »Da gräbst du nicht die Details eines Lynchmords aus in der Hoffnung, einen Bestseller daraus zu machen.«
»Dann sag mir doch um Himmels willen, was du dir erhoffst?«
»Ich habe dir doch gesagt, dass der Vater eines der Opfer mich engagiert hat, um …«
»Ja, ja, ich weiß.« Sie warf die Hände in die Luft und rollte die Augen. »Er will, dass du einen Bericht schreibst, weil er nicht glaubt, dass sein Sohn ein Dieb war, obwohl alles in den sozialen Medien dokumentiert ist.«
»Hast du das Video gesehen?«
Folake schüttelte sich.
»Ich habe es mir mindestens hundert Mal angeschaut«, fuhr ich schnell fort, damit sie nicht wiedergeben musste, was sie auf einer der Websites gesehen hatte, auf denen der Tod der Okriki Three gepostet worden war. »Und weißt du was? Jedes Mal kommt mir der gleiche Gedanke: Die Leute können doch nicht so verrückt sein, dass sie drei junge Männer am helllichten Tag verbrennen, nur weil man sie beim Klauen erwischt hat.«
Folake setzte sich aufs Bett und ließ die Schultern hängen. Ich war mir nicht sicher, ob es wegen unseres Streits war oder wegen meiner Erwähnung des grausamen Videos.
»In diesem Land ergibt nichts einen Sinn«, sagte sie und schüttelte den Kopf.
»Alles ergibt einen Sinn, wenn du weißt, warum die Menschen tun, was sie tun.«
»Leeres Psychogeschwätz!«, stieß sie gereizt hervor, dann schlug sie sich die Hand vor den Mund, wie um ihre Worte zurückzunehmen. Sie hatte eine Grenze überschritten, und sie wusste es.
Ich beschäftigte mich umständlich mit dem Reißverschluss meines Koffers, bis ich mir sicher war, dass ich meine Gesichtszüge unter Kontrolle hatte. Als ich sie wieder ansah, war meine Stimme so neutral wie zu Beginn unseres Gesprächs.
»Danke. Ich werde jetzt gehen und mein Psychogeschwätz bei einem Auftrag anwenden, für den ich großzügig entlohnt werde. Entschuldige mich.«
Ich nahm den Koffer und verließ rasch das Zimmer, ehe sie Zeit hatte, sich zu besinnen.
Die wütende Stimme eines weiteren Fluggasts reißt mich aus meinen Gedanken.
»Das ist inakzeptabel! So etwas gibt es doch nur in Nigeria!«
Ich schätze, dass es noch ungefähr eine Stunde dauern wird, ehe die erzürnten Passagiere und das unfreundliche Bodenpersonal der Airline zu Handgreiflichkeiten übergehen. Ich hingegen wende meine Aufmerksamkeit dem einen Gegenstand zu, den ich zu verstehen gelernt habe.
Einem Tatort.
CHECKLISTE
Tatorte lassen sich auf einer Skala von ordentlich bis unglaublich chaotisch einordnen.
Ich versuche den Lärm des Flughafens auszublenden und denke über die Worte meines alten Lehrers und Mentors Professor Albert Cook nach.
»Der Tod ist Mist, Philip, aber Sterben ist eine Riesensauerei.«
Der Prof, wie ich ihn immer noch liebevoll nenne, hat sich nie die Vorstellung zu eigen gemacht, dass ein Tatort sich in eine vorgegebene Typologie einordnen ließe. Er sagte immer: »Menschen bauen Mist, und darin liegt der Schlüssel zu dem, was wirklich passiert ist.«
Der Prof war mein Doktorvater an der University of Southern California, mein erster Chef, und er war derjenige, der mich in das im Entstehen begriffene Gebiet der investigativen Psychologie einführte. Er ist inzwischen emeritiert, aber keineswegs im Ruhestand, immer noch damit beschäftigt, »im Dreck anderer Leute rumzuwühlen«, wie er es ausdrückt. Vielleicht sollte ich ihm den YouTube-Link mit der Hinrichtung der Okriki Three schicken. Es wäre interessant, die Gedanken des alten Mannes zu dieser speziellen Riesensauerei zu hören.
Ich werfe einen Blick in meine Notizen. In die Spalte, die ich mit Organisierter Tatort überschrieben habe, male ich ein großes Fragezeichen.
Wenn man bedenkt, wie sehr sich die Wut der Menge offenbar auf die drei jungen Männer konzentrierte, die sie tötete – die sie ermordete –, dann könnten zumindest einige der Kriterien für einen organisierten Tatort zutreffen. Etwa die Aggression, die gegen die Opfer gerichtet wurde, bevor man sie verbrannte. Ein klassischer Fall von Vorsatz. Und dann die Reifen. Die sind doch kaum einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Jemand – ob eine Person oder mehrere – muss sich die Mühe gemacht haben, sie an den Tatort zu bringen, den ich für diesen Analyseschritt auf den Ort beschränke, wo die jungen Männer letztendlich getötet wurden.
Personalisierung des Opfers/der Opfer. Theoretisch kann man davon ausgehen, dass ein Lynchmord nichts Persönliches ist und daher die Charakteristika eines unorganisierten Tatorts aufweist. Praktisch jedoch kann angesichts der übermäßigen Gewalt, mit der die Okriki Three getötet wurden, eine kollektive Aggressionsverschiebung nicht ausgeschlossen werden. Da die jungen Männer des Diebstahls beschuldigt wurden, könnte vielleicht eine beträchtliche Anzahl ihrer Angreifer Opfer von früheren ungesühnten Raubüberfällen gewesen sein. Aber ist dieses Argument auch haltbar, wenn es sich um fast hundert wütende Menschen handelt?
Ich setze mehrere Fragezeichen hinter »Personalisierung« und schreibe: Daten zur Rate von Raubüberfällen vor oder während des Monats der Morde ermitteln.
Es gibt noch weitere Indikatoren für einen organisierten Tatort: dass von den Opfern Unterwürfigkeit verlangt wird und sie irgendwann im Lauf der ganzen erschütternden Prozedur gefesselt werden. Beides sind klassische Kriterien. Aber damit enden die Übereinstimmungen mit der Typologie organisierter Tatorte.
Ich hebe den Kopf, um zu sehen, ob die ersten frustrierten Fluggäste schon handgreiflich geworden sind. Noch nicht. Ich wende mich wieder meinen Notizen zu und nehme mir die Liste der Charakteristika eines nicht organisierten Tatorts vor.
Leichen am Tatort zurückgelassen. Trifft zu.
Leichen werden nicht versteckt oder zugedeckt. Trifft zu.
Depersonalisierung der Opfer. Trifft zu.
Ich kreise diesen Punkt ein. Kann ich mit Sicherheit davon ausgehen? Ist es möglich, dass niemand die jungen Männer gekannt hat? Was ist mit der Person, die behauptet hatte, ausgeraubt worden zu sein?
Ich schreibe: Person, die Alarm geschlagen hat, befragen.
Minimaler verbaler Austausch. Ein Lynchmob lässt sich nicht auf Diskussionen oder Verhandlungen mit seinen Opfern ein. Trifft auch zu.
Spontaneität …
Offenbar ist die Menge über die Jungen hergefallen, nachdem Alarm geschlagen wurde, weil sie angeblich einen anderen Studenten außerhalb des Campus beraubt hatten. Da man ausschließen kann, dass hundert wütende Menschen nur auf der Lauer lagen, bis sie dazu aufgefordert wurden, sich an einem Necklacing-Mord zu beteiligen, trifft dieser Punkt ebenfalls zu.
Es stimmt – Sterben ist eine Sauerei. Die Widersprüchlichkeit der Kriterien bei diesem Tatort ist verwirrend, kann aber auch einmalige Möglichkeiten eröffnen. Ich darf nicht vergessen, unvoreingenommen an die Sache heranzugehen, bis ich noch weitere Daten zur Verfügung habe, die über die Standfotos aus den YouTube-Videos und die Befragungen der Eltern der Opfer hinausgehen.
Ich schreibe: Ein einzelnes Motiv, verdeckt durch ein kollektives Ziel oder Vorurteil? Das könnte die unklare Typologie erklären, das aufschlussreichste Kriterium eines unorganisierten Tatorts.
Unerwartete und plötzliche Gewalt gegen Opfer. Trifft zu.
Hier halte ich inne. Wie unerwartet und plötzlich war die Gewalt denn? Was die Beteiligten und Betroffenen über ein Verbrechen aussagen, ist genauso wichtig wie der Tatort selbst. Die Motivationen der Befragten – Täter, Opfer oder Zeugen – können ein entscheidendes Licht auf das werfen, was tatsächlich passiert ist.
Ich blättere weiter zu der Seite, wo ich mir den Namen notiert habe: Emeka Nwamadi.
ERSTER KONTAKT
»Chiemeka Nwamadi«, stellte er sich vor, als er mir die Hand schüttelte.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr Nwamadi.«
»Emeka, bitte. Wir wollen doch nicht so förmlich sein.«
»Nein, und wir wollen uns auch nicht die Beine in den Bauch stehen«, meinte Abubakar Tukur, der mein Chef gewesen wäre, wenn ich an der Polizeiakademie einen festen Vertrag bekommen hätte und nicht nur einen als Gastdozent, dessen Dienste nur dann in Anspruch genommen werden, wenn das Budget es zulässt. Er bat uns – oder befahl uns vielmehr –, in der ersten Stuhlreihe vor dem Pult Platz zu nehmen, an dem ich gerade eine Vorlesung über Crowd-Management gehalten hatte. Abubakar ist von der alten Schule – der 32. Kommandant der Polizeiakademie, der immer noch Illusionen hegt, die glorreichen Tage der nigerianischen Polizeitruppe wieder aufleben zu lassen.
Während wir es uns auf den stabilen Stühlen bequem machten, wurde ich das Gefühl nicht los, dass mir der Name Nwamadi irgendwie bekannt vorkam.
»Emeka ist Direktor der National Bank«, erklärte Abubakar, und da fiel der Groschen. Der Mann an der Spitze der drittgrößten Geschäftsbank des Landes. Als mir das klar wurde, tauchte ein weiteres nebulöses Detail am Rand meines Bewusstseins auf, und wieder kam mir Abubakar zu Hilfe.
»Ich weiß nicht, ob Sie vom Fall der Okriki Three gehört haben …«
Meine erste Reaktion war Schock, abgelöst von Mitgefühl. Drei Wochen nach Beginn meiner ersten Vorlesungsreihe über Massenpsychologie hatte ich den Polizeischülern die Aufgabe gestellt, Fallstudien von Verbrechen anzufertigen, die von Menschenmengen begangen worden waren. Über die Hälfte der Referate befasste sich mit einem Vorfall im Südosten des Landes, dem die Medien das Etikett »Okriki Three« verpasst hatten. Da die Referate größtenteils ziemlich unstrukturiert waren – wie die meisten Arbeiten von Studenten –, hatte ich mir die Zeit genommen und die Berichterstattung über den Fall nachgelesen. Daher wusste ich, dass Emeka Nwamadi der Vater eines der drei jungen Studenten war, die vor über einem Jahr in der Universitätsstadt Okriki zusammengeschlagen und verbrannt worden waren. Der Kampf, den er zusammen mit den Eltern der anderen Opfer geführt hatte, um die Mörder vor Gericht zu bringen, hatte Monate, bevor ich die Staaten verließ, die Schlagzeilen beherrscht. Damals war ich meiner Frau nach Nigeria gefolgt, die ihr Forschungsjahr an der University of Lagos angetreten hatte.
Was sagt man zu einem Vater, der ein Kind auf so unsagbar grausame Weise verloren hat?
»Es tut mir sehr leid, Sir«, kondolierte ich ihm unbeholfen.
Emeka Nwamadi nickte mit unbewegter Miene.
»Deswegen sind wir hier, Philip. Jeder weiß, was passiert ist.« Es klang eher wie »Phirif«. Wenn Abubakar erregt ist, schlägt seine Hausa-Herkunft durch, und dann klingt sein P wie ein F, und das R verschwimmt mit dem L.
Tatsächlich wusste ich damals noch längst nicht alles. Nachdem ich genug gelesen hatte, um die Referate der Polizeischüler benoten zu können, versuchte ich die ganze Geschichte bewusst auszublenden. Meine Zwillingssöhne sind gerade sechzehn geworden, und es braucht nicht viel Fantasie, sich die beiden an einer Universität vorzustellen, weit weg von zu Hause, wo sie sich auf einmal zur falschen Zeit am falschen Ort wiederfinden könnten. Es war der reine Selbstschutz, der mich davon abhielt, über die Okriki Three zu recherchieren oder mir auch nur das YouTube-Video anzuschauen.
»Ich bin mir nicht sicher, wie ich da behilflich sein kann, Sir«, erwiderte ich.
»Sagen Sie es ihm.« Abubakar nickte Emeka zu.
Statt einer Antwort griff Emeka in seine lederne Aktentasche und zog zwei gebundene Dokumente heraus. Er legte sie auf das Pult zwischen uns, und ich erkannte sie sofort wieder. Das erste war meine Masterarbeit mit dem poetischen Titel »Fremde Frucht: Zum Verständnis der Psychologie von Lynchmobs in den Südstaaten.« Das zweite war meine Doktorarbeit, in gewisser Weise eine Fortsetzung: »Fremde Ernte: Wie Lynchmobs ungestraft morden können.« Beide Arbeiten waren offenbar von der Online-Bibliothek der Universität, an der ich recherchiert und sie geschrieben hatte, heruntergeladen und ausgedruckt worden. Ich hatte sie auch meinem Lebenslauf beigelegt, als ich mich an der Polizeiakademie beworben hatte.
Ich sah Abubakar an, doch es war Emeka, der das Wort ergriff.
»Es kursieren viele Geschichten über die Ereignisse an dem Tag, als mein Sohn getötet wurde. Ich glaube sie alle nicht, und ich bin hier, um Sie zu bitten: Helfen Sie mir herauszufinden, was wirklich passiert ist.«
Solche Anfragen waren nichts Neues für mich, darum hatte ich meine Standardantwort parat. »Sie dürfen mich nicht mit einem Privatdetektiv verwechseln, Mr Nwamadi. Ich bin Psychologe mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Motive von Verbrechen und der Vorgehensweise der Täter. Beim Großteil meiner Forschungen handelt es sich um rein akademische Untersuchungen.«
Nach Jahren, in denen ich meinen Kollegen vom San Francisco Police Department immer wieder die Grenzen meines Expertenwissens erläutern musste, hatte ich die Rede fast schon im Schlaf drauf.
»Ich habe diese Bücher gelesen«, sagte Emeka und deutete auf die Ausdrucke.
»Es sind wissenschaftliche Abhandlungen.«
»Und zwar hervorragende, wenn Sie mich fragen. So etwas wie Ihre Analyse des Massenverhaltens ist mir noch nicht untergekommen.«
»Es sind Ex-post-Analysen, kaum von forensischem Wert«, sagte ich, meine eigene Leistung herabwürdigend, aber in Wirklichkeit freute ich mich über das Kompliment.
»Nichtsdestotrotz aufschlussreich«, insistierte Emeka.
»Ich sagte Ihnen doch, Emeka, er ist bescheiden«, bemerkte Abubakar, dann wandte er sich wieder an mich. »Phirif« – der Hausa-Polizeichef war jetzt wieder voll da –, »Sie sind der Einzige hier, der rekonstruieren kann, was passiert ist. Diese Leute brauchen Ihre Hilfe. Als der einzige investigative Psychologe in diesem Land …«
»Der einzige, den Sie kennen.«
Abubakar machte eine wegwerfende Handbewegung, wie um einen lächerlichen Einwand abzuwehren. »Wenn ich die anderen nicht kenne, gibt es sie auch nicht. Sie kenne ich.«
Wenn ich etwas gelernt hatte in den achteinhalb ernüchternden Jahren, in denen ich beim SFPD die Motive und Vorgehensweisen der Täter bei einigen der entsetzlichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte »rekonstruieren« durfte, dann dass es bei einem Tötungsdelikt niemals irgendwelche Gewinner gibt. Ich war ganz zufrieden mit meiner Rolle als Dozent.
Ich wollte Emeka darum gerade eine höfliche, aber entschlossene Absage erteilen, als er fragte: »Haben Sie das Video gesehen, Dr. Taiwo?«
»Bitte nennen Sie mich Philip.«
»Philip«, schwenkte er prompt um. »Haben Sie das Video gesehen?«
Ich schüttelte den Kopf.
Emeka griff nach seinem Smartphone, tippte zweimal aufs Display und reichte es mir mit herausforderndem Blick. Sekunden später liefen in meiner Hand die letzten Minuten von Kevin Nwamadis Leben ab.
Noch eine ganze Weile, nachdem Abubakar und Emeka mich in dem Seminarraum zurückgelassen hatten, ließ mich der Schrecken dessen, was ich gesehen hatte, nicht los. Nach mehr als anderthalb Jahrzehnten des Studiums menschlicher Verfehlungen beherrsche ich die notwendige Kunst der Distanzierung fast perfekt. Aber es war das erste Mal, dass ich zusehen konnte, wie ein Verbrechen begangen wurde – oder vielmehr hilflos zusehen musste, weil es bereits passiert war und nicht mehr verhindert werden konnte.
Ich bekam die Bilder der drei jungen Männer, wie sie geprügelt, gedemütigt und verbrannt wurden, nicht mehr aus dem Kopf. Wie konnte ich auch nur annähernd den Schmerz ermessen, den Emeka Nwamadi und die anderen Eltern empfinden mussten? Der Verlust eines Kindes ist an sich schon unerträglich, aber zu sehen, wie dieser qualvolle Tod – dieses Sterben – immer wieder in einer Endlosschleife im Internet abläuft, das muss die Hölle auf Erden sein.
Es gab viele Gründe, warum der Auftrag den Forscher in mir reizte. Einer davon war die Gelegenheit, einige meiner Hypothesen zur Massenpsychologie im nigerianischen Kontext zu überprüfen. Zudem würde es sicherlich meine Chancen erhöhen, einen dauerhafteren Beratervertrag an der Polizeiakademie oder einer anderen, ebenso angesehenen Einrichtung zu ergattern. Doch letztlich war es der Vater in mir, der Emeka Nwamadi helfen wollte, Antworten zu finden. Die Antworten, die er so dringend brauchte, um seinen Seelenfrieden zu finden.
An diesem Tag machte ich früher Schluss und fuhr zu Folakes Büro, weil ich es kaum erwarten konnte, meine ersten Eindrücke von dem Fall mit ihr zu teilen. Aber dazu kam es nicht.
Es wurde vielmehr ein komplizierter Tag, gleichermaßen schmerzlich und deprimierend, denn als ich vom Parkplatz zu ihrem Fenster aufblickte, sah ich meine Frau in den Armen eines anderen Mannes.
DIE SÜNDEN DER VÄTER
In den Tagen nach dieser ersten Begegnung fragte Abubakar immer wieder bei mir nach und versuchte mich dazu zu überreden, den Auftrag anzunehmen. Ich konnte ihm schlecht sagen, dass die Okriki Three im Moment das Letzte waren, was mich interessierte. Ich ignorierte Emeka Nwamadis Textnachrichten und nahm auch seine Anrufe nicht an. Es war nicht etwa so, als ob ich mich querstellte – ich war einfach nicht in der Verfassung, irgendeine Verpflichtung einzugehen.
Bis zu dem Tag, als mein Vater mich zu sich bestellte.
Im Taiwo-Clan kann man den Ernst einer Situation an der Tageszeit erkennen, die meine Eltern für deren Besprechung ansetzen. Für das ganze Spektrum von einer Gardinenpredigt wegen unterdurchschnittlicher schulischer Leistungen bis hin zu schwerwiegenden Verletzungen der Familienehre fanden die Familienkonferenzen immer am späten Abend statt, da zu dieser Zeit keine Störung durch Besucher zu befürchten war. Für ernste Gespräche, die mein Vater »Strategiebesprechungen« nennt, sind hingegen heutzutage die frühen Morgenstunden reserviert. Dann wird über Karriereplanung diskutiert, es geht um das Verhalten des einen oder anderen meiner drei Geschwister oder um die Höhe unseres finanziellen Beitrags zu diversen Familienprojekten, zu denen mein Vater seine Kinder verpflichtet, gewöhnlich ohne unsere Zustimmung.
Als ich die Textnachricht erhielt, in der ich aufgefordert wurde, mich in aller Frühe in unserem Einfamilienhaus auf Lagos Island einzufinden, fragte ich mich, ob Folake ihm ihren Fehltritt gebeichtet und ihn als Vermittler eingespannt hatte, um meine Vergebung zu erbitten. Aber ich verwarf den Gedanken rasch wieder. Mein Vater ist Folakes Taufpate, und sie haben seit ihrer Kindheit ein sehr enges Verhältnis. Ich habe in meinem Leben nicht viel getan, was meinen Vater beeindruckt hat, aber seine Patentochter zu heiraten kann man wohl mit den Worten meines Zwillingsbruders als das »Schachmatt der Geschwisterrivalität« bezeichnen. Folake würde nicht riskieren, das Bild, das er von ihr hat, zu trüben, und wenn, dann nur als allerletzten Ausweg.
Dad wartete auf mich, als ich eintraf. Mom lag noch im Bett. Seit sie nicht mehr als Oberschwester in der Praxis meines Vaters arbeitet, besteht sie darauf auszuschlafen – sie habe schließlich dringend Erholung nötig, erklärte sie, nachdem sie zwei Zwillingspaare aufgezogen habe und zudem mit einem Workaholic als Ehemann fertigwerden musste. Auf die Frage, warum meine Eltern nicht mehr Kinder hätten, antwortete mein Dad stets scherzhaft, er habe befürchtet, dass sie als Nächstes Sechslinge bekommen würden. Er ist jetzt Ende siebzig und arbeitet immer noch in seiner Praxis unweit unseres Hauses, und es war klar, dass er sich gleich nach unserer Besprechung dorthin begeben würde.
»Kehinde!«, rief er, schloss mich in die Arme und führte mich dann durch das große Wohnzimmer in sein Arbeitszimmer.
Mein Vater nennt mich nie »Philip«. Er besteht darauf, dass »Kehinde« der Name ist, mit dem ich geboren wurde, und dass »Philip« die Idee meiner Mom bei der Taufe war. Es stimmte mich bedenklich, dass er mich nicht mit dem Spitznamen »Kenny Boy« ansprach, den er sich für mich ausgedacht hat, um mich von einer der jüngeren Zwillinge zu unterscheiden, die ebenfalls eine Kehinde ist. Sie heißt »Kenny Girl«. Während ich kein Problem damit habe, von dem alten Herrn so tituliert zu werden, ist meine Schwester alles andere als glücklich darüber, mit vierundvierzig noch »Mädchen« genannt zu werden.
»Ich habe letzte Woche mit den Jungs gesprochen«, sagte mein Vater, als ich auf dem abgenutzten Ledersofa Platz nahm, gegenüber dem Regal mit seiner eindrucksvollen Büchersammlung.
Ich atmete durch und wappnete mich mit Geduld, als der alte Herr mit seinem Lieblingsthema loslegte: die schulischen Leistungen seiner Enkelkinder oder vielmehr ihre Leistungsschwäche. Er klagte über ihre Handschrift, die er »krakelig« nannte – eine Kritik, die aus dem Mund eines Arztes irgendwie ironisch klang. Er ließ mich wissen, dass er gerade die Lektüre des Harry-Potter-Romans beendet hatte, den meine Tochter ihm geschenkt hatte. – »Hexen und Zauberer! Ist es das, was diese Kinder heutzutage lernen?« Er sprach über meine Mutter, die es sich in den Kopf gesetzt hatte, Gluten aus ihrem Speiseplan zu verbannen. »Ich bin achtundsiebzig! Was denkt sie sich dabei?«
Als er endlich eine Atempause einlegte, stand ich auf und ging zur Espressomaschine in der Ecke des Zimmers, ehe ich zu fragen wagte, warum er mich herbestellt habe.
»Setz dich!«, forderte Dad mich auf.
Ich gehorchte und verzichtete auf den Kaffee, immer noch nervös, weil ich keine Ahnung hatte, was er von mir wollte. Er setzte sich ebenfalls, und seine Miene wurde ernst, was meine Unruhe noch verstärkte.
»Ein guter Freund von mir sagt, dass du ihm aus dem Weg gehst«, begann er schließlich.
»Wie bitte?«
»Ich rede von Emeka Nwamadi.«
»Du kennst ihn?« Es hätte mich nicht überraschen sollen. Das Netzwerk der Freunde und Patienten meines Vaters liest sich wie ein Who’s Who der oberen Zehntausend von Lagos.
»Ja. Wir spielen zusammen Golf im Country Club.«
»Das hat er bei unserem Treffen nicht erwähnt. Er wurde mir vom Kommandanten der Polizeiakademie vorgestellt.«
»Ich weiß. Ich vermute, er wollte dich nicht ungebührlich beeinflussen.«
»Hmm, ich frage mich, was sich seither geändert hat«, bemerkte ich trocken und lehnte mich auf dem Sofa zurück, ein wenig entspannter, nachdem ich eine Vorstellung davon hatte, worum es hier ging.
»Es ist wirklich traurig, was mit seinem Sohn und diesen anderen Jungen passiert ist, findest du nicht?«
»Furchtbar«, entgegnete ich zögernd, während ich noch rätselte, worauf er genau hinauswollte.
»Ich finde, du solltest ernsthaft erwägen, den Fall zu übernehmen.« Er sah mir dabei unverwandt in die Augen, und sein Ton war eisern.
»Aber Dad, ich wüsste nicht, wie ich da helfen kann. Die ganzen Berichte …«
»… sind nichts als Spekulationen, Gerüchte und Mutmaßungen. Wir müssen die Wahrheit ans Licht bringen.«
»Wir?«
Mein Vater seufzte tief, stand auf und schleppte sich zu seinem Bücherregal, aus dem er eine zerfledderte braune Aktenmappe zog. Er nahm ein altes Foto heraus und reichte es mir.
Ich erkannte eine jüngere Version meines Vaters – meine Zwillingssöhne sehen ihm verblüffend ähnlich, und es war, als ob ich einen von ihnen auf dem Foto erblickte. Er war umringt von fünf anderen jungen Männern, alle ungefähr in seinem Alter.
»Aus deiner Studentenzeit, hm?« Ich glaubte, mindestens zwei der jungen Männer auf dem Foto zu erkennen. Ihre Gesichter waren mir von den Ehemaligentreffen vertraut, zu denen mein Vater schon des Öfteren in unser Haus eingeladen hatte.
»Meine Bruderschaft an der Universität von Ibadan.« Die Nostalgie milderte den Ton seiner Stimme. »Wir waren unzertrennlich. Als Brüder zusammenstehen oder als Narren untergehen, das war unser Motto.«
Mein Blick erfasste die roten Halstücher, die alle jungen Männer auf dem Foto trugen, und da wurde es mir plötzlich klar: »Dad, warst du in einem Kult?«
»Sag das nicht«, entgegnete er scharf. »Nenn uns nie wieder …«
»Bruderschaft, Kult – wo ist da der Unterschied?«
Er fuhr auf. »Wir waren Ehrenmänner.« Seine Stimme war herrisch und duldete keinen Widerspruch. »Wir hatten nichts gemein mit diesen Jungen von heute. Wir waren Brüder – politisch bewusst, hervorragende Akademiker und vor allem Gentlemen.«
Ich sah das Foto an, und meine Hand zitterte leicht, als mir klar wurde, dass ich das Bild, das ich von meinem Vater hatte, würde revidieren müssen, ganz gleich, was er sagte.
»Ich bin immer noch dieselbe Person«, sagte er, als hätte er meine Gedanken gelesen. Er setzte sich neben mich, nahm mir das Foto aus der Hand, und seine Stimme wurde sanfter, als er es betrachtete. »Genau wie all die anderen auf dieser Aufnahme. Das da«, er zeigte auf einen der jungen Männer, »ist Dr. Chukwuji Nwamadi. Er war einer der ersten Dozenten an der University of Nigeria in Nsukka, und wir verloren ihn, als der Campus während des Krieges bombardiert wurde. Wir Übrigen haben dann zusammengelegt und unterstützen seither seine Familie. Seine Frau, seine Kinder …« Er sah mich eindringlich an. »Und vor allem seinen ältesten Sohn Emeka.«
»Und deswegen willst du, dass ich den Fall übernehme? Weil du Emekas Vater gekannt hast?«
»Ich fühle mich für ihn verantwortlich. Alle anderen auf diesem Foto empfinden das genauso. Sein Vater war unser Bruder. Aber das hier geht darüber hinaus. Diese jungen Leute von heute, die mit Waffen herumlaufen und sich gegenseitig umbringen, die haben unser Vermächtnis in den Dreck gezogen. Die Gesetze, die wir durchgesetzt haben, das Bewusstsein für Ungerechtigkeiten, das wir geweckt haben, unser Protest gegen den Bürgerkrieg – all das ist vergessen, denn wenn die Menschen heute an Studentenverbindungen denken, sehen sie nichts als Chaos und Gewalt.« Er schauderte und schüttelte betrübt den Kopf. »Und wenn es zu einer so furchtbaren Gewalttat kommt wie im Fall dieser drei Jungen, muss man sich einfach fragen, welche Rolle wir bei dem Ganzen gespielt haben, ob all das Blutvergießen vermeidbar gewesen wäre. Das war nicht das, was wir damals wollten. Unsere Vision war ursprünglich eine heroische.« Er seufzte ernüchtert auf.
»Weiß Emeka das von dir? Ich meine, das mit der … äh, Bruderschaft.«
Mein Vater nickte. »Alle hier auf dem Foto haben zusammengelegt, damit er studieren und in den USA seinen MBA machen konnte. Er weiß Bescheid.«
»Glaubst du, dass sein Sohn getötet wurde, weil er in einem Kult war?«
»Was glaubst du?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht genug, um mir ein Urteil bilden zu können.«
Mein Vater nickte erneut. »Es gibt so vieles, was wir nicht wissen. Aber wenn die Fakten ans Licht kämen, gäbe es vielleicht eine Chance, dass sich die bedauerlichen Ereignisse, die zum Tod von Kevin und den anderen Jungen geführt haben, nie mehr wiederholen.«
Ich stand auf, denn ich wollte zumindest etwas körperlichen Abstand zwischen uns bringen. »Ich soll also nachweisen, dass die Morde nichts mit Bandenkriminalität zu tun hatten, damit du und deine Freunde nachts besser schlafen könnt?«
»Ich will, dass du einem trauernden Vater hilfst, damit er seinen Seelenfrieden finden kann. Ich will, dass du die Wahrheit herausfindest, und wenn die Wahrheit etwas ist, was mein Gewissen noch mehr belastet, dann soll es so sein.«
Der joviale Doktor, der gütige Vater, der herzliche Großvater und der liebevolle Ehemann – sie alle waren verschwunden.
»Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass du …« Ich schüttelte den Kopf. »Wenn ich daran denke, was ich so über das Treiben dieser Banden auf dem Campus gehört habe …« Plötzlich fiel mir etwas ein. »Ich erinnere mich, wie du Taiye und mich angerufen hast, als wir überlegten, hier zu studieren. Du hast uns gesagt – nein, du hast uns gewarnt –, uns auf keinen Fall einem Kult anzuschließen.«
Dad hob mahnend den Zeigefinger. »Das Wort ›Kult‹ habe ich nie in den Mund genommen, als ich mit dir und deinem Bruder gesprochen habe. Ich sagte ›Banden‹.«
Ich schnaubte verächtlich. »Das ist also aus euren Bruderschaften geworden, wie? Brutale Banden, vor denen du deine eigenen Kinder warnen musstest?«
Mein Vater schüttelte den Kopf, doch er konnte mir keine Antwort geben, die mich von meiner Verwirrung erlöst hätte.
»Wir haben es versucht, Kehinde. Wir alle, Ehemalige von verschiedenen Bruderschaften an verschiedenen Universitäten im ganzen Land. Wir haben versucht, dieser Gewalt ein Ende zu setzen. Wir haben mit den Universitätsleitungen gesprochen, wir haben in Beratergremien gesessen und sogar geholfen, Gesetze zu formulieren, mit denen diese Gruppen, diese ›Geheimkulte‹, wie sie allgemein genannt werden, unter Kontrolle gebracht werden sollten. Aber nichts hat irgendetwas gefruchtet.«
»Warum hast du denn nichts gesagt? Warum hast du Taiye und mir nicht gesagt, dass du selbst in einer Bruderschaft warst, als du uns davor gewarnt hast?«
»Wenn du sehen könntest, wie du mich jetzt ansiehst, dann wüsstest du, warum.«
An diesem Morgen verließ ich mein Elternhaus mit schwerem Herzen. In weniger als einer Woche hatten die zwei Menschen, die mir am nächsten stehen, einige meiner tiefsten Überzeugungen ins Wanken gebracht. Meine Frau hatte meinen Glauben an unsere Ehe erschüttert, und mein Vater hatte mich dazu gebracht, dass ich an allem zweifelte, was ich in den vergangenen sechsundvierzig Jahren über ihn zu wissen geglaubt hatte.
Ich war noch nicht so weit, mich mit Folake auseinanderzusetzen, aber meine Ausbildung und meine Erfahrung befähigten mich, den Fall der Okriki Three zu übernehmen. Und so rief ich am Tag nach dem Gespräch mit meinem Vater Emeka Nwamadi an und nahm den Auftrag an.
Meinen Vater erwähnte ich nicht, doch ich wusste, dass er es wusste. Auf gewisse Weise waren wir nun miteinander verbunden.
ANKUNFT IN LETZTER MINUTE
»Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord von FlugNJ2406 nach Port Harcourt. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen …«
Man könnte meinen, es handelte sich um eine Verspätung von allenfalls einer Stunde. Und mit meiner Einschätzung der Menschenmenge am Check-in habe ich auch richtiggelegen. Nur die Ankündigung – vor gerade mal zwei Stunden –, dass die Maschine tatsächlich starten wird, hat verhindert, dass die Leute mit Fäusten auf das Bodenpersonal losgingen. Wartezeit insgesamt: fünf Stunden und achtundzwanzig Minuten. Somit habe ich fast acht Stunden im Mr Biggs gesessen, wo ich mir in regelmäßigen Abständen einen Imbiss bestellen musste, um mein Aufenthaltsrecht nicht zu verwirken.
»Captain Duke und die Crew werden ihr Bestes tun, um Sie so schnell wie möglich nach Port Harcourt zu bringen. Ihre Sicherheit und Ihr Komfort stehen für uns an oberster Stelle. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein, während die Maschine aufgetankt wird, dann kann es auch schon losgehen.«
Die Logik legt nahe, dass der Treibstoff für Flugzeuge nicht der gleiche ist, mit dem mein vier Jahre alter Toyota Prado fährt, aber dass unser Flieger nach der endlosen Verspätung jetzt noch aufgetankt werden muss, kann meine Zweifel daran, dass diese Maschine tatsächlich irgendwann in Port Harcourt ankommen wird, nicht gerade mindern.
Obwohl der Flug nicht länger als eine Stunde dauern soll, frage ich mich angesichts der langen Verzögerung einmal mehr, warum Emeka nicht auf meinen Vorschlag eingegangen ist, das Auto zu nehmen. Ich bin noch nie im Südosten des Landes gewesen, und ich hatte gehofft, dass die Fahrt, die laut GPS etwa zehn Stunden und fünfzehn Minuten dauern sollte, meine kulturelle Assimilation voranbringen würde. Doch Emeka und Abubakar hatten darauf bestanden, dass es sicherer sei zu fliegen, ganz abgesehen vom schlechten Zustand der Straßen. Der an lange Autofahrten gewöhnte Amerikaner in mir hatte gehofft, den Auftrag schnell erledigen und dann eine Spritztour zur kamerunischen Grenze machen zu können, doch Abubakar hätte sich fast an seinem Getränk verschluckt, als ich das erwähnte. Als ich um eine Erklärung bat, meinte er nur kryptisch, ich solle ihm vertrauen, es sei besser zu fliegen. Jetzt erst fällt mir auf, dass weder Emeka noch Abubakar behauptet haben, es sei schneller.
Endlich nimmt auch meine Sitznachbarin ihren Platz ein. Ich werfe einen Blick auf sie, und meine Sorge wegen einer möglichen weiteren Verzögerung ist auf einen Schlag vergessen. Ihr Gesicht ist perfekt geschminkt, ihre Taille ist in ein maßgeschneidertes Kleid gezwängt, das ihre üppige Figur betont, zumal als sie sich reckt, um mehrere Taschen in der Gepäckablage zu verstauen. Ihre lederne Laptoptasche passt nicht mehr hinein, weshalb sie sie unter den Sitz vor ihr schiebt, ehe sie sich mit einem Tausend-Megawatt-Lächeln mir zuwendet.
»Hi«, sagt sie.
Ich finde meine Stimme eine Sekunde zu spät wieder. »Hallo.«
»Ich hatte schon befürchtet, ich wäre zu spät.« Sie streicht ihr Kleid glatt und lehnt sich in ihrem Sitz zurück.
»Der Start hat sich verzögert.«
»Das hat mir mein Queue Boy auch gesagt, aber der Verkehr auf dem Weg hierher war die Hölle.«
»Queue Boy?«
Sie hebt eine professionell nachgezogene Augenbraue. »Jemand, den Sie dafür bezahlen, dass er sich für Sie in die Schlange stellt. Diese Flüge sind grundsätzlich verspätet. Also geben Sie jemandem Geld dafür, dass er sich für Sie anstellt und eincheckt. Und Sie anruft, wenn das Boarding beginnt.«
Ich kann meine Verblüffung schlecht verbergen. »Aber der Verkehr … Das ist doch wohl kaum zu schaffen in der Zeit zwischen dem Anruf und dem Start.«
Sie lacht – ein volltönendes, ansteckendes Lachen, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn auch nur eine der Frauen an Bord Folakes Nummer hätte, würde ihr Telefon in dieser Sekunde klingeln. Sie lassen Ihren Mann allein nach Port Harcourt reisen? Sind Sie wahnsinnig? Kommen Sie sofort her und retten Sie ihn vor diesem bösen Zauber, der sich in Chanel N° 5 hüllt!
Ein Mann mittleren Alters, der uns gegenüber auf der anderen Seite des Gangs sitzt, sieht uns schon an und macht ganz den Eindruck, dass er jederzeit bereit ist, den Platz mit mir zu tauschen.
»Deshalb bin ich ja auch als Letzte an Bord gegangen.«
Jetzt muss ich selbst lachen. Ich strecke die Hand aus. »Philip Taiwo. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Sie hält mir ihre beringten Finger hin. »Salome Briggs. Ganz meinerseits.«
Ich achte darauf, ihre Hand nicht zu lange zu halten. »Und was führt Sie nach Port Harcourt? Reisen Sie beruflich oder privat?«
»In PH muss es beides sein. Ich wohne dort. Lagos ist für mich immer beruflich. Und Sie?«
»Eindeutig beruflich.«
Ihr Blick ruht auf meinem Ehering. »Und Mrs Taiwo ist hier in Lagos?«
»Ja. Sie lehrt an der Unilag.« Ich höre den Stolz in meiner Stimme und nehme verärgert zur Kenntnis, dass mein Verdacht, Folake könnte mich betrügen, daran offenbar nichts ändern kann.
»Ah, der kluge Kopf der Familie«, meint Salome. »Dann sind Sie wohl das Geld, nehme ich an?«
»Leider nein. Aber ich arbeite daran. Daher die Dienstreise nach Port Harcourt.«
»Ich nehme an, Sie sind nicht sehr oft in diesem Teil des Landes?«
»Was hat mich verraten?«
»Dass Sie ›Port Harcourt‹ sagen, wo doch ›PH‹ vollkommen genügt.«
»Erwischt.«
Sie lacht. »Und was erwartet Sie Spannendes in PH?«
Ich bin mir nicht sicher, ob die Morde an den Okriki Three ein geeignetes Thema für Smalltalk auf einem solchen Inlandsflug sind. Aber andererseits bin unterwegs in eine mir völlig unbekannte Stadt, und meine nette Sitznachbarin wohnt dort.
»Ich schreibe einen Bericht über einen Vorfall, der sich dort vor ein paar Jahren ereignet hat. Das heißt, nicht genau dort, sondern in einem Ort in der Nähe.«
»Ich bin eigentlich eine gute Menschenkennerin, und ich würde mein iPhone verwetten, dass Sie kein Journalist sind.« Sie lehnt sich zu mir und fügt in einem verschwörerischen Flüsterton hinzu: »Mein ganzes Leben steckt in meinem iPhone.«
Ich muss unwillkürlich lachen. Bei Salome Briggs scheint alles auf größtmöglichen Effekt angelegt zu sein, von ihrem Make-up über ihre Kleidung bis hin zu ihrer Redeweise.
»Ich bin investigativer Psychologe.«
»So eine Art Therapeut?«
»Nein, nein …« Ich muss wieder lachen, diesmal darüber, wie sich ihre kajalgeschminkten Augen weiten, als ob ich ihr gerade gestanden hätte, dass ich Tupac Shakur in meinem Haus verstecke. »Ich untersuche Verbrechen und analysiere, warum und wie sie sich ereignet haben.«
Sie schnaubt verächtlich, wie es nur eine Nigerianerin kann. Ein abschätziges Knurren, begleitet von mimischen Verrenkungen, bei denen gleichzeitig die Augen verdreht, die Brauen hochgezogen und die Mundwinkel nach unten gebogen werden. »Wozu soll das gut sein? Es ist schon passiert, abi?«
»Wenn wir verstehen, wie sich ein bestimmtes Verbrechen ereignet hat, und die Motivationen erkennen, die dazu geführt haben, steigert das deutlich die Chancen, einer Wiederholung vorzubeugen.«
»Hmm. Das hat man Ihnen wohl erzählt, als Sie Ihre Bewerbungsunterlagen für die amerikanische Elite-Uni ausgefüllt haben, an der Sie studiert haben, stimmt’s?«
Ich sollte mich eigentlich auf den Schlips getreten fühlen, aber es gelingt mir nicht. »Bin ich so leicht zu durchschauen?«
»Keine Sorge, ich werde es nicht Ihrem Ehemaligen-Club erzählen. Also, zurück zu diesem Vorfall. Sie schreiben also einen Bericht darüber, damit es nicht noch mal passiert?«
»Es ist schon ein bisschen komplizierter …«
»Ladies and Gentlemen, wir bitten Sie nun, Ihre elektronischen Geräte auszuschalten und sich anzuschnallen, da wir in Kürze mit unseren Startvorbereitungen …«
Ich greife nach meinem Handy und sehe zwei Textnachrichten von Folake. Ich schalte es aus, ohne sie gelesen zu haben. Salome tut das Gleiche mit ihrem rosa-goldenen iPhone und einem weiteren, weniger protzigen Nicht-iPhone. Sie steckt beide Telefone sowie ihr iPad in das Seitenfach ihrer Laptoptasche und schiebt sie unter ihren Sitz, als die Maschine sich auch schon in Bewegung setzt. Sie lehnt sich zurück, blickt mich an und lässt mich wieder dieses Lächeln sehen.
»Definieren Sie ›kompliziert‹.«
»Hm?« Ich kämpfe noch gegen mein schlechtes Gewissen an, weil ich die Nachrichten meiner Frau nicht gelesen habe.
»Sie sagten, dieser Vorfall, den Sie untersuchen, sei kompliziert.«
»Die Medien haben es die Okriki Three genannt. Es ist ein tragischer …«
Ich verstumme, als Salome sich plötzlich abwendet und vorgibt, die Tasche unter ihrem Sitz zurechtzurücken, während das Flugzeug die Startbahn entlangrollt.
»Na, viel Glück dabei«, sagt sie ohne jede Spur ihrer vorherigen Herzlichkeit.
DER EMPFANG
Sobald die »Bitte-anschnallen«-Anzeige erloschen ist, holt Salome ihr iPad hervor, steckt ihre Ohrhörer ein und tut so, als hätten wir nicht gerade eben Bekanntschaft geschlossen. Sie ignoriert mich hartnäckig, während uns der Bordservice ein erbärmliches, in Zellophan gehülltes Sandwich mit Saft oder Wasser anbietet, das wir beide dankend ablehnen. Schließlich wende ich mich wieder meinen Notizen zu.
Wir sind schon über eine halbe Stunde in der Luft, als ich beschließe, den Elefanten bei den Stoßzähnen zu packen. Ich stupse sie mit dem Ellbogen an, sanft, aber fest genug, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Salome zieht eine Augenbraue hoch, behält aber die Ohrhörer drin. Ich deute darauf, und sie seufzt und nimmt widerwillig den linken heraus.
»Ich dachte, wir hätten da was am Laufen und …«
Kaum haben die Worte meinen Mund verlassen, wird mir klar, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Ihre Brauen wandern noch höher, und die Falte in ihrer Stirn verrät ihre Verärgerung.
»So habe ich das nicht gemeint …«, setze ich an.
»Wie haben Sie es denn gemeint? Nur weil ich Sie angelächelt habe und nett mit Ihnen geplaudert habe, denken Sie, wir hätten ›was am Laufen‹?«
»Es tut mir leid. Ich meinte … na ja, ich dachte, wir haben uns doch so interessant unterhalten, aber sobald ich den Grund für meine Reise nach Port Harcourt genannt habe, haben Sie einfach dichtgemacht.«
»Erstens: Wie interessant unser Gespräch war, ist ja wohl Ansichtssache. Sie haben natürlich ein Recht auf Ihre Ansicht. Zweitens: Wie ich schon sagte, ich habe einfach nur höflich mit einem Mitreisenden geplaudert und …«
»Es tut mir leid, wenn ich etwas Falsches gesagt oder Sie irgendwie verärgert habe.«
Sie schweigt. Mich dafür zu entschuldigen, dass ich nichts Falsches getan habe, ist eine Taktik, die ich in siebzehn Jahren Ehe gelernt habe.
»Es gibt nichts, wofür Sie sich entschuldigen müssen«, entgegnet Salome schließlich widerwillig.
»Doch. Ich vermisse die Freundin von vor dreißig Minuten.«
»Sie schließen ja schnell Freundschaften.«
»Nur wenn sie es wert sind. Ich gehe da nach meinem Bauchgefühl.«
»Dann laufen Sie Gefahr, verletzt zu werden.« Sie sagt es wie eine Warnung, und ich frage mich, ob sie von meiner Intuition redet oder von etwas anderem.
»Ich werde es überleben«, erwidere ich in dem nicht sehr überzeugenden Versuch, das Unbehagen zu übertünchen, das ihre Worte in mir auslösen.
Sie sieht mich einen Moment lang unverwandt an, dann lacht sie, was wieder neugierige Blicke der anderen Passagiere auf uns zieht. Sie steckt ihre Ohrstöpsel und das iPad ein, dann sieht sie mich wieder mit ihrem bezaubernden Lächeln an. »Okay, Mr Taiwo, fangen wir noch mal von vorne an …«
»Philip. Und das Leben ist zu kurz, deshalb würde ich lieber da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sie haben geblockt, als ich Ihnen den Grund für meine Reise nannte. Warum?«
Sie schweigt einen Moment, vielleicht um abzuschätzen, wie entschlossen ich bin, eine Antwort zu bekommen. »Weil Sie einen Tiger am Schwanz ziehen.«
»Es ist ein abgeschlossener Fall, Salome. Ich werde lediglich einen Bericht schreiben …«
»Ich kenne die Geschichte, Philip. Diese Jungen wurden im Heimatort meiner Mutter getötet.«
Später werde ich darüber nachdenken, wie eng die Fäden bei diesem Auftrag bereits ineinander verwoben sind. Aber vorerst fällt mir nichts Besseres ein, als zu sagen: »Das tut mir leid.«
»Muss es nicht. Aber ich kann Ihnen versichern, dass man Sie in Okriki nicht mit offenen Armen empfangen und Ihnen bereitwillig erzählen wird, was passiert ist. Oder, um Sie zu zitieren, warum und wie es passiert ist.«
»Dann könnte ich also ebenso gut gleich wieder umkehren und nach Lagos zurückfliegen?«
»Ja, das könnten Sie.«
»Und wenn ich es nicht tue?«
»Dann werde ich für Sie beten. So, können wir jetzt mal das Thema wechseln?« Ihr Blick gibt mir zu verstehen, dass sie ansonsten wieder zu den Ohrhörern greifen wird.
»Natürlich, warum nicht?«
Wir reden über meine Arbeit als Teilzeit-Dozent an der Polizeiakademie. Sie erzählt mir, dass sie Rechtsanwältin ist, spezialisiert auf die Öl- und Gasbranche, und ich lächle innerlich. Offenbar habe ich eine Schwäche für Anwältinnen.
»Ladies and Gentlemen, wir setzen in Kürze zum Landeanflug an. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Klapptisch vor Ihnen …«
Wir setzen ganz unspektakulär auf, und als das Okay zum Einschalten der Mobiltelefone gegeben wird, tauschen Salome und ich unsere Kontaktdaten aus. Sie steht auf, um ihre Taschen aus der Ablage zu nehmen.
»Wenn das alles Ihr Handgepäck ist, möchte ich gar nicht wissen, was Sie noch alles am Check-in aufgegeben haben.«
Sie schüttelt den Kopf und sieht mich mitleidig an. »Sobald diese Tür aufgeht, werden Sie sehen, warum ich auf Flügen nach PH niemals irgendwelches Gepäck aufgebe.«
Weder der Schwall heißer, feuchter Luft noch ihre Worte hätten irgendjemanden auf das Chaos vorbereiten können, das mich nach dem kurzen Fußweg vom Flugzeug zum Ankunftsbereich erwartet. Man sieht mir den Schock offenbar an, denn Salome fängt an zu lachen.
»Willkommen in PH, Mr Taiwo«, sagt sie. »Lassen Sie mal von sich hören.«
Ein angedeutetes Winken, dann ist sie verschwunden.
Ich blicke mich um und komme mir ziemlich verloren vor. Oben auf dem maroden Flughafengebäude prangt ein riesiges Schild: Port Harcourt International Airport. Doch das Gebäude selbst erweckt den Eindruck, als hätte jemand eifrig daran herumgebaut und wäre doch nie fertig geworden. Hinter mir steigen immer noch Passagiere aus, aber ich würde am liebsten zum Flugzeug zurückrennen und den Piloten zwingen, mich auf der Stelle nach Lagos und zu meinem gewohnten Leben zurückzubringen.
»Dr. Taiwo? Dr. Philip Taiwo?«
Die raue Stimme gehört einem dunkelhäutigen Mann, den ich auf Anfang dreißig schätze, wenngleich ihn das zerknitterte Hemd und die Krawatte älter aussehen lassen. Um seine Achseln herum sind Schweißflecken zu sehen, aber man kann erkennen, dass er sich Mühe gegeben hat, vorzeigbar und sogar professionell auszusehen. In der Hand hält er einen A4-Bogen mit meinem Namen und einem Foto, das offenbar von der Website der Polizeiakademie ausgedruckt wurde. Das muss der Begleiter sein, den Emeka mir versprochen hat.
»Ja, ich bin Philip Taiwo. Sind Sie Chika?«
Er lächelt und lässt dabei seine makellos weißen Zähne sehen. »Ja, Sir. Chika Makuochi.«
Wir schaffen es irgendwie, uns die Hand zu geben, während er sein improvisiertes Schild einsteckt und die Menschenmenge uns über das Rollfeld schubst.
»Kommen Sie bitte mit.«
Ich folge ihm in ein Zelt mit der Aufschrift »Ankunft«, wo mich noch mehr Chaos erwartet.
Koffer, billige »Ghana-must-go«-Jutetaschen, Kisten und andere Gepäckstücke liegen auf dem Boden verstreut, und Männer in Overalls schleppen noch mehr Gepäck herein und werfen es zu dem, das schon im Zelt herumliegt. Jetzt weiß ich, was Salome gemeint hat.
»Was ist Ihres?«
Ich sehe Chika verwirrt an.
»Ihr Gepäck, Sir. Zeigen Sie drauf, dann hole ich es.«
Im ersten Moment kann ich mich nicht an die Farbe des Koffers erinnern, den ich aufgegeben habe. Was, wenn ich auf ein Gepäckstück zeige, das nicht mir gehört, sondern nur so aussieht? Was, wenn ich eines wähle, in dem sich Schmuggelware befindet, und ich verhaftet werde?
»Keine Sorge. Zeigen Sie einfach drauf, und wir vergewissern uns, dass es Ihres ist, bevor wir fahren«, beruhigt mich Chika.
Ich muss wirklich noch an meinem Pokerface arbeiten.
Ich deute auf den Samsonite-Koffer, der dem am ähnlichsten sieht, in den ich vor über zehn Stunden meine Sachen gepackt habe. Chika geht ihn holen. Er dreht ihn hin und her, und wir sehen, dass das Namensschild die grobe Behandlung nicht überstanden hat.
»Ich glaube, es ist meiner.« Ich bücke mich, um die Kombination am Schloss einzustellen. 2302. Tag und Monat meiner Geburt. Das Schloss springt auf.
Chika schnappt sich den Koffer. »Folgen Sie mir, Sir.«
Er redet in schnellem Pidgin auf die Security-Leute ein, die sich uns in den Weg stellen. Er deutet auf mich, um zu zeigen, dass ich der Passagier bin, aber ich ahne, dass dies nur eine Formalität ist, denn er erklärt mir sogleich, dass er alles mit den entsprechenden Leuten »geregelt« hat, bevor sie ihm erlaubten, mich auf dem Rollfeld abzuholen. Ein anderer erkennt ihn wieder, es folgt noch ein kurzer Wortwechsel auf Pidgin, alle lachen, und dann lassen sie uns durch zum Ausgang.
Als wir den Land Cruiser erreichen, der auf dem Parkplatz auf uns wartet, bin ich erschöpft und nassgeschwitzt. Chika öffnet eine der hinteren Türen des Geländewagens und hält sie für mich auf, doch ich schüttle den Kopf und gebe ihm zu verstehen, dass ich lieber vorne sitzen möchte. Bevor ich einsteige, blicke ich mich um, um mich zu vergewissern, dass ich die letzten fünfzehn Minuten nicht geträumt habe.
»Es kann einen schon ein bisschen umhauen«, sagt Chika. »Der Flughafen ist seit über zehn Jahren in diesem Zustand. Was die Regierung nicht davon abhält, jedes Jahr Millionen für seine Fertigstellung bereitzustellen. Lassen Sie uns fahren, Sir.«
Er stellt den Motor an, und aus der Klimaanlage weht mir ein kalter Luftstrom entgegen.
»Willkommen in PH«, sagt Chika, während er schwungvoll zurücksetzt und den Wagen in Richtung Ausfahrt lenkt.
ES WERDE FINSTERNIS
»Wie lange fährt man nach Okriki?«, frage ich Chika, als er von der Flughafenzufahrt in eine Straße einbiegt, die eine On-Off-Beziehung mit Teer zu haben scheint.
»Etwa eine Stunde, Sir. Heute ist Sonntag, deshalb ist nur wenig Verkehr.«
Ich blicke mich um. Selbst wenn man berücksichtigt, dass dies nicht Lagos ist, eine solche Hauptverkehrsstraße ist eine Katastrophe. Wahrscheinlich wurde schon so mancher Flug verpasst, weil Reisende in Port Harcourts Version von »wenig Verkehr« feststeckten.
»Diese Straße führt nach Okriki« erklärt Chika. »Nach PH geht es da lang.«
»Wir sind gar nicht in Port Harcourt?«
»Nicht direkt. Der Flughafen gehört genau genommen zu Omagwa, das ist ein Vorort von PH. Diese Straße«, er deutet hinter uns, »führt nach Port Harcourt, aber vorher kommt man noch durch andere Städte wie Rukpokwu, Elele und Isiokpo.«
Ich höre nur mit halbem Ohr zu, während ich meine ersten Eindrücke von Port Harcourt verarbeite, der Hauptstadt des Bundesstaats Rivers, einer Stadt, die einst als so schön galt, dass sie den Beinamen »Garden City« bekam. Heute ist alles nur heiß und staubig, und ich bin nicht gnädig genug gestimmt, als dass ich irgendetwas von dem, was ich sehe, als Garten bezeichnen würde.
»Okriki liegt in der entgegengesetzten Richtung von PH«, erklärt Chika. »Aber vielleicht fahre ich irgendwann mal mit Ihnen hin und zeige Ihnen die Stadt.«
Plötzlich geht er vom Gas. Vor uns hat sich eine lange Autoschlange gebildet, es sieht nach einer Straßensperre aus.
»Polizei?«, frage ich.
»Militärpolizei.«
Ich überlege kurz, ob ich den »Passierschein« vorzeigen soll, den Abubakar mir vor meiner Abreise aus Lagos gegeben hat. Es ist eine echte Polizeimarke, und Abubakar hat mir versichert, dass sie mir bei diesem Auftrag viele Probleme aus dem Weg räumen könnte. Aber sogar ich weiß, dass bei einer Konfrontation mit der Militärpolizei – im Grunde Armeeoffiziere mit der zweifelhaften Befugnis, in Ermangelung eines Krieges Zivilisten zu terrorisieren – das Vorzeigen einer Polizeimarke eher kontraproduktiv sein kann.
»Der Trick besteht darin, nicht lange zu diskutieren, Sir«, sagt Chika, während er sich in eine andere Spur einfädelt, »sondern ihnen so schnell wie möglich etwas zuzustecken und dann zu verschwinden.«
Wir rücken im Schneckentempo auf die schwer bewaffneten Männer zu. Die Autofahrer vor uns werden routiniert abgefertigt. Der Offizier, der auf der Fahrerseite steht, bückt sich ein wenig und streckt die Hand ins Fenster. Er nimmt das Geld, das er behände in die Brusttasche seiner schusssicheren Weste steckt, dann gibt er seinem Kollegen, der ein Stück die Straße hinunter steht, ein Zeichen, die Sperre zu öffnen.
Als wir an der Reihe sind, blicke ich stur geradeaus. Chika übergibt das Geld, und wir dürfen weiterfahren. Ich sehe mich zu dem Polizisten um, der uns weiterwinkt. Seine Miene ist unerbittlich, nichts deutet darauf hin, dass er gerade das Gesetz gebrochen hat, das zu wahren er doch geschworen hat.
»Sind die jeden Tag hier?«
»Und nachts auch. Diese Straßensperren sind genauso schuld daran, dass man kaum vom Fleck kommt, wie die schlechten Straßen.«
»In Lagos ist es das Gleiche, aber da ist es meistens die normale Polizei.«
»Die militanten Gruppen und die Entführungen durch Banden haben diesen Teil des Landes de facto in einen Ausnahmezustand gestürzt.«
»Die Situation ist also immer noch so schlimm, wie man hört?«
Chika zuckt mit den Schultern. »Es ist ein bisschen besser geworden, aber die Lage ist immer noch ziemlich angespannt. Es klingt vielleicht seltsam, aber die Anwesenheit der Militärpolizei macht tatsächlich einen großen Unterschied. Die Gewalt ist jetzt sporadischer und hauptsächlich auf die Gegenden um die Ölquellen beschränkt.«
Ich wünschte, ich müsste mich nicht so darüber aufregen, wie sehr wir uns alle an dieses Paradox gewöhnt haben. Offenbar so sehr, dass niemand Militärangehörige zur Rede stellt, wenn sie am helllichten Tag Schmiergelder kassieren, dafür, dass sie uns vor der Gewalt schützen, die durch den ungerechten Zugang zum wertvollsten Bodenschatz des Landes ausgelöst wird: Erdöl. Die ganze Situation erfüllt mich mit dem gleichen hilflosen Zorn, den ich empfinde, wenn ich in den Staaten wegen meiner Hautfarbe von Kaufhausdetektiven beschattet werde. Die USA konnte ich immerhin verlassen, aber hier ist mein Frust noch intensiver, denn dies ist mein Heimatland.
Es wird dunkel, das einzige Licht kommt von den Scheinwerfern anderer Autos. Ich stelle Chika keine weiteren Fragen, denn er braucht seine fünf Sinne, um nicht von der Straße abzukommen.
Ich schließe die Augen – nicht länger als eine Minute, so kommt es mir vor.
»Wir sind da«, verkündet Chika.
Ich schrecke aus dem Schlaf hoch. Es ist stockfinster, nur hier und da flackern Lichter. Das Brummen von Generatoren begleitet unsere Fahrt durch die Stadt. In Lagos ist das ein vertrauter Soundtrack im hektischen Treiben des Alltags. In Okriki, weitab vom Lärm der Stadt, hört es sich an wie das unablässige Grollen von schweren Maschinen auf einer Baustelle.
»Die Stromversorgung ist hier normalerweise besser als in PH«, sagt Chika und sieht sich um. »Es wird sicher nicht lange dauern, bis das Licht wieder da ist.«
Der Optimismus der Nigerianer ist unerschütterlich, besonders, wenn es um Elektrizität geht. Doch seit meiner Rückkehr aus den Staaten habe ich mich damit abzufinden gelernt, dass die Hoffnung auf ein Leben ohne Blackouts so abwegig ist wie Abubakars Wunsch, die glorreiche Zeit der nigerianischen Polizeitruppe zurückzubringen.
»Ich habe heute schon für Sie eingecheckt, der Manager erwartet uns also.«
Ich sehe Menschen vor ihren Häusern sitzen. Vor den Bungalows hocken Männer zusammen, trinken und spielen Brettspiele, ihre Gesichter von Petroleumlampen erhellt. Kinder laufen lachend umher und spielen in der Dunkelheit. Aus der Ferne ist Gesang zu hören, dazu rhythmisches Händeklatschen. Eine Kirche. Oder vielmehr Kirchen, denn der Gesang scheint aus verschiedenen Richtungen zu kommen.
»Hier gibt es wohl viele Gotteshäuser?«, frage ich. Ich bin nicht wirklich überrascht, aber innerlich stöhne ich auf. In unserem Haus im Universitätsviertel sind wir abgeschottet von den Kirchen und Moscheen, die fast jede Straßenecke in Lagos mit ihren Gesängen und Megaphonen beschallen.
Chika hält vor einem Tor mit einem Schild, auf dem »Hotel Royale« steht. »In all diesen Kirchen gibt es jeden Tag einen Gottesdienst«, erklärt er, während er die Hupe betätigt. »Die Sonntagsmessen dauern den ganzen Tag.«
Das Tor wird von einem Wachmann geöffnet, der herzhaft gähnt, während er uns den Weg zu einem Gebäude weist, das mehr nach Gästehaus als nach Hotel aussieht.
Chika fährt auf das Grundstück. Gepflegte Rasenflächen werden von Lampen angestrahlt, die in verschiedenen Winkeln an dem zweigeschossigen, kastenförmigen Haus montiert sind. Der Generator, ein weißes Ungetüm an der Rückseite des Gebäudes, ist einer von der leiseren Sorte, wie sie von den besseren Hotels verwendet werden. Ich danke insgeheim dem Himmel dafür und hoffe nur, dass die Dieselvorräte für die Dauer meines Aufenthalts reichen.
Ein Bild von verblichener Pracht empfängt uns, als wir die Rezeption betreten. Die Lounge, die mit einer bunten Mischung von Sesseln, Sofas und Tischen vollgestellt ist, wird von zwei riesigen Fernsehern dominiert. Auf beiden Bildschirmen läuft mit aufgedrehtem Ton dasselbe Rugby-Match, doch der Empfangsbereich, der offenbar zugleich als Sportbar fungiert, ist menschenleer.