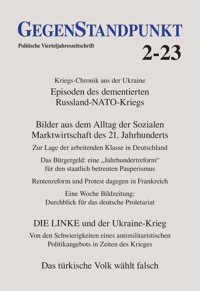
GegenStandpunkt 2-23 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gegenstandpunkt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kriegs-Chronik aus der Ukraine: Episoden des dementierten Russland-NATO-Kriegs In der Ukraine sind die drei aktiven Kriegsparteien mit der zielstrebigen Eskalation des kriegerischen Tötens und Verwüstens befasst; alle nach der Maxime, den Feind darin immer wieder zu überbieten, bis der nicht mehr mitgehen will oder kann – und auf keinen Fall derjenige zu sein, der irgendwann einlenkt. Dabei machen Russland und die USA mit ihren wechselseitigen Warnungen vor dem Einsatz von Atomwaffen deutlich, welche letzten Konsequenzen sie sich vorbehalten. Wir haben für diese Ausgabe des GegenStandpunkt Momente des laufenden Kriegsgeschehens, der dazu verabreichten Erklärungen und der diplomatischen Begleitaktionen notiert, erläutert und in die Form einer Chronik gebracht, um exemplarisch festzuhalten, wie diese Eskalation vonstattengeht: in größeren und kleinen Schritten, die über die unmittelbaren Kriegsparteien hinaus auch den ganzen Rest der Welt in die Auseinandersetzung hineinziehen und schon dabei sind, im nationalen und internationalen Staatsleben alltäglich zu werden. Gründe zur Parteinahme auch nur in dem Sinn, dass die Kriegszwecke und -aktionen einer der engagierten Parteien für die einer anderen – „immerhin“ – ein gewisses Verständnis wecken könnten, haben wir dabei nicht gefunden. * Vor lauter Engagement der Öffentlichkeit für die Verteidigung der Freiheit gegen Putins übergriffiges Regime geht ein bisschen unter, worin „unsere freiheitliche Lebensart“ materiell für die Mehrheit der Leute eigentlich besteht. Der GegenStandpunkt erinnert an ein paar ErrungenschaftenAus dem Alltag der sozialen Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts Der Mensch hat einen Job, mit dem er Geld verdient. Er kauft davon, was er für sich und ggf. seine Familie braucht. Um alles davor (Jugend in Ausbildung), danach (Rentner-Dasein) und den ganzen Rest kümmert sich der Staat. So ungefähr sieht die Welt ökonomisch für die Einwohner der modernen Marktwirtschaft aus. Stimmt ja auch, irgendwie: Geld verdienen oder aus einer öffentlichen Kasse beziehen, es ausgeben: Das sind die ergreifend schlichten Bestimmungen, aus denen sich die Lebensführung von unsereinem in ihrer knallbunten Vielfalt zusammensetzt. Im Prinzip. Ebendeswegen lohnt sich ab und zu ein Blick auf die elementaren Unterschiede, die in dieser Dreieinigkeit von Job, Einkaufen und staatlicher Betreuung systembildend enthalten sind. Im neuen GegenStandpunkt wird deswegen in einem Artikel „Zur Lage der arbeitenden Klasse“ daran erinnert, in welche trostlosen Formen der Erwerbsarbeit sich in unserem reichen Land das Massenschicksal derjenigen auffächert, die nur über sich selbst als Geldquelle verfügen. Wie affirmativ, berechnend, kaltblütig, dabei engagiert und menschlich zugewandt die Inhaber der öffentlichen Gewalt mit den bittersten Formen der Einkommenslosigkeit umgehen, die zu dieser Klassenlage ebenso dazugehört, erläutert ein Artikel über „Die neueste sozialdemokratische Errungenschaft: Bürgergeld“. Wie der französische Staat den Lebensunterhalt der Leute organisiert, denen er im Alter eine finale Auszeit vom Dasein als leibhaftige Erwerbsquelle zugesteht, vom Widerstand der Betroffenen gegen die laufende Reform und von der Antwort der Staatsgewalt berichtet der Artikel über „Die französische Rentenreform“. Den Abschluss der Serie bildet ein Blick auf „Eine Woche deutschnationaler Meinungsbildung durch die Bild“, die sich tagtäglich darum bemüht, das Dasein in Deutschlands nationaler Marktwirtschaft samt ausgewählten Zumutungen und Bewältigungsstrategien moralisch durchsichtig zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kriegs-Chronik aus der Ukraine
1.
Kriegschroniken werden verfasst, um am Leitfaden der Frage, wer angefangen hat, Täter und Opfer zu unterscheiden, so den Schuldigen zu ermitteln, dementsprechend Partei zu nehmen und sich damit das ganze grauenhafte Geschehen zu erklären. Dabei folgt die Parteinahme, wenn sie mit praktischen Konsequenzen von Staaten, nämlich deren Machthabern getroffen wird, nicht der Moral und auch nicht irgendeiner Rechtslage, sondern dem politischen Interesse, das – es ist ja eines der höchsten Instanz – als Recht, folglich mit Gewalt geltend gemacht wird. Beim zweckmäßig agitierten Publikum ist sie moralischer Natur, orientiert sich regelmäßig an den Entscheidungen, die in der Nation praktisch gelten, und lebt als privates Urteil – ohne andere Folgen als solche für den persönlichen Gefühlshaushalt – von der Dummheit, gerade in größeren zwischenstaatlichen Gewaltaffären den als Opfer eingestuften Staat, also einen jedes menschliche Maß überschreitenden Herrschaftsapparat, wie eine menschliche Person anzusehen, der man als redlicher Zeitgenosse gegen einen Überfall beizustehen hätte; und das bei näherer Überlegung auch noch ausgerechnet deswegen, weil die wirklichen Menschen mit ihrem ganzen Dasein diesem Herrschaftsapparat als seine Verfügungsmasse unterworfen, quasi inkorporiert sind.
Im Fall Ukraine-Krieg ist die Sache einfach und sofort erledigt: Mit dem Stichwort „Angriffskrieg“ – bei Bedarf mit Zusätzen wie „Putins“„brutaler“„unprovozierter“ – ist für nahe an 100 Prozent der freiheitlich-demokratischen Öffentlichkeit die Kriegsschuld geklärt, die Frage nach dem Kriegsgrund beantwortet: Allein und absolut Schuldiger ist Russland; als besondere Gründe kommen „Imperialismus“, „Angst vor Demokratie“, „postsowjetischer Phantomschmerz“ oder überhaupt nur „böse“ in Betracht. Auf Chronologien des Kriegsgeschehens wird deswegen natürlich nicht verzichtet. Sie geben den Kriegsverlauf wieder, gerne anhand so wertneutraler Fragestellungen wie: Wie sehr hat Putin sich verzockt? Warum dauern westliche Waffenlieferungen an die Ukraine so lange? Zerfällt die russische Armee? Was fehlt noch für eine erfolgreiche Offensive der Ukraine? Oder auch: Warum ist der ‚globale Süden‘ noch nicht auf antirussischer Linie? Auch da, wo der Informationsteil der Berichterstattung sich mit gekonnter Empörung über russische Missetaten, Genugtuung über russische Opfer, Häme im Fall russischer Niederlagen, Hoffnung auf ukrainische Siege etc. zurückhält, beherrscht die moralische Verurteilung Russlands als allgegenwärtige Prämisse jede ‚Erzählung‘ aus dem Kriegsgebiet.
2.
Die Penetranz dieser dezidiert antirussischen Berichterstattung provoziert manche alte Russland-Freunde zu dem Plädoyer, der Gegenseite doch auch einmal wenigstens Gehör zu schenken. Sie machen geltend, dass die Politik des Westens – die Osterweiterung der NATO, die ökonomische Annexion der ehemaligen Sowjetrepubliken durch die EU, die Förderung ‚farbiger‘ Revolutionen in Russlands ‚nahem Ausland‘ – in der Vorgeschichte des Krieges nicht außer Acht gelassen werden dürfe, dass also zumindest von „unprovoziert“ nicht ernsthaft die Rede sein kann. Dabei wird das alles im Rahmen der liberal-pluralistisch antirussischen Meinungsbildung gar nicht ignoriert oder verschwiegen. Da leistet man sich vielmehr ganz unbefangen den Widerspruch, aus erster und zweiter Hand wiederzugeben und auch selbstständig daran zu erinnern, dass, seit wann, in welchem Umfang, mit welchen Mitteln, sogar mit welcher weitreichenden Zielsetzung die USA und europäische NATO-Mächte die Ukraine auf einen Krieg mit Russland vorbereitet haben, den Krieg, wie er jetzt stattfindet, als ihre Sache betreiben – und zugleich das alles und insbesondere die antirussischen Kriegsziele des Westens als Lügengespinst zurückzuweisen, wenn auch nur etwas davon in offiziellen russischen Stellungnahmen zur Erklärung des eigenen Vorgehens erwähnt wird. Russland hat angefangen – wem damit nicht gleich alles klar ist, der macht sich nicht bloß als Abweichler verdächtig, sondern der Befürwortung eines Verbrechens schuldig.
3.
Tatsächlich hat eine alternative Chronologie, die den Blick auf das Geschehen einmal über den Februar 2022 hinaus nach rückwärts ausweitet, einiges für sich: Im besten Fall lernt man die imperialistischen und die antiamerikanischen, die speziell euroimperialistischen und die nationalistischen Berechnungen genauer kennen, die von den drei Kriegsparteien seit über einem Jahr so unerbittlich in die Tat umgesetzt werden.1) Und weil alle Kriegsparteien unter Verweis auf die Kriegsziele und Kalkulationen ihrer Feinde für sich in Anspruch nehmen, im Sinne der rechtfertigenden Unterscheidung von Opfer und Täter in Wahrheit der angegriffene Teil zu sein, der sich verteidigen muss und dazu auch alles Recht der Welt hat, kann man diese Berechnungen durchaus auch mal als Stoff für eine sachliche Erklärung hernehmen, was die Kriegsparteien tatsächlich so unbedingt zu verteidigen haben, i.e. welcher Räson ihrer Herrschaft sie folgen, wenn sie daraus die Unvereinbarkeit ihrer staatlichen Macht mit der ihrer Gegner folgern. Das hat immerhin den Vorteil, dass man – im besten Fall – auf die politische Notwendigkeit ihres Krieges zu sprechen kommt: auf die wirklichen Kriegsgründe, an denen sich jede moralische Bewertung blamiert.
Die „historische Wahrheit“ über die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges, so wie sie etwa von linken Friedensfreunden zwecks Korrektur der offiziellen und auch inoffiziell allgemeinverbindlichen Hetze ins Feld geführt wird, hat darin ihren entscheidenden Mangel: Aus der Dummheit der Schuldfrage führt sie nicht wirklich heraus. Am Ende ist sie nur die alternative Fassung des Fehlers, den Krieg per Schuldzuschreibung, nur eben nicht so einseitig antirussisch oder womöglich andersherum, zu erklären. Und etwas anderes kann die Frage, wer wirklich angefangen hat und wer zu Recht den Opferstatus für sich reklamieren kann, auch gar nicht erbringen, weil der historische Regress nach dem Schema von Reiz und Reaktion immer da stehen bleibt, wo entweder ein parteiliches Interesse sich ins Recht gesetzt sieht oder ein überparteilicher Standpunkt auf unentschieden plädiert – beides das Gegenteil einer Erklärung.
4.
In der Ukraine sind die drei aktiven Kriegsparteien mit der zielstrebigen Eskalation des kriegerischen Tötens und Verwüstens befasst; alle nach der Maxime, den Feind darin immer wieder zu überbieten, bis der nicht mehr mitgehen will oder kann – und auf keinen Fall derjenige zu sein, der irgendwann einlenkt. Dabei machen Russland und die USA mit ihren wechselseitigen Warnungen vor dem Einsatz von Atomwaffen deutlich, welche letzten Konsequenzen sie sich vorbehalten.
Wir haben für diese Nummer Momente des laufenden Kriegsgeschehens, der dazu verabreichten Erklärungen und der diplomatischen Begleitaktionen notiert, erläutert und in die Form einer Chronik gebracht, um exemplarisch festzuhalten, wie diese Eskalation vonstattengeht: in größeren und kleinen Schritten, die schon dabei sind, im nationalen und internationalen Staatsleben alltäglich zu werden.
Gründe zur Parteinahme auch nur in dem Sinn, dass die Kriegszwecke und -aktionen einer der engagierten Parteien für die einer anderen – ‚immerhin‘ – ein gewisses Verständnis wecken könnten, haben wir dabei nicht gefunden.
1) In diesem Sinne war der Kampf zwischen Russland und dem Westen in der und um die Ukraine in dieser Zeitschrift seit dem Umsturz 2014 immer wieder Thema. Eine Sammlung der einschlägigen Artikel aus den letzten Jahren findet sich unter: gegenstandpunkt.com/krieg-ukraine
© 2023 GegenStandpunkt Verlag
Episoden des dementierten Russland-NATO-Kriegs KW 9-11
Chinas Friedensplan
Ende Februar veröffentlicht China einen 12-Punkte-Friedensplan für die Ukraine. Nach einem Jahr, in dem hierzulande ‚Frieden‘ als Synonym für den ‚Sieg‘ unserer Ukraine galt, sorgt dieser Vorschlag für einigen Argwohn. Die unbedingte Parteinahme für den Erfolg der Ukraine, die der Westen überall fordert, bleibt China schuldig, wenn es beide Parteien und deren Unterstützer dazu auffordert, keine weiteren Eskalationsschritte mehr zu unternehmen und auf sofortige Friedensverhandlungen hinzuwirken. Kein Wunder also, dass die US-Diplomatin Nuland schon vor der Veröffentlichung des Plans bekannt gibt, was sie von ihm erwartet:
„Es kann nicht einfach ein zynischer Waffenstillstand sein, der den Russen Zeit gibt, nach Hause zu gehen, sich auszuruhen und gestärkt zurückzukehren...“
China hat auch noch die Stirn, sich auf das Völkerrecht und die UN-Charta zu berufen, und gibt, ohne auch nur eine Kriegspartei beim Namen nennen zu müssen, Russland und der Ukraine glatt gleichermaßen die Schuld an der fortschreitenden Eskalation; die westlichen Waffenlieferungen und Sanktionen gegen Russland stuft es sogar als unrechtmäßige Kriegsbeteiligung ein. Das Reich der Mitte geht noch weiter und erklärt das Prinzip für verletzt, wonach die Sicherheit eines Staates nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen Staates gehen darf – was jeder richtig zu deuten weiß: Die Osterweiterung der NATO beschädige die Sicherheitsinteressen Russlands und sei in diesem Sinn völkerrechtswidrig. Was dieser empörenden Stellungnahme erst so richtig ihre Schärfe verleiht, ist die Stellung,die China damit für sich reklamiert: Es nimmt sich das Recht heraus, sich nicht bloß als unbeteiligte und unparteiliche, sondern als überparteiliche Instanz aufzuführen; als Richter über den Krieg, der die Staaten daran misst, ob sie im Sinne der chinesischen Lesart des Völkerrechts handeln, also zu ihren Taten berechtigt sind oder nicht.
Das hat für die verschiedenen Parteien verschiedene Bedeutungen. Der Friedensplan bestreitet zwar Russland sein selbst definiertes Recht auf Kriegführung gemäß den eigenen Sicherheitsinteressen, rehabilitiert es jedoch als Macht, die auf der Geltung solcher Sicherheitsinteressen bestehen darf. Auch gegenüber dem Westen ist der chinesische Friedensplan und insbesondere die Warnung vor der Mentalität des Kalten Krieges eine Ansage: Ihm wird halb implizit, halb explizit das selbstdefinierte Recht abgesprochen, darüber zu entscheiden, was im Sinne des Völkerrechts ist und was nicht, womit China mehr als nur die Definitionshoheit des Westens über diesen Krieg angreift: Mit seinem Auftritt als besserer, weil absolut überparteilicher Weltordner und Friedensbringer stellt China das Recht der USA diplomatisch in Frage, als alleinige Weltmacht den anderen Staaten ihren Platz und ihr Recht im Verhältnis zum Rest der Welt zuzuweisen.
Der Kanzler erklärt „1 Jahr Zeitenwende“: eine deutsche Erfolgsstory
Vor den Kollegen im Bundestag zieht Scholz eine positive und vorwärtsweisende Bilanz. Der Umbau der Nation zu einer weltpolitisch ernstzunehmenden Militärmacht ist im vollen Gang; die dank Ukraine-Krieg erreichten Fortschritte sowie einige auftretende Defizite verbucht er als Auftrag zur noch konsequenteren Fortsetzung. Seiner patriotisch-kritischen Öffentlichkeit – „Wo bleibt sie denn, die schöne Zeitenwende?“ – erteilt Scholz die kongeniale Antwort: Sie ist längst da und eine einzige Erfolgsstory.
Den menschlichen Opfern in der Ukraine, mit deren Leid die Rede beginnt, wird der Stellenwert zuteil, die sie vom ersten Kriegstag an verdienen: als moralischer Auftraggeber für das deutsche Engagement an der Seite ihrer politischen Herrschaft. Unsere Solidarität gilt dem Kampf dieses „tapferen Volkes gegen Aggression und Unrecht des russischen Angriffs“. Es kämpft zugleich für den Frieden, den Deutschland braucht, weshalb der Kampf noch lange nicht aufhören darf:
„Ein Diktatfrieden gegen den Willen der Opfer verbietet sich aber nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch, wenn wir das Wohl unseres eigenen Landes, die Sicherheit Europas und der Welt im Auge haben: die zivilisatorischen Errungenschaften, auf die auch unser Friede baut.“
Letzteres geht an die Adresse der Kritiker mit ihrer schon wieder enttäuschten Hoffnung auf ein deutsches ‚Nie wieder Krieg!‘ Ihnen erklärt Scholz, dass Frieden nichts anderes sein darf als die Durchsetzung der überlegenen Gewalt des Westens: „Unser ‚Nie-wieder!‘ bedeutet, dass der Angriffskrieg niemals zurückkehrt als Mittel der Politik. Unser ‚Nie-wieder!‘ bedeutet, dass sich Putins Imperialismus nicht durchsetzen darf.“ Ein echt wirksamer, nachhaltiger Sieg über Russland, den der ach so „besonnene“ Scholz natürlich nie so nennt, muss also her, wenn der Frieden ein gerechter werden soll. Vom Bundeskanzler anschaulich gefasst in dem meistzitierten Satz der Rede: „Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung!“ Also muss eine friedliebende Republik für die gewaltsame Unterordnung der anderen Seite sorgen: Sie muss der ukrainischen Staatsführung immer mehr und bessere Waffen in die Hand drücken, damit die unter heldenhaftem Einsatz ihres uniformierten Menschenmaterials die Zurückdrängung Russlands in Angriff nehmen kann.
Dieses ‚Nie wieder Krieg!‘ heißt für die BRD erstmal ‚100 Milliarden Euro Sondervermögen‘ für die Aufrüstung der eigenen militärischen Potenzen, damit die Bundeswehr nicht nur nicht ‚blank‘ dasteht, sondern fähig ist, dem russischen Imperialismus ein ‚Nicht-mit-uns!‘ entgegenzusetzen. „Deutschland ist im Lichte der Zeitenwende widerstandsfähiger geworden. Am deutlichsten wird das, wenn man auf die Bundeswehr blickt.“ Der Kanzler will nicht nur, er kann sich das leisten: Die Mittel, die der viertgrößte Kapitalismus der Welt für seinen zivilen Staatshaushalt ausspuckt, reichen nicht nur für die eigenen Streitkräfte, sondern auch für stetig erweiterte Waffenlieferungen an den Partner in der Ukraine. Und da „haben wir schon mehr erreicht, als viele uns zutrauten“ – nicht zuletzt miterstklassigen Gebrauchswerten aus westlichen, europäischen und deutschen Rüstungsfabriken. Der Krieg gibt die Gelegenheit zu Scholz’ kleiner Leistungsschau nationaler Wehr- und Produktivkraft: Die umfasst „das Patriot-Luftabwehrsystem, den Schützenpanzer Marder, die Kampfpanzer Leopard 1 und 2“ sowie das „Luftverteidigungssystem IRIS-T“, „Haubitzen“, „den Flakpanzer Gepard“ usw.Er betont mit den maßgeblichen Leistungen dieser Geräte für den Krieg der Ukrainer dieLeistungen für wachsende deutsche Weltgeltung in der Konkurrenz der Rüstungsproduzenten.
Kriegsansagen
– Russland zieht sich aus dem internationalen Atomwaffenkontrollvertrag „New START“ zurück – und zwar so lange, bis die USA ihren Zweck aufgeben, Russland in der Ukraine eine „strategische Niederlage“ zufügen zu wollen. Von der russischen Ankündigung, sich mit der Aussetzung des Atomabkommens für die USA unberechenbarer zu machen, zeigen sich diese am Rande des G 20-Gipfels demonstrativ unbeeindruckt: Erstens wird die Ukraine so lange unterstützt wie nötig, zweitens hat sich Russland unabhängig vom Krieg in der Ukraine an den Atomwaffenkontrollvertrag zu halten und drittens hat es gefälligst einen inhaftierten US-Bürger freizulassen.
– „Es macht den Eindruck, als seien all diese Länder damit beschäftigt, alte unnötige Geräte zu entsorgen“ (Kreml-Sprecher Peskow): So will Russland die angekündigten MiG-29-Lieferungen aus Polen und der Slowakei also nehmen: als eine zwar eindeutige Eskalation, aber eine, die Russland mit einer eigenen gar nicht zu beantworten braucht. Dank seiner Überlegenheit auf dem Schlachtfeld kriegt es die neuen Waffen nämlich auch so kaputt: „Im Laufe der speziellen Militäroperation wird all diese Ausrüstung zerstört.“ Etwas anders sieht die Sache bei moderneren Kampfflugzeugen aus: Der frühere Kreml-Chef und jetzige Vizesekretär des russischen Sicherheitsrats Medwedew, ein russischer Hardliner, erklärt eine Übergabe von NATO-Kampfflugzeugen und deren Wartung in Polen zu einem direkten Kriegseintritt der NATO gegen Russland. „Jeder, der über die Lieferung (Reparatur) solcher Ausrüstungen oder Zerstörungsmittel sowie über ausländische Söldner und Militärausbilder entscheidet, müsste als legitimes militärisches Ziel betrachtet werden.“ Medwedew rechne zwar nicht damit, dass seine Drohung – bei der Feindschaft – die Lieferungen langfristig unterbindet, „denn die Versuchung, Russland zu vernichten, ist groß“. Aber auch dagegen weiß sich Russland zu wehren – mit welchen Waffen, braucht er wohl nicht noch einmal zu erwähnen.
– Der Kreml ist dabei „zu einer diplomatischen Lösung“ bereit. Dafür muss der Westen die „neuen Realitäten“ anerkennen: Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson sind russisches Staatsgebiet. Dieses oberste Kriegsziel, das Russland auf die Ebene eines „Existenzkampfes“ (Putin) hebt, ist zwar nur mit Waffengewalt erreichbar: „Wir müssen unsere Ziele erreichen. Aufgrund der aktuellen Position des Kiewer Regimes ist dies derzeit nur mit militärischen Mitteln möglich“ (Peskow). Aber dafür ist man jetzt besser gerüstet als 2014, als Russland es nur zu einer Annexion der Krim bringen konnte: „Wir hatten damals keine Hyperschallwaffen, aber jetzt haben wir sie.“ (Putin)
– Für eine Verhandlungslösung ist der Westen auch. Der deutsche Bundeskanzler Scholz stellt auf seiner USA-Reise klar, wie sie aussehen könnte: Russland hat als Vorbedingung alle Truppen abzuziehen, dann kann man weitersehen. Und weil ihm völlig klar ist, dass das für Russland unzumutbar ist, sagt er – obwohl er sich „jeden Tag wünscht, dass das anders wäre“ – einen langen Krieg an. Was dessen Ausgang angeht, ist er ganz optimistisch. Triumphierend erläutert er, dass sein Feind den Kriegswillen von Nato und Partnern unterschätzt hat: „Er hat die Einigkeit Europas, der Vereinigten Staaten und aller Freunde der Ukraine sowie die ständige Lieferung von Waffen, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen, falsch eingeschätzt.“ Die Ukrainer können dank der Macht, zu der ihre mächtigen Freunde sie gemacht haben, ihr Land verteidigen „und sie werden auch in Zukunft in der Lage sein, dies zu tun“. Die russische Niederlage, die allein den deutschen Wunsch nach Frieden zu befriedigen vermag, wird kommen.
Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer
Seit Kriegsbeginn setzen die USA Drohnen im Luftraum über dem Schwarzen Meer ein, um nachrichtendienstliche Informationen für die ukrainische Seite zu sammeln. Gegenüber Russland betreiben sie mit der demonstrativen Missachtung der Grenzen des von Russland definierten „Sondereinsatzgebietes“, die es bis ins Schwarze Meer hinein gezogen hat, den permanenten Test darauf, inwieweit es sich dieses Stück Kriegsbeteiligung gefallen lässt. Dem begegnet Russland mit dem Einsatz von Kampfflugzeugen, die die Aufklärung der Drohnen stören, ohne sie dabei direkt anzugreifen. Mitte März wird dabei erstmalig eine der amerikanischen Drohnen von zwei russischen Kampfjets zum Absturz gebracht. Beide Staaten bestellen wechselseitig ihre Botschafter ein, und die Verteidigungsminister sehen sich zum ersten Telefonat seit Oktober veranlasst.
Die USA stellen klar, dass sie mit ihren Drohnen im „internationalen Luftraum“ über „internationalem Gewässer“ agieren, sich also jedes Recht zusprechen, das auch in Zukunft zu tun. Sie definieren das Abdrängen der Drohne als Bruch des Völkerrechts, zu dem sich Russland zu bekennen hat, und untermauern ihren Anspruch durch die Veröffentlichung von Videomaterial, das die russische Schuld belegen soll. Indem sie ihre Spionage als legitimen Akt präsentieren, fordern sie Russland auf, diese unwidersprochen hinzunehmen. Das weist Russland entschieden zurück. Nicht nur besteht es darauf, dass die Drohne ganz ohne direkten Eingriff der russischen Kampfjets abgestürzt sei, es teilt den USA auch mit, dass es die Drohnenflüge als unzulässige Unterstützung der Ukraine, zudem als unrechtmäßige Übertretung seiner Grenzen nimmt und gegen derartige „Provokationen“ weiterhin vorgehen wird. Um seiner Entschlossenheit bei der Abwehr amerikanischer Einmischung Nachdruck zu verleihen, zeichnet der russische Verteidigungsminister die Piloten mit einem „Mut-Orden“ aus, der sie dafür ehrt, die Grenzen des Luftraums verteidigt zu haben. So teilen sich die Weltmächte ihre entgegengesetzten, unversöhnlichen Ansprüche mit.
Dabei bringen beide Seiten erneut die Frage ins Spiel, die seit Beginn des Krieges permanent auf dem Tisch liegt: Sie beschwören die Gefahr eines direkten, bewaffneten Konflikts, drohen also mit diesem Übergang – und geben gleichzeitig zu Protokoll, auch diesen Fall nicht als Anlass nehmen zu wollen, ihn zu vollziehen. Die USA nehmen sich die Freiheit, den Zusammenstoß als individuellen Fehler einzelner Piloten zu definieren, der aus bloßer Inkompetenz, d.h. ohne direkte Absicht begangen wurde und daher nicht als kriegerischer Akt zu werten ist. Und auch Russland beteuert, kein Interesse an der Eskalation zu haben, während es sich vorbehält, weiter gegen die amerikanischen Drohnen vorzugehen. So bestehen beide Seiten bei ihrem direkten Aufeinandertreffen darauf, dass der Krieg ein ukrainisch-russischer bleiben soll. Obgleich sie sich weiter die Gründe dafür liefern werden, soll eine direkte Konfrontation nicht sein.
© 2023 GegenStandpunkt Verlag
Episoden des dementierten Russland-NATO-Kriegs KW 12
Sachliche Auskünfte über die Schlacht um Bachmut
Die Kleinstadt Bachmut im Osten der Ukraine wird im Frühjahr 2023 endgültig berühmt:
„Bei der Schlacht um Bachmut handelt es sich ... mit mittlerweile [Stand Mitte März] mehr als 200 Tagen um eine der längsten Schlachten in der Weltgeschichte. Sie ist zu einer reinen Abnutzungs- und Materialschlacht bzw. zu einem Stellungskrieg geworden; keiner Seite gelang es bisher, relevante Gebietsgewinne zu erzielen... Die Schlacht ist die verlustreichste seit dem Zweiten Weltkrieg.“ (Wikipedia) „Seit die ehemalige 70.000-Einwohner-Stadt im September zur Frontstadt zwischen russischen Invasionstruppen und der ukrainischen Verteidigungsarmee wurde, ist sie zum berühmt-berüchtigten Symbol des Abnutzungskriegs geworden.“ (Bild) „Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Frontsoldaten in der Ostukraine betrage vier Stunden, sagte ein US-amerikanischer Marinesoldat. Besonders tödlich seien die Kämpfe in der vom Krieg zerrissenen Stadt Bachmut, die auch als ‚Fleischwolf‘ bezeichnet wird.“ (FR)
Ganze Armeen bringen sich auf Befehl von oben gegenseitig um. Die interessierte Fachwelt weiß das einzuordnen. Zum Beispiel in die Weltgeschichte; überhaupt oder seit dem 2. Weltkrieg. Oder in mehr sachliche Zusammenhänge: gehört zur Gattung der „reinen Materialschlachten“. Ja klar, dort geht massenhaft Material kaputt. Ist deswegen auch ein Fall von „Abnutzungsschlacht“: Was da kaputt geht, ist ein – wessen? – Gebrauchsgegenstand. Gebraucht wofür? Für einen irgendwie wohl naheliegenden Zweck, der aber nicht erreicht wird: Keine „relevanten Gebietsgewinne“. Auch das kennt man schon: Materialverschleiß ohne Gewinn ist „Stellungskrieg“. Auch das hat seinen militärischen Zweck: So geht eben „Abnützungskrieg“. Die Toten zählen mit als Materialverluste; wem sie vorher als Verschleißteile gehört haben und wozu gedient, versteht sich von selbst. Interessant, mitteilenswert ist das Tempo der Verluste, das sich am Personal als „durchschnittliche Lebenserwartung eines Frontsoldaten“ ausdrücken lässt: so viel linksliberales Mitgefühl muss in der Frankfurter Rundschau schon sein.
Was für eine Geisteshaltung ist hier eigentlich am Werk, bei einem solchen Blick auf die „Schlacht um Bachmut“? Die reine Sachlichkeit? Jedenfalls eine, die mit der ‚Sache‘ geistig umzugehen weiß. Die über ein Repertoire an fertigen Antworten verfügt, die eine Sinnfrage voraussetzen und auf ein geistig befriedigtes ‚Ach so ist das!‘ abzielen. Eine Sachlichkeit, die für jedes Interesse, das damit noch nicht fertig bedient ist, einen nächstschärferen Blick anzubieten hat:
„Sowohl für die ukrainischen als auch die russischen Streitkräfte hat Bachmut große strategische Bedeutung, sagt Marina Miron, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Militärethik am King’s College London. Die Eroberung der Stadt würde einen weiteren Vormarsch russischer Truppen bedeuten – etwa in Richtung Kramatorsk. ‚Sie würden dann wichtige Straßen kontrollieren, die ukrainischen Streitkräfte abschneiden und ihnen die Verteidigung erheblich erschweren‘, sagt sie.“ (dw.com)
Angesprochen und bedient wird die Nachfrage nach einem verständlichen – im Sinne von plausibel nachvollziehbaren – Zweck des großen Umbringens. „Wichtige Straßen kontrollieren“ – das kann auch der Laie als sinnvoll abnicken; inwiefern und für wen ‚wichtig‘, das ist gleich klar. Das Gleiche gilt für die entgegengesetzte Auskunft:
„Bachmut hat an sich wenig strategischen Wert. Es geht um Symbolik. Wenn Russland die Stadt erobert, erringt es seinen ersten klaren Sieg seit der Einnahme der Industriestadt Sewerodonezk im Juni 2022 – um den Preis mehrerer Toter pro Meter bei zwei Kilometern Geländegewinn im Monat. Wenn die Ukraine Bachmut hält, zeigt sie, dass sie auch den massivsten Angriffen widerstehen kann – beste Voraussetzung für die geplante Großoffensive gegen die russische Besatzung insgesamt.“ (taz.de)
„Symbolik“ tut es auch: Wenn ein Sieg sonst nichts bringt, gibt der Sieg als solcher dem „Preis“ einen Sinn, den Russland zu zahlen hat und der diesmal überschlägig mit toten Frontsoldaten „pro Meter Geländegewinn“ angegeben wird, was immerhin Zweifel am Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag weckt und in dem Fall auch durchaus hämisch klingen darf. Nicht weniger sinnvoll vom Standpunkt der anderen Seite eine vermiedene Niederlage, die immerhin – da endet die überparteiliche Sachlichkeit, die sich affirmativ mitdenkend in das mutmaßliche Kalkül beider Kriegsparteien einmischt – zu unausdrücklicher Hoffnung auf antirussische Erfolge in naher Zukunft berechtigt. Und wenn daraus nichts wird und aus russischen Geländegewinnen auch nichts, dann ist die Suche nach Sinn und Zweck dennoch nicht am Ende:
„Reisner zieht den Fleischwolf-Vergleich: Bei Bachmut werde versucht ‚von russischer Seite die Ukraine anzusaugen, genau in die Reichweite ihrer Artillerie, und sie dann zu zerstören‘.“ (rtl.de)
Das Interesse an der Funktion einer Angelegenheit für einen verständlichen, theoretisch akzeptablen Zweck, der Gesichtspunkt des von einem solchen Zweck her gedachten zweckmäßigen Gelingens: das hört bei der Begutachtung von Kriegsereignissen offensichtlich nicht auf. Die Sitte des auf rein immanente Kritik programmierten, insofern grundsätzlich affirmativen Nachdenkens über Gott und die Welt wird auch mit der ‚Schlacht um Bachmut‘ locker fertig. Die Parteilichkeit für die ukrainische Sache – worin auch immer die wirklich bestehen mag, auf jeden Fall ‚Verteidigung‘ gegen die „russischen Invasionstruppen“ – kommt dabei nicht zu kurz. Natürlich sind – oder wären – ukrainische Geländegewinne erwünscht, russische eine Gefahr und von Übel. Natürlich werden tote Russen als gerechte Strafe für den Verbrecher Putin verbucht. Natürlich sind tote ukrainische Frontsoldaten heldenhafte Zeugen für die Güte des Zwecks, dem sie nicht von ihren Befehlshabern geopfert werden, sondern sich opfern. Doch offenbar pflegt die liberale Öffentlichkeit daneben auch in Sachen Krieg eine kaltblütige Sachlichkeit, die sich noch in jede staatliche Veranstaltung verantwortungsbewusst hineindenkt und für alles einen – verfehlten oder glücklicherweise realisierten, aber auf jeden Fall – guten Grund schon allein deswegen findet, weil sie nach nichts anderem sucht.
Das ist die eine Sache: Die öffentliche Meinung denkt unerbittlich konstruktiv mit.
Die andere Sache ist die:
„Bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Verantwortlichen seines Ministeriums erklärte Schoigu, die Kontrolle über Bachmut werde ‚neue offensive Einsätze in der Tiefe gegen die Verteidigung der Streitkräfte der Ukraine ermöglichen‘.“ (n-tv.de)
„Die strategische Rolle von Bachmut ist nicht so groß... Einerseits ist Bachmut Teil dieser Festung, andererseits wird die Einnahme von Bachmut selbst keinen schnellen Sieg über die Ukraine, keine Straße zum Dnjepr oder gar die Einnahme des Donbass sicherstellen... Bachmut ist für uns äußerst vorteilhaft, wir zermalmen die ukrainische Armee dort und halten ihre Manöver auf.“ (Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin auf Telegram)
„Die Kämpfe um Bachmut werden immer heftiger, einen Rückzug lehnt Wolodymyr Selenskyj jedoch entschieden ab. Der Präsident betont, ‚kein Teil der Ukraine‘ könne ‚aufgegeben‘ werden.“ (zdf.de)
„Am Anfang war Bachmut eine Falle für die Russen, jetzt ist es eine Falle für uns geworden. Wir töten sie im Verhältnis 1:7 – das ist der einzige militärische Grund, Bachmut zu halten. Aber die Truppen hätten vor drei Wochen abgezogen werden müssen... Die Entscheidung, Bachmut zu halten, war gut, aber sie haben es übertrieben.“ (Ein ukrainischer Militärberater, zitiert nach n-tv.de)
Was die Öffentlichkeit kritisch einfühlsam begutachtet, setzen die politische Obrigkeit und ihre ausführenden Militärorgane ins Werk. Und zwar nach dem einzigen Kriterium, das sie im Umgang mit ihrem „Material“ praktisch gelten lassen und das der politischen Meinungsbildung als selbstverständlicher Leitfaden dient: Es muss sich lohnen, wofür sie ihre Armeen losschicken; dann wird losgeschlagen und ‚verschlissen‘. Und es muss gelingen; der Militärapparat kümmert sich darum, dass die Rechnung aufgeht. Alternativen gibt es nur innerhalb dieser Zielsetzung unter dem Kriterium der Effizienz. Auch die Schlacht um Bachmut ist für ihre Veranstalter ein Handwerk, das sauber erledigt werden muss.
Am Ende steht folgerichtig eine vorbildlich sachliche Manöverkritik von maßgeblicher Seite: Lob für die Performance, leichte Zweifel, ob die Investition die maximal lohnende war:
„Ich will die enorme Arbeit, die die ukrainischen Soldaten und die ukrainische Führung in die Verteidigung von Bachmut gesteckt haben, nicht schmälern, aber ich denke, dass es sich dabei eher um einen symbolischen Wert handelt als einen strategischen und operativen Wert.“ (US-Verteidigungsminister Lloyd Austin)
Ein cooler Nachruf auf zehntausende Tote. Ohne Pathos – es sind ja nicht die eigenen.
Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Putin
Die europäischen Staatenlenker landen einen kriegsdiplomatischen Treffer: Der Internationale Strafgerichtshof ergänzt das Verdikt „Putins Angriffskrieg“ um einen internationalen Haftbefehl gegen Putin. Verhaftet werden soll er wegen eines Aktes, den die russische Seite als humanitäre Tat verstanden wissen will. Die Anklage lautet auf Verschleppung und Umerziehung ukrainischer Jugend. Dieses von allen möglichen Vorwürfen in der ukrainischen Schlächterei eher unspektakuläre Kriegsverbrechen wird zum Anklagepunkt aus dem einfachen, praktischen Grund, weil hier die juristische Beweislage so günstig ist: Die russische Führung streitet die Verbringung der Kinder nicht ab; sie hat sie sogar publik gemacht, natürlich unter dem Motto, es ginge hier um die „Rettung unschuldiger Kinder vor Kriegsschäden“, die man auch wieder zurückschicken kann, sobald sich ihre Eltern finden. Die juristische Akribie, einschließlich des Vorbehalts des Gerichtshofs, dass es sich erst um eine Anklage handle, die in einem Verfahren noch geprüft und als Tatbestand bestätigt werden müsse, verleiht der feststehenden Einordnung des russischen Krieges als Verstoß gegen die guten Sitten der Kriegführung zwischen zivilisierten Staaten Seriosität. Noch vor einer Festnahme, geschweige denn einer Auslieferung Putins, erbringt allein die offizielle Anklage schon die propagandistische Leistung: Sie macht aus dem Präsidenten der Russischen Föderation nicht nur einen diplomatisch geächteten Kriegspräsidenten, sondern einen im Prinzip weltweit gesuchten Verbrecher.
Dieser kriegsdiplomatische Akt bekommt seinen weltpolitischen Stellenwert freilich nicht durch die Winkelzüge des juristischen Handwerks. Eine diplomatische Ansage an alle Staaten bzw. eine nicht ohne Weiteres zu übergehende internationale Rechtslage wird die Fahndungsausschreibung darüber, dass die führenden europäischen Staatsgewalten ausdrücklich dahinterstehen – und zur Freude der Europäer nicht nur die:Die mächtigen USA – die den IStGH ausdrücklich nicht als verbindliche völkerrechtliche Instanz anerkennen und sich Anklagen gegen ihre Soldaten sanktionsbewehrt verbitten – mahnen an, dass der schriftlichen Anordnung aus Den Haag durch alle Staaten Folge zu leisten ist. 1) Ausnahms- und fallweise spendiert das Weiße Haus dem IStGH seine Anerkennung, weil die juristische Qualifizierung Putins als Verbrecher die amerikanische Ächtung Russlands schön untermalt, mit der es seinen antirussischen Stellvertreterkrieg ins Recht setzt. Dafür lässt die Supermacht gerne mal großzügig die Durchsetzungsfähigkeit ihrer Gewalt ein bisschen auf die Glaubwürdigkeit und Seriosität des Weltgerichts abfärben. Und so ergeht ganz nebenbei eine Klarstellung, wer für das Völkerrecht letztinstanzlich zuständig ist.
Das Treffen von Xi und Putin
Kurz nach dem Haftbefehl gegen Putin reist Xi nach Moskau, um auf diplomatischer Ebene öffentlich die westliche Isolierung Russlands als Paria-Staat zurückzuweisen. Dieser Beistand kommt aus Sicht Russlands zur rechten Zeit, schließlich haben westliche Sanktionen, diplomatische Ächtung und vor allem die vielen gelieferten Waffen eine zerstörerische Wirkung entfaltet, die einen Partner vom Schlage Chinas äußerst willkommen und notwendig macht. Putin lobt deswegen die „objektive Haltung“ Xis, die er dessen Friedensplan entnimmt, und verspricht die Prüfung auf Übereinstimmung mit russischen Interessen.
Beim Austausch von Solidaritätsbekundungen bleibt es aber nicht. Beide Staatsführer erklären ihre strategische Partnerschaft mit ihren gemeinsamen Aufgaben und Zielen: Die bestehen zuallererst in einer massiven Ausweitung des bilateralen Austauschs in den Bereichen „Handel und Investitionen, Logistik und Verkehrswege, Finanzen (insbesondere Ausbau der Verwendung ihrer Währungen), Energiewirtschaft und ‚globale Energiewende‘, Grundstoffe und Bodenschätze, Technologie und Innovation, industrielle Kooperation sowie Landwirtschaft“ auf ein angepeiltes Volumen im Wert von ca. 200 Milliarden Euro. Strategisch ist diese Absicht nicht nur im Hinblick auf die gegenseitige wirtschaftliche Stärkung, die für Russland den Charakter eines teilweisen ökonomischen Ausgleichs für die durch die westlichen Sanktionen angerichteten Schäden hat, sondern auch und insbesondere, weil China und Russland sich darauf einigen, den Anteil des in ihren eigenen Währungen abgewickelten bilateralen Handels von ca. 65 % schrittweise auf 100 % auszuweiten – eine aus der aktuellen Lage geborene, deutliche Absage an die Alternativlosigkeit der Weltwährungen Dollar und Euro.
Der Ausbau der ökonomischen Beziehungen ist aber erst der Anfang. Ihre Partnerschaft soll in einem ganz neuen Sinn ausgerichtet werden: Beide Staaten entdecken nämlich „Entwicklungen“, die „das internationale Kräftegleichgewicht tiefgreifend verändern“. Diesen entnehmen sie den Auftrag, ihre „natürliche Verantwortung“ als ständige Mitglieder des Weltsicherheitsrats wahrzunehmen und die Welt in eine Richtung zu lenken, die den „Erwartungen der internationalen Gemeinschaft“ entspricht. Damit beanspruchen Russland und China eine alternative Richtlinienkompetenz über den Rest der Staatenwelt. In deren Mittelpunkt steht die „Förderung einer multipolaren Weltordnung, der wirtschaftlichen Globalisierung und der Demokratisierung der internationalen Beziehungen, um die Entwicklung einer gerechteren und rationelleren globalen Ordnung zu fördern“. So machen Russland und China der restlichen Staatenwelt mit ihrer militärischen Macht und ihrem ökonomischen Gewicht das Angebot, sich ihnen anstatt den USA zuzuordnen.
Einen bedeutenden Beitrag zu diesem antiwestlichen, gegen das Weltordnungsmonopol der USA gerichteten Konkurrenzprojekt stellt die von China erreichte diplomatische Aussöhnung der Erzrivalen Iran und Saudi-Arabien dar. Mit dem Angebot, per Ölexport und Zugehörigkeit zu BRICS+ am künftig weltweit größten Wachstumsraum zu partizipieren, versucht China, die beiden Regionalmächte für sein multipolares Gegenprogramm zu gewinnen. Währenddessen wird die Wiederanerkennung Syriens durch Saudi-Arabien vermittelt, was die chinesische Ambition flankiert. Gegen „die Kolonialpolitik der USA und Europas“ findet zeitgleich zum Besuch Xis ein Treffen mit afrikanischen Staaten statt, in dem vereinbart wird, dass Russland und die Staaten Afrikas ihren Handel trotz Sanktionen und diplomatischer Ächtung ausbauen. Kurz: China und Russland bemühen sich darum, ihren Einfluss auf andere Länder auszuweiten, darüber einen Block von verbündeten Staaten zu schaffen und so die eingerichteten Machtverhältnisse zu untergraben, womöglich zu ersetzen.
Das stuft Amerika sofort als das ein, was es ist: als Kampfansage an das Weltordnungsmonopol der USA. Besorgt zeigt sich Amerika deswegen aber nicht, sondern tritt mit dem Selbstbewusstsein einer Macht auf, die ihresgleichen sucht:
„Hier sind zwei Länder, die enger zusammenwachsen und einander als nützliche Partner beim Kampf gegen eine regelbasierte Weltordnung ansehen. Sie wollen die Regeln dieses Spiels ändern. Sie wollen, dass der Rest der Welt nach ihren Regeln spielt und nicht nach denen, die in der UN-Charta verankert sind und nach denen sich alle anderen richten.“ Aber „keine andere Nation in der Welt – keine – hat ein solches Netz von Bündnissen und Partnerschaften wie die Vereinigten Staaten. Niemand hat so viele Freunde in der ganzen Welt mit den gleichen Zielen wie wir. Verteidigungsminister Austin hat vor etwa einer Woche die 10. Ukraine Defense Contact Group abgehalten, an der mehr als 50 Nationen teilgenommen haben – ich wiederhole: mehr als 50 Nationen an jeder einzelnen Veranstaltung. Und dabei ist die Teilnahme freiwillig. Es ist nicht so, dass wir die Leute unter Druck setzen, damit sie der Ukraine helfen. Das ist die Macht der amerikanischen Führungsrolle. Und diese Macht haben weder Russland noch China.“ (Kirby@Whitehouse Pressekonferenz, 21.3.23)
Mit der Arroganz der überlegenen Supermacht, für die es zwischen ihren Ansagen und den allgemein anerkannten Regeln, ihrer Herrschaft über die Welt und dem freiwilligen Mitmachen des Rests der Staatenwelt keinen Unterschied gibt, sagt Amerika dem chinesisch-russischen Konkurrenzprojekt den Kampf an; und die erste Maßnahme ist, dem Treffen die Irrelevanz zuzusprechen, für die die USA sorgen wollen.
Weitere Waffenlieferungen an den Stellvertreter
Der lautstarke ukrainische Bedarf nach mehr Waffen trifft im Westen auf Gehör. Mit dem Beschluss, der Ukraine moderne Panzer zu spendieren, sind die Drangsale des Erhalts des eigenen Stellvertreters nämlich noch gar nicht erledigt.Das fängt Mitte März mit den Amerikanern an, die ihre Waffenhilfe um weitere 350 Millionen Dollar an Munition, HIMARS-Systemen etc. erweitern und ankündigen, die Abrams-Panzer, die sie als Zugeständnis an die Deutschen der Ukraine irgendwann liefern und vorher erst einmal bauen wollten, jetzt in der älteren Version aus eigenen Beständen zusammenzustellen. Kurze Zeit später werden die Munitionslieferungen um 2,6 Milliarden Dollar auf mittlerweile insgesamt 35,1 Milliarden Dollar aufgestockt. Aufgrund der großen Eile zum Teil direkt aus den Beständen des US-Militärs.
Auch andere Staaten wie Spanien versprechen zusätzliche Panzerlieferungen. Das ist gut, rückt aber zusammen mit den Munitionslieferungen das Problem in den Fokus, dass die westlichen Bestände zunehmend ausgedünnt werden und eine rasche Ausweitung der Kriegsproduktion nottut. Die EU mobilisiert dafür ihre Marktmacht und verabschiedet in einem demonstrativen Kraftakt ein Munitionspaket, eine gemeinsame EU-Beschaffung von NATO-Granaten im Wert von zwei Milliarden Euro. Teils direkt für die Ukraine, teils um leere Depots ihrer eigenen Armeen aufzufüllen.
Währenddessen wird eine weitere rote Linie relativiert. Polen und die Slowakei liefern, wie angekündigt, die ersten Exemplare ihrer alten sowjetischen MiG-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine. Im Unterschied zu früheren Versuchen wird das dieses Mal von den Führungsmächten nicht unterbunden. Die schließen sich diesem Übergang aber auch nicht direkt an, sondern beharren darauf, dass solche Lieferungen – jedenfalls für sie selbst – nicht in Frage kommen; der wird als Entscheidung einzelner Staaten definiert, sodass von einer Überschreitung einer roten Linie keine Rede sein kann. Getrennt von der Führungsmacht läuft das dennoch nicht: Die USA spendieren der Slowakei neue Bell-Hubschrauber zum Spottpreis, sodass dieser Eskalationsschritt wieder als





























