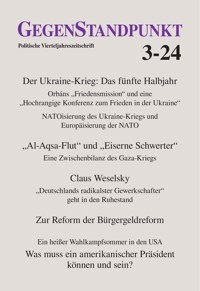
GegenStandpunkt 3-24 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gegenstandpunkt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im dritten Kriegssommer tut Selenskyjs Ukraine auch weiterhin, wofür sie vom Westen ausgerüstet wird: Sie verschleißt auf Befehl ihres Führers ihr nationales Menschenmaterial an der Ostfront und hält auch im Hinterland die zunehmenden Verwüstungen tapfer aus, damit Russland jede Aussicht auf ein anderes Kriegsende als eine russische Niederlage weiter verwehrt bleibt. Dass der ukrainische Stellvertreter des Westens ziemlich vor die Hunde geht, schmälert weder in Kiew noch in den westlichen Hauptstädten die Bereitschaft zum „Immer weiter so!“. Entsprechend wird mit den materiellen Schwierigkeiten umgegangen, in die die russische Militärmacht unter Inkaufnahme gigantischer eigener Schäden den Vorposten westlicher Freiheit bombt, weil auch für Moskau selbstverständlich ist, dass die eigenen Menschen und sonstigen Ressourcen für die Behauptung der Staatsmacht da sind. Die westlich-ukrainische Lösung aller Kriegsprobleme heißt Kriegseskalation, inzwischen auch in jede russische Provinz, die in Reichweite liegt. Bedenken selbst der patriotischsten Art werden entweder ignoriert oder als Helfershelfertum für den Aggressor Putin mit der üblichen Hetze belegt. Es gibt keine Alternative zum Sieg über Russland, entsprechend tut der Westen so, als ob er den schon in der Tasche hätte: Beschlagnahmte russische Staatsgelder werden für Abschlagszahlungen auf die bei Sieg fälligen Reparationen benutzt. Mit den Gepflogenheiten des internationalen Eigentumsschutzes – ansonsten der wirkliche Höchstwert aller werte- und regelbasierten Weltordnung – ist das zwar nicht so ganz zu vereinbaren. Aber diese Ordnung ist eben nur so viel wert, wie sie ihren Garantiemächten die Ausnahmestellung sichert, die sie gegen Russlands gewaltsame Selbstbehauptung als gleichrangige Macht verteidigen. Zeitgleich schlägt ein anderer Vorposten westlicher Freiheit und Sicherheit gegen eine Welt von Feinden weiter in einer Weise um sich, wie es sich für die Freiheit und Sicherheit einer respektablen Macht gehört: Israel lässt für seinen Vernichtungskrieg gegen die Hamas jeden Tag Palästinenser sterben und im Gaza keinen Stein auf dem anderen. Zugleich ist es längst in höherer Mission aktiv: Seinen Anti-Hamas-Ausrottungsfeldzug behandelt es inzwischen als bloß einen Abschnitt in einem regionalen Mehrfrontenkrieg. Es setzt seine Freiheit und Sicherheit nicht mehr nur mit der erfolgreichen Abschreckung, sondern mit der Vernichtung aller seiner Gegner in der Region gleich. Konsequent treibt es daher die Konfrontation mit seinem Hauptfeind, der gegnerischen Regionalmacht Iran immer direkter voran – für alle Fälle hat Israel ja seine Atombomben. Mit dem so provozierten Szenario eines „Flächenbrands“ erzwingt Israel zugleich das Engagement der noch ganz anders nuklear bestückten Weltmacht Amerika. So verleiht Israel mit seinem ausgreifenden Sicherheitsanspruch als unangreifbare Vormacht im Nahen Osten dem regionalen Krieg zugleich ein Moment von Weltkrieg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Ukraine-Krieg: Das fünfte Halbjahr
I.
Die Ukraine wird von den russischen Streitkräften zunehmend zerstört; ihre Armee hält dem russischen Druck an der weitgespannten Front immer weniger stand. Das liegt nach dem Urteil nicht nur der ukrainischen Staats- und Militärführung, sondern auch der westlichen Fachwelt einerseits daran, dass das ukrainische Menschenmaterial im Kräftemessen mit der russischen Seite tendenziell zur Neige geht. Sodass man sich abermals mit der zynischen Sachlichkeit vertraut machen darf, mit der Staaten auf ihre Völker blicken: Größe und demografische Unterteilung der ukrainischen und russischen Bevölkerungen werden locker in die kurz-, mittel- und langfristige Tiefe des jeweiligen Pools an menschlichem Kriegsmaterial umgerechnet; das Resultat wird durchaus als bedrückend empfunden – vor allem wegen des überdeutlichen Ungleichgewichts. Andererseits und in erster Linie werden die fortgeschrittene Zerstörung des Landes und die Dezimierung der ukrainischen Armee auf den mangelnden Nachschub an Waffen aus den NATO-Ländern zurückgeführt. Erstens gibt es von ihnen viel zu wenig, zweitens sind ihre Einsatzmöglichkeiten viel zu beschränkt. Zum Töten und Zerstören der einmarschierenden Russen darf die Ukraine sie ja nicht nach eigenem Bedarf, sondern nur nach den Vorgaben der Sponsoren gebrauchen; dafür hat sich unter den enttäuschten Experten die Sprachregelung eingebürgert, man würde die Ukraine dazu zwingen, „mit einem Arm hinter dem Rücken gebunden“ zu kämpfen. Das wird wiederum als entscheidender Grund dafür verbucht, dass der Verschleiß an menschlichen und materiellen Ressourcen auf ukrainischer Seite so gravierend ist: Er ist zu hoch und dauert zu lange an.
II.
In die Krise gerät damit zwar nicht der Westen selbst, wohl aber die Art und Weise, wie er den Krieg bislang definiert hat: als großangelegte Hilfsaktion für das überfallene ukrainische Opfer, die so lange fortgesetzt wird, bis der russische Aggressor die Schlacht verloren gibt, seinen Übergriff beendet und sich zurückzieht.
Dieser Kriegsstandpunkt ist verlogen. Jedenfalls einerseits: Dem amerikanisch geführten, brutal hilfsbereiten westlichen Sponsorenkollektiv geht es von Anfang an und bei aller fortgesetzten Berufung auf russische Verbrechen gegen die Ukraine erklärtermaßen um sich – darum, worin es sich angegriffen sieht, wenn Russland die Ukraine angreift: nicht als souveräne Herrscher über ihre eigenen Territorien, dennoch existenziell. Denn nur als Hüter einer Ordnung, die alle staatlich regierten Territorien umspannt, fühlen sich diese Staaten sicher. Die Intaktheit besagter Ordnung bemisst sich insofern daran, ob und inwieweit der globale Kontrollanspruch respektiert wird, den sie auf den Gebrauch militärischer Gewalt – auch auf den Besitz kriegerischer Gewaltmittel – erheben; eine Frage, die konsequenterweise dem Urteil der maßgeblichen Hüter selbst unterliegt. Nach derzeitiger Beschlusslage erfordert die Wiederherstellung ihrer Weltfriedensordnung, dass Russland die Fähigkeit nachhaltig genommen wird, die monopolisierte Verfügungsmacht des Westens über den globalen Gewalthaushalt substanziell anzufechten; es gehört in diesem grundsätzlichen Sinne, als autonome Weltmacht, unschädlich gemacht, also endgültig zum Objekt der eigenen degradiert. Dazu verhilft sich der Westen, wenn er der Ukraine hilft.
Das ist ein Kriegsziel, das nicht nur über die Ukraine weit hinausreicht, sondern sie auch in jeder Hinsicht weit überfordert; der Totalverschleiß des Landes wird als Mittel zum Zweck einkalkuliert. Für die ukrainische Staatsgewalt gilt nämlich dasselbe wie für das Inventar an Land und Leuten, das für ihren Selbsterhalt sachgerecht verschlissen wird: An dem, was die Ukraine an Krieg aushält, hat das westliche Kriegsziel in der Ukraine vielleicht eine letzte Grenze, aber daran nimmt der westliche Helfer von vornherein nicht Maß. Gerade deswegen ist der Standpunkt der Hilfe zur Selbstverteidigung zugleich ernst gemeint: Der antirussische Krieg wird so eingerichtet, dass er auf die Ukraine als Schauplatz beschränkt stattfindet, die NATO nicht als direkt kriegführender Feind aktiv wird. Und das nicht nur im Sinne einer winkeladvokatischen Auslegung des Kriegsvölkerrechts, sondern praktisch im Maß der in Auftrag gegebenen, angeleiteten und gelenkten Kriegführung der Ukraine. Wenn die NATO-Mächte ihrer eigenen waffenmäßigen Unterstützung Schranken setzen, dann nicht deswegen, weil sie an unüberwindliche Kapazitätsgrenzen stoßen, schon gar nicht, was die Reichweite und Wirksamkeit der Waffen in ihren Arsenalen betrifft. Jede Eskalation im Sponsoring des Krieges, jede Überschreitung bisher gezogener Grenzen, ist der praktische Beweis: Sie ist eine Frage des Entschlusses. Der lautet wiederum nach wie vor, bei jedem quantitativen und qualitativen Übergang des Waffengangs und der westlichen Beteiligung daran: Russland soll durch die NATO nicht direkt, sondern vermittels der Ukraine bekriegt, seine Armee verschlissen werden. Entsprechend fällt die transatlantische Beteuerung der Notwendigkeit aus, der Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen Russland nachhaltig beizustehen: Wenn der Westen den russischen Machtwillen nicht dort kaputt kriegt, dann muss er das übermorgen hier tun; was da als gesicherte Vermutung über den Kriegswillen Putins ausgedrückt wird, ist die eigene Entschlossenheit, die Ukraine als Schauplatz dieses Konflikts möglichst auszureizen.
Dass die Ukraine in diesem Krieg durchhält und dabei immer mehr kaputtgeht – nach beiden Seiten ihrer heillosen Überforderung als militärisches Werkzeug und Kampfplatz des Westens gegen Russland hin ist die Situation der Ukraine das Ergebnis westlichen Kalküls, nämlich wie die NATO ihren Kriegseinsatz definiert und dosiert. Dieses Kalkül steht infrage, wenn bzw. seit die Ukraine ihr Durchhalten nicht mehr aushält.
III.
Die – zeitweilige – Stornierung der Waffenhilfen aus Amerika verschärft diese Krise.
Zum einen macht sich an der Front akuter Mangel an Waffennachschub geltend, wenn der bisherige Hauptlieferant eine Weile ausfällt. Weitaus gravierender ist der Umstand, dass die Kongress-Republikaner mit ihrem hartnäckigen Widerstand gegen die Kriegslinie der Biden-Regierung die kriegspolitische Grundsatzfrage aufwerfen: Ob, wie lange und inwieweit hält die Weltmacht, die ihre Allianz in diesen Krieg gegen Russland auf dem Schauplatz Ukraine hineingeführt, sein Ziel und seine Bedingungen vorgegeben hat, an dessen weltpolitisch entscheidender Bedeutung fest? Mit der Auflösung dieser Blockade, also mit dem nächsten doch noch verabschiedeten Paket an Geld- und Gewaltmitteln wird diese Frage überhaupt nicht abschließend beantwortet und erledigt. Immerhin ist damit die Alternative in die amerikanische Entscheidungsfindung gebracht worden und nun in ihr präsent, den Krieg im Sinne seiner verharmlosenden Lebenslüge ernsthaft herunterzudefinieren: zur Beihilfe für einen osteuropäischen Randstaat des westlichen Zugriffsinteresses, zu einem Konflikt also, der Amerika auf jeden Fall viel weniger angeht als die Europäer, sich für die Weltmacht womöglich auf Dauer nicht lohnt. Erst recht präsent ist diese Alternative, weil der punktuelle kongressrepublikanische Widerstand gegen das eine Waffenpaket sich als bloßer Vorgeschmack darauf versteht, was eine erneute Trump-Regierung für das Verhältnis der USA zum ukrainischen Opfer und Schützling, zum russischen Feind und zu den europäischen Partnern verspricht. Und auch wenn dieses Szenario nicht eintreten sollte, machen sich regierende Europäer und fachmännische Beobachter nicht viel vor: Die Infragestellung der Bedeutung dieses Krieges im Besonderen und der Kriegsallianz mit Europa im Allgemeinen ist auch den noch regierenden Demokraten nicht fremd; auch die wissen zwischen Feinden zu unterscheiden und lassen keinen Zweifel daran, dass die wirklich epochemachende Bedrohung amerikanischer Weltherrschaft anderswo liegt. So registrieren die NATO-Verbündeten auf ihre Weise, was diese Episode in der amerikanischen Dauersendung „Spaltung der Nation“ über die Generallinie des amerikanischen Imperialismus in diesem Krieg mal wieder offenbart: die kalkulatorische Freiheit, die Amerika sich bei allem kriegerischen Engagement stets vorbehält. Amerika lässt den Krieg in der Ukraine führen, macht ihn federführend zum eigenen Anliegen, ohne ihn zu seinem Krieg zu machen.
IV.
Schon das Aufkommen solcher Zweifel an der Bedeutung dieses Waffengangs für Amerika hat für das Kriegskalkül der europäischen NATO-Mächte noch weiter reichende Konsequenzen als die kritische Lage der und in der Ukraine selbst. Erst einmal müssen sie sich mit der Alternative befassen, womöglich auch ohne ihre Führungsmacht den Ukraine-Krieg zu bewältigen, also dessen programmgemäße Durchführung „so lange wie nötig“ wenigstens teilweise zu „europäisieren“. Daran schließt sich auf längere Sicht die gar nicht bange, eher aus einer gewissen Anspruchshaltung heraus aufgeworfene Frage an, wie sie als europäische Macht die konfrontative Nachbarschaft zu Russland auf Dauer gestalten können und wollen.
Unmittelbar und vordringlich hat die europäische Kriegspolitik es jedenfalls mit den zwei Fragen zu tun:
— Was muss der europäische NATO-Pfeiler leisten, um mit der kritischen Kriegslage der Ukraine, notfalls zeitweilig auch ohne die USA, fertigzuwerden?
— Was soll und was kann Europa sich gegen Russland als atomkriegsfähigen Feind leisten, ohne die Sicherheit eines verlässlichen „atomaren Schutzschirms“ der USA?
In der ersten Frage herrscht entschiedene Einigkeit darüber, dass viel mehr getan werden muss, um Land und Armee des östlichen Vorpostens vor der russischen Übermacht zu schützen und das Kriegsglück umzudrehen. Der Konsens zieht folgerichtig eine unentschiedene Uneinigkeit in der zweiten Frage nach sich. Denn für die erforderlichen ukrainischen Erfolge braucht es, mit oder ohne die USA, nicht nur mehr Waffen und Munition, sondern in europäischen Arsenalen durchaus vorhandene Waffen mit entscheidend höherer Zerstörungskraft und Reichweite, die bisher nicht oder nur unter einschränkenden Bedingungen geliefert werden. Konsens herrscht auch darüber, dass daher nicht weniger als eine Neudefinition des europäischen Kriegseinsatzes zur Debatte steht. Dabei plädiert keine Seite – nicht einmal eine Strack-Zimmermann, die jeden Anflug von Vorsicht beim Bekriegen der Russen für Wasser auf die Mühlen des Gegners hält – für einen Übergang in eine direkte Konfrontation der NATO mit Russland; beide Seiten teilen wiederum die Bereitschaft, das Risiko auf neue Weise einzugehen, dass die russische Führung die für fällig erachtete Eskalation des Krieges nicht mehr als Unterstützung der Ukraine hinnimmt, mit der sie weiterhin „vor Ort“ fertigwerden kann, also will, sondern als NATO-Angriff auf ihre nationale Sicherheit definiert und entsprechend beantwortet.
Festgemacht wird dieses Risiko an der Frage der Lizenz fürs ukrainische Militär, mit den entsprechenden westlichen Waffen, schon gelieferten wie vermehrt zu liefernden, über die Landesgrenzen hinweg russische Stellungen und Aufmarschräume zu beschießen – zivile Kollateralschäden werden, soweit unvermeidlich, eingepreist –, sowie am nicht nur faktischen, sondern offiziell angesagten Einsatz von NATO-Soldaten im ukrainischen Kriegsgebiet. In der Frage, ob Deutschland seine Taurus-Raketen liefern sollte, fällt für die deutsche Regierung beides zusammen. Während Bundeskanzler Scholz bislang eine Lieferung ausschließt, weil die Waffen ohne direkte Beteiligung deutscher Soldaten nicht zu bedienen seien, antworten seine Kritiker in- und außerhalb der Regierungsparteien mit einer Mischung aus „stimmt nicht!“ und „na und?“. In der Auseinandersetzung in und zwischen verschiedenen NATO-Ländern über das Risiko einer Ausweitung des Krieges erklärt die eine Seite es für unbeachtlich bis nicht vorhanden, zumindest was die derzeit diskutierten Fortschritte betrifft; hier kann man daher Kanzler Scholz „gar nicht verstehen“, der mit der Lieferung und der Lizenz zum grenzüberschreitenden Einsatz der Raketen immer noch hadert. Die andere Seite hält eine Steigerung des westlichen Einsatzes für nötig, den diskutierten qualitativen Fortschritt dabei für nur teilweise erforderlich und für doch risikobehaftet; hier „wundert sich“ der Kanzler, „dass einige nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun“. Weitere Fortschritte hält er nur unter der Bedingung und nur insoweit für angesagt, wie sie mit der Rückendeckung bzw. im Schlepptau der USA getan werden – also nur dann, wenn die USA sich ausdrücklich auch dazu entschließen.
An diesem Vorbehalt wird kenntlich, dass die USA bei den nächsten Eskalationsschritten – wie auch bei allen vorangegangenen – nicht nur als Ausstatter gefragt sind, sondern als die Weltkriegsmacht, die dem russischen Feind auf der höchsten Ebene der strategischen Abschreckung begegnet und die diskutierte Eskalation unter ihren „atomaren Schutzschirm“ stellt. Den bringen europäische Politiker und Strategen deswegen auch in die Diskussion; nicht im Sinne eines expliziten Zweifels an seiner Verlässlichkeit, aber schon mit der vorsichtigen Überlegung, ob es dafür einen europäischen Ersatz geben könnte und müsste. In der aktuellen Debatte führt dieser gedankliche Ausflug ins Katastrophenszenario der atomaren Abschreckung – im Hintergrund von Beginn an in allen Kriegskalkulationen präsent – wieder zurück zu den uneindeutig gegensätzlichen Einschätzungen, ob eine solche Weltkriegsgefahr für die jetzt anstehenden Entscheidungen überhaupt nicht gegeben oder aber doch irgendwie in Rechnung zu stellen und deswegen durch eine „rote Linie“ vor einem offen aktiven Kriegseinsatz der Allianz auszuschließen wäre.
Daneben stellt sich damit für Europas Kriegsverantwortliche die Frage der langfristigen Wehrhaftigkeit im militärischen Kräftemessen mit Russland. Die einschlägigen Planungen, auf ein halbes bis ganzes Jahrzehnt angelegt, sprechen die Probleme einer Europa-eigenen nuklearen Abschreckung an, machen ihre – auf alle Fälle schwierige – Lösung aber überhaupt nicht zur Voraussetzung für die weitere Ausnutzung der amerikanischen Atommacht, nämlich für den Entschluss und ersten Schritt hin zu einer subatomaren europäischen Streitmacht unter dem atomaren Schutzschirm der USA, die einer russischen Aggression von der Art des Ukraine-Krieges auf NATO-Gebiet vom ersten Quadratzentimeter an keine Chance lassen wird. Ein solcher Ernstfall wird an die Wand gemalt, als rechnete man in Europas Hauptstädten schon damit als einer Gelegenheit zu beweisen, dass Verteidigungsfähigkeit sich nur auf die eigene Überlegenheit auf jeder Eskalationsstufe reimen kann.
V.
Nach mehrmonatiger Verzögerung setzt sich in den USA das strategische Interesse an der Zerstörung der russischen Militärmacht in der Ukraine durch und tritt wieder in Kraft. Im April wird dann doch ein milliardenschweres Hilfspaket bewilligt; keine Lieferung in dem Sinn, sondern eine finanzielle Freigabe von 61 Milliarden Dollar für zukünftige Lieferungen, mit einer ersten Tranche von einer Milliarde. Auch wenn Zugeständnisse an die Republikaner gemacht wurden und Teile des Pakets gar nicht direkt für die Ukraine, sondern für die Lagerbestände des US-Militärs vorgesehen sind und andere Teile nicht als Zuwendung, sondern als Kredit vergeben werden, stellt das Ausmaß des Hilfspakets den Krieg auf eine neue Grundlage.
Für die NATO ist das eine starke Ermunterung, die Aufrüstung der Ukraine mit mehr Waffen für eine wirkungsvolle „Vorwärtsverteidigung“ voranzutreiben. F-16-Kampfflugzeuge sollen jetzt endlich geliefert werden; die Entsendung von französischen Ausbildern ins Kriegsgebiet wird bekannt gegeben; die Briten erteilen die Lizenz zum Einsatz ihrer Marschflugkörper über die russische Grenze hinweg; der NATO-Generalsekretär legt nach mit der Aufforderung an die Mitgliedstaaten, Restriktionen zu streichen; die amerikanische Führungsmacht mit ihrem deutschen Mit-Führer geben den grenzüberschreitenden Einsatz ihrer eigenen weitreichenden Raketen frei – zwar mit einer Beschränkung auf den Einsatz an der Front im Norden, dafür mit der Klarstellung, die Einsatzregeln je nach Entwicklung der Kriegslage angemessen anzupassen.
Welche neue Qualität des Krieges durch die von Amerika betriebene bzw. gedeckte Eskalation Einzug in den Stellvertreterkrieg hält, wird nicht zuletzt an der Reaktion kenntlich, die darauf von russischer Seite folgt. Den britischen Vorstoß beantwortet Russland mit einer expliziten Drohung, britische Ziele auch außerhalb der Ukraine anzugreifen. Getrennt von dieser expliziten Benennung feindlicher Ziele reagiert die russische Regierung auf die gesamten westlichen Eskalationsschritte, unter denen sie auch noch polnische Vorstöße, US-Atomwaffen in Polen zu stationieren, und die Stationierung amerikanischer Kurz- und Mittelstreckenraketen rund um Russland nennt, mit einer öffentlich gemachten Übung des Einsatzes taktischer Atomwaffen:
„Wir hoffen, dass diese Übung die ‚Hitzköpfe‘ in den westlichen Hauptstädten abkühlt, ihnen die möglichen katastrophalen Folgen der von ihnen verursachten strategischen Risiken vor Augen führt und sie davon abhält, das Kiewer Regime bei seinen terroristischen Aktionen zu unterstützen und sich auf eine direkte bewaffnete Konfrontation mit Russland einzulassen.“ (Erklärung des Außenministeriums der Russischen Föderation, 8.5.24)
Mit dieser Übung unterhalb der Stufe der strategischen Atomwaffen wird die Fähigkeit zur schrittweisen Eskalation auch in dieser Waffenkategorie dokumentiert. Damit verleiht die russische Macht ihrer abschreckenden Warnung vor immer weitergehenden kriegerischen Übergriffen auf ihr Land deutlich mehr Glaubwürdigkeit als mit der Erinnerung an ihre Verfügung über die Waffen des nicht mehr hinnehmbaren finalen strategischen Schlagabtauschs. Sie demonstriert so ihre Potenz, die weitere Eskalation des Krieges effektiv zu gestalten.
So geht das Ringen um die Dominanz bei der Eskalation des Krieges, die den Gegner zum Innehalten und Aufhören zwingen soll, einmal begonnen, seinen Gang.
© 2024 GegenStandpunkt Verlag
Orbáns „Friedensmission“ und eine „Hochrangige Konferenz zum Frieden in der Ukraine“
Gegensätzliche diplomatische Klarstellungen zum Frieden in Europa
Der ungarische Präsident Victor Orbán begibt sich direkt nach der Übernahme des EU-Ratsvorsitzes auf eine „Friedensmission“. Die führt ihn zuallererst in die Ukraine und nach Russland, um auf künftige Verhandlungen zwischen den kriegführenden Parteien hinzuwirken. Wohin auch sonst?! In der Wahl der Adressaten unterstellt seine Vermittlungsmission eine diplomatische Banalität: Letztlich findet ein Friedensschluss logischerweise zwischen den staatlichen Feinden statt, die gegeneinander Krieg führen; die Bedingungen, unter denen die Kriegsparteien ihre Waffen auch wieder schweigen lassen, einander anerkennen und auf die zivilen Waffen ihrer Konkurrenz zurückkommen, müssen schließlich die miteinander ausmachen.
Das Unterfangen des ungarischen Präsidenten wird seitens führender Politiker der EU von Anfang an mit Relativierungen, empörter Kritik und Ausgrenzungsversuchen begleitet: Da reise keine offizielle Stimme Europas, sondern bloß ein unbedeutender nationaler Vertreter; ein verirrter Russlandfreund, der mit seiner angeblichen „Friedensmission“ das glatte Gegenteil bewirke und der russischen Aggression Vorschub leiste. Die Vehemenz, mit der die Reise Orbáns angefeindet wird, zeugt in erster Linie vom unerbittlichen Standpunkt seiner Kritiker: Politiker der EU und ihrer maßgeblichen Mitglieder beharren auf ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss mit Russland und erteilen daher jeder Friedensdiplomatie, die auf Vermittlung aus ist, eine klare Absage.
Ein Widerspruch dazu, dass auch sie als Teil der westlichen Unterstützer der ukrainischen Kriegspartei zu einer „Hochrangigen Konferenz zum Frieden in der Ukraine“ einladen, ist das keineswegs. Der Friedensgipfel in der Schweiz, dem die ukrainische „Friedensformel“ zugrunde gelegt und zu dem Russland gar nicht erst eingeladen wird, demonstriert allein vermittels seiner Präliminarien, dass Friedensdiplomatie schlicht ausgeschlossen ist, die in irgendeiner Weise russische Interessen, überhaupt den Standpunkt des Gegners, geschweige denn faktisch hergestellte Kriegsergebnisse in Rechnung stellen und damit Russland als Verhandlungspartner anerkennen würde. Die Veranstalter, die dem Ersuchen der Ukraine eine weltöffentliche Bühne verschaffen, bekunden durch das Veranstaltungsformat ihren offensiven politischen Willen, alle Friedensverhandlungen mit der russischen Kriegspartei bis auf Weiteres kategorisch abzulehnen.
Für diese diplomatische Absage benötigt die Allianz der Staaten, die militärisch ohnehin am antirussischen Krieg ‚ihrer‘ Ukraine festhält, eigentlich keinen eigenen Gipfel; dass echte Friedensgespräche mit Russland eine nicht hinnehmbare „Kapitulation“ darstellen würden, betonen sie bei jeder Gelegenheit. Aber ausgehend von ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss ist ihnen an der diplomatischen Veranstaltung einer „Hochrangigen Konferenz zum Frieden in der Ukraine“ offenkundig sehr gelegen: Ihr Interesse daran, Russland in der und vermittels der Ukraine eine nachhaltige Niederlage zuzufügen, wollen sie als gutes Recht, als Wahrung internationalen Völkerrechts verstanden, nämlich von der geladenen Staatenwelt anerkannt wissen. Da bietet ihnen der Rahmen ihres Gipfels die diplomatische Möglichkeit, mit heuchlerischen Willens- und Anspruchsbekundungen auf die politische Willensbildung anderer Staaten Einfluss zu nehmen. Darum interessiert die westlichen Partner nicht nur, wer von den geladenen Staaten überhaupt kommt oder gleich absagt, sondern auch, wer sich womöglich zur ukrainischen „Friedensformel“ bekennt oder zumindest die Abschlusserklärung mit ihren diplomatischen Relativierungen unterzeichnet oder aber die Unterschrift gänzlich verweigert. Dem entnehmen die staatlichen Vertreter der westlichen Kriegsfront den aktuellen Stand in dem Bemühen, die Staatenwelt zu einer antirussischen Parteilichkeit und zur Anerkennung ihres militanten Ordnungsanspruchs gegen Russland zu drängen. Klar, die praktische Durchsetzung dieser Forderung findet auf anderen Feldern als diplomatischen Gipfeln und in anderen Formen als mehr oder weniger heuchlerischen, auf jeden Fall berechnenden Stellungnahmen statt: Sie wird mit einer Mischung aus Angeboten und Erpressung, nicht zuletzt mit Sekundärsanktionen, vorangetrieben und entschieden. Das macht einen Friedensgipfel für die maßgeblichen Akteure nicht etwa überflüssig oder zu einer bloßen Show, sondern notwendig: Sie artikulieren ihre imperialistischen Ansprüche in diplomatischer Form, also ihre Erwartung, dafür Anerkennung vonseiten der Staatengemeinschaft zu verdienen, und sondieren, inwieweit dem entsprochen wird. Solange die westlichen Ukraine-Freunde an ihrer doppelten antirussischen Kriegsfront festhalten, haben sie Bedarf an der laufenden Erneuerung dieser Bestandsaufnahme. Deswegen gehört zum letzten die Planung des nächsten Friedensgipfels.
© 2024 GegenStandpunkt Verlag
Gipfel zum 75-jährigen Bestehen der NATO
NATOisierung des Ukraine-Kriegs und Europäisierung der NATO
Die NATO feiert ihr 75-jähriges Bestehen als Kriegsbündnis und findet, dass sie notwendiger und lebendiger ist als je zuvor. Sie befindet sich zwar gar nicht unmittelbar im Krieg, bezieht aber den Krieg in der Ukraine als „größte Sicherheitskrise seit Generationen“ auf sich. Der gewaltsam geltend gemachte Einspruch Russlands gegen die NATO-Ostausdehnung hat dem Bündnis wieder die einende Feindschaft zurückgegeben, die ihm mit dem Abdanken seines Systemrivalen abhandengekommen war. Und seit zweieinhalb Jahren entfaltet ihr Stellvertreterkrieg in der Ukraine seine Produktivkraft für die Machtpotenzen des Bündnisses, lässt ihr Aufmarschgebiet auf 32 Staaten anwachsen und heizt die Aufrüstungsanstrengungen der Mitglieder an, deren finanzielle Höhe nun endlich mehrheitlich den Bündnisanforderungen entspricht. Als stärkstes Kriegsbündnis der Militärgeschichte – „heute ist die NATO mächtiger als je zuvor“ (Biden) – erteilen sich die NATO-Führungsmächte den Auftrag, die Weltordnung, die sie als die ihre ansehen, neu zu sichern, und leiten auf dem Gipfel diplomatisch eine Neudefinition ihres Bündnisses ein: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Allianz für die Zukunft und die veränderte Sicherheitslage neu aufzustellen.“ (Scholz) Diese Neuaufstellung wird von der Öffentlichkeit ganz in Bezug auf eine mögliche Wiederwahl des mächtigsten Bündniskritikers aufgegriffen, der die Bedeutung des Ukraine-Kriegs für die US-Weltordnung infrage stellt und damit prahlt, den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. Was die politischen Führer auf beiden Seiten des Atlantiks in ihrer Wertschätzung der NATO als kollektives Instrument ihrer Weltordnungspolitik 1) auf den Weg bringen, wird im Wesentlichen formell als Vorkehrung abgehandelt, um das Bündnis mit seinem unbedingten Willen zur Fortsetzung des Ukraine-Kriegs und seiner gewonnenen kollektiven Stärke „Trump-proof“ zu machen. Der strategische Gehalt der „Modernisierung der NATO“ für eine „neue Ära der kollektiven Verteidigung“ allerdings geht nicht einfach in Absicherungen gegen die zukünftige Eventualität eines Machtwechsels in Washington auf.
1. Die NATO übernimmt die Koordination des Ukraine-Kriegs und definiert sich als Garantiemacht gegen einen russischen Sieg
„Es gibt keine kostenfreien Optionen mit einem aggressiven Russland als Nachbarn. Es gibt keine risikofreien Optionen in einem Krieg. Und denken Sie daran: Die größten Kosten und das größte Risiko werden entstehen, wenn Russland in der Ukraine gewinnt.“ (Stoltenberg, Eröffnungsrede 9.7.24)
So schwört der NATO-Generalsekretär das Bündnis zum Auftakt des Gipfels auf die Alternativlosigkeit des NATO-Kriegskurses ein. Er fegt die nationalen Bedenken mancher osteuropäischer Mitglieder vom Tisch und gibt zugleich zu Protokoll, dass die NATO nach zweieinhalb Jahren Abnutzungskrieg gegen Russland bei gleichzeitig fortschreitendem Verschleiß ihres Stellvertreters noch lange nicht an ihre Grenzen gelangt ist. Die NATO ist entschlossen, die erreichten Kriegsergebnisse Russlands umzukehren und eine Niederlage der Ukraine keinesfalls zuzulassen. Sie verfügt über die nötigen Gewaltpotenzen, die ihr alle Optionen verschaffen, sich ihre Unterstützung frei einzuteilen, und entschließt sich, den Krieg entsprechend zu eskalieren:
Das Bündnis tritt als Garantiemacht des Kriegserfolgs der Ukraine an und macht sich mit den Beschlüssen des Washingtoner Gipfels unmittelbar zum Subjekt von dessen weiterer Organisation und Ausstattung. Parallel zu der Fortführung der Ukraine-Kontaktgruppe im Ramstein-Format unter US-Führung, die bisher alle Waffenlieferungen der einzelnen Staaten koordiniert hat, schafft sich die NATO ein neues Kommando (NSATU – NATO Security Assistance and Training for Ukraine) mit Zentrale in Wiesbaden, das in Zukunft diese Aufgabe übernehmen soll. Damit zieht die NATO die bisherige formelle Trennung zwischen sich und Waffenlieferungen einzelner Mitgliedstaaten aus dem Verkehr, mit der sie bisher darauf bestanden hat, bei aller fürsorglichen Bewaffnung und Betreuung des Krieges nicht dessen eigentliches Subjekt zu sein. In der Abkehr von der bisherigen formellen Organisation als „Koalition der Willigen“ unter US-Führung institutionalisiert das Militärbündnis sich als Führung der weiteren Instandhaltung und Aufrüstung der ukrainischen Kriegspartei und macht sich ganz offiziell zum zentralen Koordinator des Ukraine-Kriegs.
Mit dieser Übernahme der Regie und der Konzentration der zugehörigen Kompetenzen in neuen und ausgebauten NATO-Strukturen einigen sich die Mitgliedstaaten auf organisatorische Verbindlichkeiten innerhalb ihres Bündnisses, die eine „verstärkte, vorhersehbare und kohärente Sicherheitshilfe für die Ukraine auf lange Sicht gewährleisten und die Unterstützung der Ukraine durch Bündnispartner und Partner verstärken“ sollen. 2) Diesen kollektiven Willen unterstreichen sie mit der Selbstverpflichtung auf eine „Mindestbasisfinanzierung“ für die ukrainische Kriegführung in Höhe von 40 Milliarden Euro. Als Ad-hoc-Maßnahme wird die Luftabwehr der Ukraine mit zusätzlichen Patriot-Systemen ergänzt, damit der NATO-Stellvertreter der militärischen Überlegenheit Russlands weiter standhalten kann und als Kriegspartei trotz Dauerbombardement für seine Ausstatter funktionstüchtig bleibt. Die politische Zwecksetzung reicht allerdings darüber hinaus: Der NATO-Ukraine-Rat definiert sie als Beitrag für eine „integrierte Luft- und Raketenabwehrarchitektur für die Ukraine“, die sie aufbaut, um eine „möglichst effiziente Nutzung der ukrainischen Luft- und Raketenabwehrkapazitäten zu ermöglichen und den Übergang der Ukraine zur vollständigen Interoperabilität mit der NATO“ zu gewährleisten. Als weiteren entscheidenden Schritt bei dieser „Anpassung an die westliche Doktrin“ darf sich Selenskyj außerdem über die Zusage Blinkens freuen, dass ein Jahr nach der Gründung der westlichen Kampfjet-Allianz deren Sponsoren nun also wirklich noch im Sommer die ersten F-16-Kampfjets liefern werden. In Bezug auf den laufenden Krieg ermöglicht es die NATO damit ihrem Stellvertreter, in den aktiven Luftkrieg gegen Russland einzusteigen, in dem nun die russische Luftüberlegenheit gebrochen werden soll, um den daraus resultierenden Vorteil in der Kriegführung zunichtezumachen. In Bezug auf ihre eigene Macht als überlegenes Militärbündnis transformiert sie mit Waffenlieferungen und der zugehörigen Ausbildung die ukrainischen Streitkräfte unter dem technischen Terminus der Interoperabilität sukzessive zur NATO-Armee. Personifiziert und damit offiziell gemacht wird all das durch die dauerhafte Verschickung eines ranghohen Generals nach Kiew.
Ihren strategischen Besitzanspruch auf die Ukraine drückt die NATO in der Abschlusserklärung als „unumkehrbaren“ Weg der Ukraine in das Bündnis aus. 3) Als Stellvertreter wird die Ukraine in dem laufenden Krieg rücksichtslos gegenüber den Grundlagen ihrer Souveränität verschlissen, erhält aber zugleich von ihren westlichen Paten die vielversprechende Perspektive der Eingemeindung in das Militärbündnis und des Aufbaus zu einem NATO-Frontstaat. Damit will das westliche Militärbündnis die Ukraine zum genauen Gegenteil dessen machen, was Russland mit seinem Krieg erreichen will: eine neutrale und entmilitarisierte Ukraine. Es eskaliert den laufenden Stellvertreterkrieg mit weiter reichenden Waffengattungen und Freigaben in der Verwendung und fordert Russland zum sofortigen Truppenabzug auf – aus der Ukraine (und Transnistrien und Georgien gleich mit dazu). 4) Es zeigt sich von allem, was Russland in zweieinhalb Jahren Krieg erreicht hat, unbeeindruckt, lässt keine Relativierung seines Kriegsziels – die russische Niederlage – angesichts der aktuellen Kriegslage zu und erteilt den russischen Kriegszielen und Friedensbedingungen damit eine Totalabsage.
Wegen dieser Entschlossenheit in der Fortsetzung und Eskalation des Ukraine-Kriegs weist die Neuaufstellung der NATO über ihn hinaus.
2. Die NATO definiert sich als Friedensmacht für Europa und eröffnet Russland die dafür nötige Kriegsfront
Mit ihrer Rolle als Garantiemacht einer russischen Niederlage im Ukraine-Krieg aktualisiert die NATO zugleich ihre grundlegende Bestimmung als Kriegsbündnis. Dessen einzigartige Qualität besteht allem voran in der in Artikel 5 des Nordatlantikvertrags geregelten Beistandspflicht im Angriffsfall, die alle Mitglieder des Bündnisses verpflichtet, einen Angriff auf eines von ihnen als Angriff auf sie alle zu werten – in seinem Rigorismus passend ausgedrückt in der Warnung vor der Verletzung auch nur eines Quadratzentimeters Bündnisgebiet. Der Angriff auf einen Bündnispartner versetzt alle NATO-Mitglieder unmittelbar mit in eine Kriegssituation und schweißt sie in dieser existentiellen staatlichen Souveränitätsfrage in einem wechselseitigen Verpflichtungsverhältnis zusammen. Die NATO-Mitglieder haben also ihre Souveränität in der für Staaten elementaren Frage, nämlich der von Krieg und Frieden, damit entscheidend zugunsten der kollektiven Kriegsbereitschaft und der vereinten Gewaltpotenzen des Bündnisses relativiert – und dadurch ihre Staatsräson auf die Teilhabe an dem amerikanischen Weltordnungsmonopol ausgerichtet. Historische Grundlage wie Garantie der Aufrechterhaltung dieses elementaren Widerspruchs ist die überlegene konventionelle und nukleare Militärmacht der USA. Konstitutiv für diese Bündniskonstruktion war die existentielle Bedrohung der westlichen NATO-Partner, in die sie durch die Feindschaft mit der Sowjetunion von den USA gestellt waren und die sie sich zu eigen gemacht haben, ohne sie eigenständig aushalten zu können. Das hat eine Unterordnung unter die amerikanische Supermacht für alle unentbehrlich gemacht. Mit dem Ukraine-Krieg definiert die NATO ihren ehemaligen Bündniszweck neu und weist sich eine neu gefasste Langzeitaufgabe zu: Sie bekräftigt ihren Unvereinbarkeitsbeschluss mit der russischen Macht und eröffnet Moskau eine neue kalte Kriegsfront. Sie definiert Russland zur Gefahr für sich und die „euro-atlantische Sicherheitsarchitektur“ und macht es sich zur obersten Pflicht, Russland derart zu entmachten, dass es keine Gefahr mehr für Europa und damit auch nicht mehr für die westliche Weltfriedensordnung darstellt. 5)
In der aktuellen Kriegslage bedeutet das zunächst, dass die NATO nicht nur die Eskalation des Stellvertreterkriegs absichert, sondern ihre Abschreckungsmacht überhaupt ausbaut, also ihre Bündnismitglieder für den Fall eines direkten NATO-Russland-Kriegs in den Status der praktischen Kriegsfähigkeit versetzt. AlsSofortmaßnahme beschließt die NATO auf ihrem Gipfel, ihre Fähigkeit zur „Vorwärtsverteidigung“ mit der Verstärkung der kampfbereiten Streitkräfte an der Ostflanke auszubauen, versetzt die Truppen in erhöhte Bereitschaft und arbeitet mit der Stationierung von NATO-Soldaten in Finnland daran, dass sich die Integration ihrer jüngsten Mitglieder unmittelbar als Machtzuwachs und Verbesserung ihrer ohnehin überlegenen Angriffsmacht geltend macht. Zugunsten ihrer Abschreckungsmacht weist die NATO den Mitgliedern in den laufenden Kriegsvorbereitungen arbeitsteilig ihre Einsatzräume und Aufgaben in dem Szenario eines Bündniskriegs gegen Russland unter ihrem Kommando zu, verbucht deren vorhandene wie die noch zu beschaffenden nationalen Souveränitätsmittel also als Momente ihrer Bündnispotenzen gegen Russland und stellt sicher, dass sie Teil der militärischen Verfügungsmasse bilden. In einer „neuen Generation von Verteidigungsplänen“ verfeinert die NATO ihre interne Abstimmung von Kriegsszenarien, in denen sie das kriegspraktische Zusammenwirken nach dem Vorbild von Steadfast Defender 2024 unter Einsatz der „realen Fähigkeiten“ trainiert, damit die flexible Kriegsfähigkeit „kurzfristig und ohne Vorankündigung“ abrufbar ist.
Für die langfristige Planung eines Bündniskriegs gegen Russland schafft die NATO eine zentrale Beschaffungsagentur, 6) die den Bedarf koordiniert, den sie mit ihren Kriegsvorbereitungen bei den einzelnen Mitgliedern stiftet. Die kollektiv verfügbaren Potenzen nimmt die NATO erstens hinsichtlich ihrer Quantität kritisch unter die Lupe und lässt im Rahmen des „Verteidigungsplanungsprozesses“ (NATO Defence Planning Prozess – NDPP) die Rüstungsproduktionskapazitäten für den laufenden heißen und kalten Krieg hochfahren. Die dazu verplanten Finanzmittel, für deren Umfang sich der Ukraine-Krieg als so ausgesprochen produktiv erwiesen hat, reichen der NATO in ihrem anspruchsvoll wachsenden Gewaltbedarf bei weitem nicht aus, schon werden erste Forderungen nach der Erhöhung des 2-%-Ziels laut. Zweitens inspiziert sie kritisch die Qualität ihrer kollektiven Abschreckungsmacht und ‚entdeckt‘ entsprechend ihrem gewachsenen Anspruch an Eskalationsdominanz in dem vorzubereitenden Bündniskrieg gegen Russland lauter „Lücken“ in ihrer bisherigen militärischen Überlegenheit.
Um eine dieser zentralen „Lücken“ zu schließen, vereinbaren Scholz und Biden am Rande des NATO-Gipfels ab 2026 die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen mit Reichweiten von über 2000 km in Deutschland. Erstmalig nach Abzug der Pershing-Raketen 1991 ergänzt die NATO-Führungsmacht damit wieder die Angriffsfähigkeit ihres Bündnisses um verschiedene Hightech-Varianten einer Waffengattung, die sie sich früher unter dem INF-Vertrag in wechselseitigem Einvernehmen mit dem russischen Feind untersagt hatte. Was ein „Ungleichgewicht“ bei landgestützten Mittelstreckenwaffen gegenüber Russland beseitigen soll, verschafft der NATO umgekehrt – und auf diese Umkehrung kommt es ihr sehr an – die Fähigkeit, die Potenz Russlands, die überlegenen NATO-Streitkräfte auf Abstand zu halten und deren Aufmarsch im Kriegsfall zurückzudrängen, auszuschalten und den Feind mit dem Angriff auf sog. „zeitkritische Hochwertziele“ in seiner Fähigkeit, Kampfhandlungen fortzusetzen, erheblich zu schwächen. 7) Die Kernaufgabe dieser Waffengattung ist es also, die ‚Anti-Access/Area Denial‘-Kapazität Russlands zu überwinden. In diesen Waffen manifestiert sich der Entschluss des westlichen Militärbündnisses, Russland die Fähigkeit zu nehmen, sich und seinen Bestand konventionell zu verteidigen; sie entwerten obendrein die atomare Abschreckungsmacht Russlands. Bei allen Typen dieser konventionellen Mittelstreckenraketen, die nur schwer abgefangen werden können, sind die Vorwarnzeiten erheblich reduziert, und insbesondere die neuen Hyperschallraketen versetzen die NATO in die Lage, entwaffnende Präzisionsschläge auch gegen das Nuklearwaffenarsenal der Russen durchzuführen – was das Risiko des Beginns eines nuklearen Vernichtungskriegs drastisch erhöht; die Fachwelt spricht von einem „erhöhten Anreiz“ wegen des „use ’em or lose ’em“-Szenarios. 8) Und das auf konventionellem Weg, sogar ohne von der „warhead ambiguity“ (der optionalen atomaren Bestückung) dieser Waffengattung Gebrauch zu machen, die natürlich immer mit eingeplant ist. So oder so verlagert die NATO mit dieser Aufrüstung das Risiko des Übergangs zu einer atomaren Eskalation auf Russland.
3. Die Europäisierung der NATO – eine Neudefinition des Verhältnisses der transatlantischen Bündnispartner
Die Daueraufgabe der Entmachtung Russlands, der sich die NATO mit ihrer Selbstbeauftragung als zuständige Ordnungsmacht für Europa verschreibt, wirft für das Bündnis die Frage auf, wie es diese aktualisierte Räson in Zukunft innerhalb seiner Strukturen und zwischen den Mitgliedern organisiert. Um die europäische Friedensordnung offensiv voranzutreiben, bringt die NATO auf ihrem Gipfel – zunächst diplomatisch in Form von lauter Absichtserklärungen – eine neue Aufgabenverteilung zwischen den transatlantischen Bündnispartnern auf den Weg, die dem Imperativ folgt, dass Europa innerhalb der NATO mehr Verantwortung übernehmen muss.





























