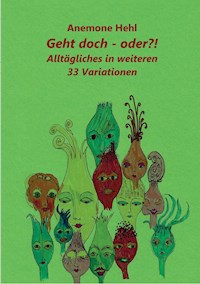
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist ein Buch mit 33 kuriosen, humorvollen und auch anrührenden Kurzgeschichten, in denen es um Menschliches und allzu Menschliches im Alltag geht. Die Geschichten sind tatsächlich erlebt und dann aufgeschrieben worden. Der Leser wird mehr als einmal schmunzeln und sich vielleicht auch in der einen oder anderen erzählten Begegnung wiedererkennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Anemone Hehl, Jahrgang 1948, lebt seit über vierzig Jahren in Ostfriesland. Geboren in Gießen an der Lahn, wohnte sie in verschiedenen Städten in Hessen und Nordrheinwestfalen, machte Abitur in Bremen und studierte Klavier in Berlin. Später nahm sie ein zweites Studium in ihrem Geburtsort auf und wurde Lehrerin. Ihre erste Anstellung fand sie in Rhauderfehn, wo sie bis zu ihrer Pensionierung arbeitete.
Ihre großen Leidenschaften sind die Musik, bildende Kunst und das Schreiben.
Widmung
Dieses Buch widme ich den Menschen, die mir am nächsten stehen: meinen engsten Familienangehörigen.
Das sind meine drei Kinder, meine beiden Enkeltöchter und meine beiden Brüder.
Anemone Hehl
Geht Doch– oder ?!
Alltägliches in weiteren 33 Variationen
© 2022 Anemone Hehl
Umschlag, Illustration: Anemone Hehl
Lektorat, Korrektorat: Berend Wilbers
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-58248-4
Hardcover
978-3-347-58249-1
e-Book
978-3-347-58250-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Aus dem Leben einer Millionärin
Die Sache mit dem Meister und dem Himmel
Der geheimnisvolle Dr. Extrano
Nova kommt zu Ihnen ins Haus
Ein unterhaltsamer Nachmittag
Homi Milano
Ruhestörung
Hier ist die Auskunft
Marie, Marie
Big Band-Probe
Hamburger Straße 23
Wohnortwechsel
In der Wäscheabteilung
Geht doch – oder ?!
Irren ist menschlich
Herkunft
Single-Treff
Fasanen-Fiasko
Nächstenliebe
Schuhe aus Monaco
Spargelessen
Training ist alles!
Wenn einer eine Reise tut
Teneriffa, olé!
Versicherung hautnah
Hotel Imperial
Schlafstörung
Stille Wasser müssen nicht tief sein
Witwenrente und andere Überraschungen
Entführung
Familientreffen
Shalom
Adventsausstellung
Aus dem Leben einer Millionärin
Gitta Hartog lernte ich durch einen guten Freund aus dem Kunstkreis kennen, der mich zu einer der Vernissagen in ihrer stattlichen Villa in L. mitnahm.
Die Galeristin war etwa zwei Jahre zuvor in unserer beschaulichen, der Kultur jedoch recht aufgeschlossenen Stadt aufgetaucht und hatte begehrt, ein historisch bedeutendes Gebäude käuflich zu erwerben. Geplant hatte sie, ein Umweltzentrum zu errichten. Zu ihrem Ärger verweigerten der Trägerverein und die Stadt ihr den Kauf, so dass sie ihre Pläne schließlich verwarf und das aus Hamburg mitgebrachte Vermögen zu einem Teil in ein Stadthaus gewaltigen Ausmaßes investierte. Sie ließ das Gebäude so umbauen, dass sie einige der Räume als Appartements umfunktionieren konnte, die sie monatsweise an bevorzugt männliche Personen vermietete, den Rest des über drei Stockwerke reichenden Gebäudes allerdings beanspruchte sie für sich.
Was mich faszinierte, waren nicht die jungen, stets am Hungertuch nagenden „Künstler“, die sie um sich versammelte wie eine Bienenkönigin ihren Hofstaat (die armen Schlucker wechselte sie mit schöner Regelmäßigkeit aus), sondern ihre prachtvolle Villa. Eine vier Meter breite Marmortreppe führte vom Erdgeschoss in den ersten Stock. Neben einer riesigen Küche befanden sich dort Wohn- und Esszimmer sowie diverse kleinere Räume und Erker, die den Blick auf einen prachtvollen, üppig wuchernden Garten freigaben, in dem herrliche alte Bäume wundervoll Schatten spendeten und wo sie im Sommer Gäste empfing, derer sie viele hatte.
Im zweiten Stock befanden sich weitere Privaträume und mehrere Gästezimmer, die aber alle weit geöffnet und damit jedem Besucher zugänglich und einsichtig waren.
Im dritten Obergeschoss befanden sich rechter Hand einer inzwischen nur noch hölzernen Treppe ein riesiger Dachbodenraum, der ideal als Ausstellungsstätte genutzt werden konnte. In diesem Raum dominierte ein alter Pleyel-Flügel, den Gitta mich mehrfach nötigte zu spielen. Er wurde allerdings dadurch nicht besser.
Am abgefahrensten fand ich ihr persönliches Schlafzimmer: Von diesem dritten Stockwerk ausgehend, führte eine schmiedeeiserne Wendeltreppe direkt in ihr „Allerheiligstes“: ihre Schlafstätte. Es handelte sich um ein breites Doppelbett mit Baldachin. Dieser Baldachin war nichts anderes als ein Kanzelhimmel aus einer Kirche, von dem ein weiter Vorhang über das – nie gemachte und gern zerwühlte – Bett fiel. Gitta pflegte mit einem dezenten Lächeln und einer perfekt unschuldigen Miene zu erklären, dieser „Baldachin“ passe so gut zu ihr.
Ich hatte zeitweilig einen etwas näheren Kontakt zu ihr, konnte selbst einmal in der Hartog‘schen Villa ausstellen und wurde bei mehreren Vernissagen „gebucht“, um die musikalische Untermalung auf dem besagten altersschwachen Pleyel zu übernehmen. Sie ließ sich einige Male von mir nach Bad Zwischenahn begleiten („Ich gehe so ungern allein“), wo wir in einem Tanzschuppen einen vergnügten Abend verbrachten. Ihr Outfit dabei veranlasste mich mehr als einmal, mich fremdzuschämen, denn sie trug jedes Mal einen dunkelblauen Marine–Anzug, der nicht nur befremdlich brav und extrem altmodisch, sondern auch so gewollt „kleinmädchenhaft“ wirkte. Gitta erklärte mir stolz, diesen Anzug habe sie schon seit zwanzig Jahren, und das Geld, das andere Frauen für Kleidung ausgäben, würde sie lieber anderweitig investieren.
Als Dankeschön für meine Begleitung lud sie mich und meinen Mann zum Essen in ihrem Hause ein, aber das Ergebnis ihrer Kochkünste war so grauenvoll, dass wir bei einer weiteren Einladung spontan etwas anderes vorhatten.
Eines Tages, es war Anfang Februar, erhielt ich per Post eine formelle Einladung von ihr. Sie plante, ihren Geburtstag im teuersten Restaurant der Stadt mit einer „Handvoll auserwählter Freunde“ zu begehen. Meinen Mann und mich zählte sie offenbar dazu. Sie lud uns zu einem Essen und zu geselligem Beisammensein in der „Waage“, dem teuersten Restaurant der Stadt mit einem ausgezeichneten Renommee, ein. Erfreut sagten wir zu und begaben uns an dem vorgesehenen Datum dorthin.
Sie begrüßte ihre Gäste huldvoll und mit freundlichen Worten. Wir waren etwa fünfzehn Personen, wobei ich feststellte, dass keiner ihrer „jungen Männer“ anwesend war. Die Geladenen waren vielmehr Freunde und Bekannte von ihr, die schon seit Jahren zum gehobenen Bürgertum der Stadt gehörten und von denen einer ein namhafter Bildhauer war, der auch über die Region hinaus bekannt war.
Die Gäste unterhielten sich angeregt, genossen die vorzüglichen Speisen und sprachen den alkoholischen Getränken wohlwollend zu. Einer von Gittas Bekannten, ein älterer Herr mit sehr weißen Haaren, hielt eine schmeichelhafte Rede auf sie, alles klatschte. Das Geburtstagskind in einem grauen Wollkleid, das ihre gedrungene Figur unvorteilhaft betonte – und welches mit Sicherheit aus den 80er Jahren stammte – hörte sich den Vortrag mit einem gleichbleibenden Lächeln an, die braunen Augen in dem ungeschminkten Gesicht fest auf den Redner gerichtet, den Kopf nur leicht angehoben. Dabei stützte sie das Gesicht in die Hände, denn sie hatte die Ellbogen auf den Tisch gestellt. Die schulterlangen mausbraunen, von einigen grauen Strähnen bereits durchzogenen und leicht fettigen Haare hingen – wie ich fasziniert beobachtete und deshalb dem begeisterten „Lobsänger“ nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit schenkte – haarscharf neben ihrem Vorspeisenteller und drohten über kurz oder lang mit dem Dipp auf dem Teller Bekanntschaft zu machen. Es kam dann aber doch nicht dazu, denn sie lehnte sich entspannt mit einem leichten Lächeln zurück. Als die Rede beendet war und die Gäste zu klatschen begannen, dankte sie allen mit einem huldvollen Blick in die Runde und rief den Kellner herbei mit der Bitte, die Weingläser wieder zu füllen.
Der Abend schritt voran, und alle genossen ihn in vollen Zügen. Gegen Mitternacht entstand eine gewisse Mattigkeit, alle waren gesättigt und zufrieden, der Gesprächsstoff wurde dünn, und die ersten Gäste äußerten verhalten, sie würden gerne nach Hause fahren. Gitta lächelte milde und orderte die Rechnung.
Der Kellner brachte einen ledernen Umschlag, reichte ihn der Gastgeberin und zog sich dezent einige Meter zurück. Gitta Hartog klappte den Umschlag auf und las bedächtig. Dann wandte sie sich an ihre Gäste, lächelte freundlich und verkündete: „Das ist doch etwas mehr geworden als gedacht.“ Sie bedachte uns der Reihe nach mit einem überaus wohlwollenden und keineswegs verlegenen Lächeln. „Das ist mir zu teuer, wenn ich das alles bezahlen soll. Ich schlage vor, ich übernehme die Getränke. Würdet ihr dann bitte euer Essen selbst bezahlen?!“
Wir saßen wie vom Donner gerührt. Wer schon leicht schläfrig auf den Zeitpunkt des Aufbruchs gewartet hatte, wurde schlagartig wieder wach. Selbst bezahlen, obwohl sie sogar schriftlich und damit ganz offiziell zum Essen anlässlich ihres Geburtstags eingeladen hatte?! Von „selbst bezahlen“ war bis vor wenigen Minuten überhaupt nicht die Rede gewesen! Und das war auch ein völlig indiskutables Verhalten von ihr, fand ich.
Ich wechselte einen fragenden Blick mit meinem Mann. Auch die anderen Gäste tauschten ernüchtert Blicke miteinander aus. Der Bildhauer schließlich brach das Schweigen. Er erhob sich halb, zog ein Portemonnaie aus der Hosentasche, entnahm einen großen Geldschein und warf ihn mit einer ruckartigen Handbewegung, in der seine gesamte Missbilligung lag, auf den Tisch. „Das ist doch wieder einmal typisch Hartog“, äußerte er mit gespitzten Lippen, „nur so wird man reich – und bleibt es auch!“
Ungerührt lächelnd, ohne eine Spur von Scham oder Verlegenheit, schaute uns die Gastgeberin, die dann doch keine mehr sein wollte, zu, wie wir unsere Geldbörsen hervorholten und nach unserem Geld kramten. Der Kellner schritt reihum und kassierte mit steinernem Gesicht den jeweiligen Betrag ein, den er jedes Mal neu zu errechnen hatte.
Von der heiteren Gesellschaft war nichts mehr übrig. Die Gäste verschwanden mehr oder minder eilig aus dem Restaurant. Nur Gitta Hartog blieb sitzen, lächelte ihr unschuldig rätselhaftes Lächeln und rief dem Kellner zu:
„Bringen Sie mir noch eine Flasche Wein!“
Die Sache mit dem Meister und dem Himmel
Aga ist die beste Friseurin, der ich je meine Haare und deren Schnitt anvertraut habe. Sie schnippelt mir eine Kurzhaarfrisur, die so flott und fransig aussieht, wobei der Hinterkopf traumhaft füllig wirkt, dass ich ihr dafür einen Orden verleihen möchte – und zwar jedes Mal!
Sie hat ihren kleinen Salon mitten im Zentrum, bildet ein junges, freundliches Mädchen aus, das ihr geschickt zur Hand geht und interessiert zuschaut, wenn Aga arbeitet. Natürlich fegt die Auszubildende nach den Haarschnitten auch die Überreste zusammen, räumt auf und holt den Kunden einen Kaffee.
Und dann gibt es in dem kleinen Salon seit Kurzem noch einen Praktikanten. Wie das Wort schon vermittelt: es ist eine männliche Person. Dieser junge Mann wird um die zwanzig Jahre alt sein, das Gesicht wirkt ein wenig aufgedunsen, ohne wirklich unangenehm auszusehen. Insgesamt neigt er zu Übergewicht; wohlwollend könnte man sagen, er sei ein wenig aus den Fugen geraten, und den über den modischen Gürtel hängenden Bauch würde man bei einem älteren Mann sicher als „Bierbauch“ bezeichnen. Seine Körperhaltung ist definitiv schlecht: hängende Schultern, ohne Spannung. Er schlurft, sofern er sich überhaupt bewegt, mit schleifenden Schuhsohlen durch den Raum, und er atmet dabei so schwer, als habe er gerade zentnerschwere Lasten zu transportieren.
Er atmet allerdings immer so, und Lasten tragen habe ich ihn noch nie gesehen – es sei denn, man bezeichne einen Frisierumhang als Last.
Schon beim ersten Anblick dieses jungen Mannes durchzuckte mich der Gedanke: Oha! Den kenne ich! War vor sieben Jahren mein Schüler – einer von den wenigen, die man gerne ziehen lässt.
Was die Benennung Praktikant anbelangt, so lässt seine „praktische“ Beteiligung im Salon so ziemlich alle Wünsche offen. Diese träge Masse Mensch verfügt jedoch über eine Frisur, bei der man zweimal staunend hinschauen muss. Über den gesamten Kopf stehen die blondierten Haare von etwa acht Zentimeter Länge senkrecht in die Höhe und verharren dort wie eine Kompanie Soldaten in Habacht-Stellung. Lediglich der Nacken ist rasiert. Vielleicht bewegt er sich so ungern, weil er befürchten muss, die Frisur falle in sich zusammen?!
Seine Chefin weist ihn an, mir die Haare zu waschen. Umständlich bereitet er das fahrbare Waschbecken vor, wischt einmal durch und schaut danach zu mir herüber, die ich in einer Entfernung von fünf, sechs Metern der Dinge harre, die da kommen mögen. Er steht also neben dem Gerät, sucht den Blickkontakt zu mir und macht eine kurze Bewegung mit dem Kopf nach rechts, die besagen soll: Komm rüber!
Ich bin für zwei Sekunden sprachlos. Dann platze ich heraus:
„Hallo! Geht‘s noch?!“
Er grinst schräg, dann kommt er zwei Schritte in meine Richtung geschlurft und fragt:
„Was denn? Roten Teppich?“
Ich glaube, er findet sich witzig. Ich werfe ihm einen vernichtenden Blick zu und füge dann doch grinsend hinzu:
„Sehr gerne. Und Blümchen streuen, bitte!“
Seine Chefin ermahnt ihn streng, daraufhin kommt er einen weiteren Schritt in meine Richtung und sagt zuckersüß: „Wir können.“ Bevor Aga eine Bürste nach ihm wirft, nehme ich auf dem Sessel vor dem Waschbecken Platz.
Ich sehe sein Gesicht nicht, aber ich bin sicher, er hat die Augen verdreht. Dann lege ich den Kopf in den Nacken und bekomme zuerst vorsichtig, dann forscher die Haare durchnässt. Seine Kopfmassage mit Shampoo-Begleitung beschränkt sich allerdings auf die Schläfenpartien, aber die sind danach gut durchblutet. Er stöhnt derweil über die Hitze draußen (welche Hitze?), und als ich sage, gestern sei es doch viel wärmer gewesen, wendet er ein:
„Ja, aber da hatte ich kein Make-up drauf.“
Aha. Während er hingebungsvoll seine Hände an meinen Schläfen arbeiten lässt, kichert er vor sich hin und teilt mir auch unmittelbar danach mit, was er so lustig findet.
„Das ist das erste Mal, dass ich meiner Lehrerin den Kopf wasche.“
Einen gewissen schrägen Sinn für Humor hat er ganz offensichtlich!
Aber der Spaß hört für mich auf, als er das Shampoo endlich aus den Haaren spült. In der Woge des Arbeitseifers verteilt er das Wasser so spontan und reichlich, dass innerhalb weniger Sekunden mein Rücken völlig durchnässt ist. Als ich heftig protestiere, klärt er mich wichtigtuerisch darüber auf, dass das nicht seine Schuld und auch nicht meine Schuld sei, sondern das läge an dem blöden Waschbecken. Und er tut erst einmal nichts, außer interessiert meinen Rücken anzustarren.
„Nass ist nass“, wische ich seine Ausrede beiseite, und Aga eilt herbei, um mir den Rücken trocken zu föhnen. Dabei stammelt sie mehrfach Entschuldigungen und wie furchtbar peinlich ihr „der Kerl“ sei. Von ihm höre ich kein Wort des Bedauerns über seine Ungeschicklichkeit. Vorerst steht er unbewegt neben seiner Chefin, die sich damit abmüht, mein T-Shirt zu trocknen.
Aga trägt ihm in unwirschem Tonfall auf, „der Kundin“ sofort einen Kaffee zu holen, was den jungen Mann zu einem schweren Seufzer veranlasst, bevor er davon schlurft, um den Auftrag auszuführen. Dieser Praktikant erscheint mir hier in dem kleinen Frisiersalon so fehl am Platz wie ein Alpaka am Nordpol. Mit seiner Trägheit hatte er schon als Schüler alle Lehrer zur Verzweiflung gebracht, noch mehr allerdings mit seiner aufgeblasenen Wichtigtuerei, hinter der sich allerdings nur „laue Luft“ befand. Wir Kolleginnen und Kollegen hatten sein Gehabe damals der Pubertät zuschrieben – wie man sieht, ein Irrtum!
Beim Servieren erzählt mir der Praktikant, dem ich übrigens keine zehn Tage bei Aga gebe, er wolle seinen Meister machen und groß rauskommen. Ich unterdrücke den starken Drang zu fragen, worin er den Meister zu machen gedenke, da fährt er schon fort, sein großes Vorbild sei K. R. „Äh“, mache ich, „und wer ist das?“ Der Mensch hält in der Bewegung inne, starrt mich fassungslos an und fragt entsetzt: „Was? Den kennst du nicht?“
Ich verkneife mir die Bemerkung, dass ich mich nicht erinnern könne, ihm das „Du“ angeboten zu haben und zucke bedauernd die Achseln. K. R. sei der beste Sänger und Friseurmeister, den es gäbe, werde ich aufgeklärt, und genauso wolle er werden, jawohl! Und er sei praktisch schon kurz davor.
Befriedigt, dass er mir mal so richtig mitteilen konnte, was alles in ihm steckt und er in Kürze sein wird, schaut er mich triumphierend im Spiegel an. Überrascht stelle ich fest, dass er getuschte Wimpern hat. Aga verscheucht ihn, um mir endlich die Haare schneiden zu können, und trägt ihm in barschem Ton auf, die Überschwemmung, die er angerichtet hat, endlich zu beseitigen.
„Das geht jetzt nicht“, erklärt er ungerührt und schlurft davon, um im hinteren Teil des Salons sein Make-up aufzufrischen und den Sitz der Haare zu kontrollieren.
Der geheimnisvolle Dr. Extrano
„Könntest du bitte, bitte, bitte morgen früh nach I. fahren und meinen Termin absagen?“ Maries Stimme war eine Mischung aus Panik und Verzweiflung. Sie hatte kurz vorher vom Tode ihrer Schwiegermutter erfahren und in aller Hektik das gesamte Programm für das Wochenende umgeändert, um zu ihrem Schwiegervater nach Köln fahren zu können. „Ich kann den Arzt nicht erreichen“, jammerte sie und ich hörte sie durchs Telefon mit Pfannen und Töpfen klappern. „Da ist nur die Ansage und kein AB, auf den ich sprechen könnte.“
„Keine Panik!“, beruhigte ich sie. „Ich fahre hin und kläre das.“
„Danke, danke, tausend Dank!“, seufzte sie erleichtert auf. „Ich hätte ja Frauke gebeten, die wohnt in der gleichen Straße, aber die erreiche ich auch nicht.“
„Mach‘ dir keine Gedanken, du kannst dich auf mich verlassen“, versicherte ich ihr erneut. „Ich fahre zu Dr. Extrano und erkläre ihm, warum du nicht kommen kannst.“
Und das tat ich am nächsten Morgen in aller Frühe.
Der Mediziner wohnte am Ende einer sehr langen Straße, die über die Ortsgrenze hinausging und in einen Schotterweg mündete, der zwischen Maisfeldern und saftigen Wiesen weiterführte in eine idyllische Landschaft, von Wallhecken durchzogen und von Weiden umrahmt. Hier hatte der Arzt Dr. Martin Extrano seine Praxis in seinem Privathaus eingerichtet.
Ihn umgab eine Aura des Außergewöhnlichen, des Besonderen, wenn nicht sogar des Charismatischen. Seine Patienten kamen nicht nur aus ganz Deutschland angereist, sondern auch aus dem Ausland, um seine Diagnose einzuholen und sich für viel Geld seinen unkonventionellen Heilungsmethoden zu unterwerfen. Wer gesundheitliche Probleme hatte und bei anderen Medizinern gescheitert war, ließ sich einen Termin bei Dr. Extrano geben und wartete auch gern ein halbes Jahr auf denselben. Dr. Extrano war kompetent, erfolgreich – und teuer.
Während ich mein Auto unter einer Linde am Rande einer Wiese parkte – die wenigen Parkplätze vor der außergewöhnlichen Villa des Arztes waren alle belegt, und weitere Luxuskarossen säumten die Straßenränder – dachte ich daran, dass man sich erzählte, Dr. Extrano sei jahrelang der Leibarzt des Königs einer kleinen Insel inmitten des Pazifiks gewesen. Hatte er aus seinem Heimatort wegen der Steuer verschwinden müssen, überlegte ich, als ich auf das Haus zuging, oder war er als Arzt dermaßen gut, dass selbst ein König sich ihm medizinisch anvertraute? Und sei er nur ein König von einer sehr, sehr weit von I. entfernten Südseeinsel.
Egal, hier war ich und ich würde ganz schnell wieder weg sein. Dann blieb ich aber doch stehen, teils amüsiert, teils verblüfft angesichts des Gebäudes, in welchem er residierte, und ließ das kolossale Gebilde auf mich wirken. Vor mir schien sich der Bug eines Kreuzfahrt-Luxusliners in den ostfriesischen Himmel zu erheben. Das Haus mit den gewaltigen Ausmaßen war – schwarz. Und ganz oben, auf der Spitze, thronte eine überdimensional große Erdbeere im schönsten Erdbeerrot. Wow, der Mann weiß, wie man Aufmerksamkeit erregt!
Offensichtlich besaß er auch ein Faible für weitere ungewöhnliche Kunstobjekte. Da gab es einen inaktiven Brunnen aus ganz unregelmäßig angeordneten Backsteinen, die eher an die Überreste eines eingefallenen Hauses erinnerten. Weiter hinten im Garten erblickte ich eine Herde blauer Schafe, die sich um einen Baum scharten. Und auf dem Weg zu der überraschend schlichten Eingangstür stand ein quietschgelber Kasten, auf dem „Kunstautomat“ stand. Ich hatte flüchtig die Assoziation eines Kondomautomaten, so wie er an der Ecke Südstraße/Kampsweg steht, auch der Gedanke an eine Telefonzelle streifte mich flüchtig.
Genau solch eine stand in der Tat im Wege, als ich zur Eingangstür schritt – gelb, wie die der Deutschen Post einstmals aussahen. Darin befand sich eine Kinder-Schaufensterpuppe, umringt von einer Schar schwarzer Rabenvögel. Aus Plastik!
Als ich ein Stück weiter ging, entdeckte ich in seinem großen Garten weitere exzentrisch anmutende Objekte. Am ungewöhnlichsten und sofort ins Auge fallend war die überdimensional gigantische Voliere – ein Meisterwerk unseres ortsansässigen Schmiedes. Hier hauste des Arztes liebster Gefährte: ein tiefschwarzer und sehr lebendiger Kolkrabe, den der Meister, wie ich später erfuhr, mit „Rabe“ anredete (wie überaus originell!). Außerdem standen beziehungsweise lagen ein paar weitere nett bekleidete Schaufensterpuppen auf dem Rasengrün. Ganz hinten erblickte der interessierte Betrachter einen Hügel, grasbewachsen, den ein weiteres Metallobjekt, nämlich eine Art Pavillon, krönte.
Ich drückte die Tür auf und stand in einem engen Windfang, wo ein gerahmtes „Wort-Bild“ meine Blicke auf sich zog. Der Text forderte mich streng und unmissverständlich auf, den Haus- und Praxisbesitzer „nicht anonym, sondern mit seinem Titel und vollständigen Namen, nämlich Dr. Extrano“ anzusprechen. Ich dachte: Donnerwetter, und vermisste nur den Zusatz: „Sprechen Sie nur, wenn ich Sie dazu auffordere.“
Eine weitere Tür mir gegenüber führte in das Innere des Hauses, und als ich sie geöffnet hatte und in die quadratische Diele getreten war, stockte mir sowohl der Atem als auch der Fuß: Ich sah mich gegenüber einer in Viererreihen aufgestellten Stuhlgruppe, von denen alle Stühle besetzt waren. Vierundzwanzig Augen starrten mich an wie eine Marienerscheinung. Niemand sprach.
Und obwohl im Hintergrund Tschaikowskys 1. Sinfonie gerade einem dramatischen Höhepunkt zusteuerte, spürte ich die Stille körperlich. Mich packte unversehens ein gewisses Gruseln. Tapfer grüßte ich in die Runde, aber die einzige Reaktion war ein kurzes Senken eines Kopfes in meine Richtung. Die Blicke aller schweiften wieder ab.
Ich schaute mich um – überall gingen Räume ab: ein Büro, ein kleiner Raum mit einer Ottomane und Glastischchen (wozu sollte dieser Raum wohl dienen?), ein weiterer mit einem Schreibtisch. Ich ging auf den Raum geradeaus zu – der hatte die gigantischen Ausmaße einer Bahnhofshalle, wirkte aber mit einem riesigen, bestimmt zehn Meter langen Esstisch und den mindestens dreißig Stühlen, die um ihn herumstanden, durchaus wohnlich. Ganz am Ende rechts ging das Esszimmer, denn das war es wohl, in die Küchenzeile über, die aus einem Tresen und dahinter befindlichen Küchenschränken bestand. Ein Flügel – vielleicht ein Steinway? Ich konnte das leider nicht erkennen – vervollständigte das Bild. Mich überfiel spontan das Verlangen, in die Tasten zu greifen.
Oh, beinahe hätte ich den „Arzt“ vergessen zu erwähnen, der über der Küchenzeile mit leuchtend weißem Kittel schwebte. Kein echter – es war eine weitere Schaufensterpuppe.
Faszinierend!
Ich stand also da in der Eingangshalle, sah mich höchst interessiert um – und bemerkte plötzlich, dass zwölf Augenpaare meinen Bewegungen synchron und stumm folgten. Schluck! Wo war bloß die Sprechstundenhilfe? Oder gab es vielleicht gar keine? Aus unsichtbaren Lautsprechern schmetterten die Bläser, untermalt von den schmelzenden Klängen des Streichorchesters. Zu dem Szenario hätte auch Richard Wagner gut gepasst.
„Ja?“ Aus dem Nichts war eine weiß bekittelte Gestalt neben mir erschienen. „Äh!“, machte ich, überrumpelt von der minimalistisch, aber deutlichen Ansprache, fasste mich aber gleich wieder.
Es war keine Geistererscheinung, sondern ein älterer Herr, den ich ob seines geöffneten weißen Kittels haarscharf als Dr. Extrano identifizierte – aber besser wäre es sicher, ich fragte doch mal nach. Eingedenk der im Windfang aufgehängten „Umgangsregel“ fragte ich also: „Sind Sie Dr. Martin Extrano?“ (Darf‘s ein bisschen mehr sein?)
Er zog seine buschigen, weiß-grauen Augenbrauen nach oben und fixierte mich aus eisblauen Augen kühl und etwas von oben herab, obwohl er kaum größer war als ich. Dann nickte er, ohne mich aus den Augen zu lassen. Ich bemerkte gerührt, dass er einen leichten Silberblick hatte. Die Bartstoppeln und ein weißer, fransiger Kurzhaarschnitt hätten durchaus eine Schere vertragen können. Ich brachte in sehr höflicher Manier mein Anliegen hervor. Er lauschte aufmerksam – und die anderen Anwesenden mit Sicherheit auch. Dann nickte er huld- und verständnisvoll, und ich war entlassen.
Also verabschiedete ich mich sehr freundlich und wünschte allen einen „Guten Tag“, bevor ich mich umdrehte und mich zwang, ruhigen Schrittes das Terrain zu verlassen, obwohl ich eigentlich das dringende Bedürfnis gehabt hätte, diesen interessanten Menschen, der seinem Namen in jeglicher Hinsicht gerecht wurde, in ein längeres Gespräch über seinen ungewöhnlichen Kunstsinn zu verwickeln, die Lithographien an den Wänden genauer zu betrachten und zu fragen, ob die Tapeten in den Wohnräumen tatsächlich mit Blattgold unterlegt seien.
Nova kommt zu Ihnen ins Haus
Ich bog schwungvoll um die Kurve und trat noch einmal fester in die Pedale. Noch dreißig Meter, und ich wäre zuhause. Als ich den dunklen, eleganten Wagen in der Einfahrt unseres Hauses stehen sah, stutzte ich, denn er war mir völlig unbekannt. Er hatte ein Oldenburger Kennzeichen und sah gepflegt, vornehm und teuer aus. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass das Mercedes-Coupe meines Mannes in der geöffneten Garage stand – er war demnach daheim und hatte offensichtlich Besuch.
Als ich mein Fahrrad an dem BMW vorbeischob, ließ ich es mir nicht nehmen, in den Wagen zu schauen. Durch die getönten Scheiben erblickte ich auf der Ablage einen Lippenstift, eine perlmuttfarbene Puderdose und eine Schachtel Zigaretten: Cartier. Aha, dachte ich, das ist eindeutig Damenbesuch. Deshalb sollte ich für ihn zur Post, und jetzt komme ich offenbar zu früh zurück.
Ich öffnete geräuschlos die Haustür und schlüpfte in den Flur. Lauschend blieb ich stehen. Das erste, was mir auffiel, war ein intensiv blumiger Duft, der mir in die Nase stach. An der Garderobe, direkt neben der Regenjacke meines Mannes, hing eine voluminöse Damenjacke in schwarz mit einer üppigen Schmetterlingsapplikation, die aus unzähligen schillernden Pailletten bestand.
Ein Luxusweib, dachte ich, das da meinen Mann besucht. Sollte ich überhaupt ins Wohnzimmer gehen, aus dem die Stimmen kamen, die ich hörte?
Erichs Stimme war besonders deutlich in dem Gemurmel zu hören. Er sprach in volltönendem Bariton, immer ein Zeichen eines emotional ausgewogenen und höchst befriedigenden Wohlbefindens. Was er sagte, konnte ich leider nicht verstehen, aber er lachte zwischendurch einige Male wohlwollend auf.
Die Klinke schon in der Hand, stockte ich erneut: Da waren unzweifelhaft zwei weibliche Stimmen zu hören! Bei der einen handelte es sich um einen hellen, durch eineinhalb Oktaven jubilierenden Sopran, die in der oberen Tonlage eine Spur schrill klang, die andere Stimme erinnerte mich eher an einen dramatischen Mezzosopran aus einem Händel‘schen Oratorium. Was nicht ganz echt klang, war ihr gurrendes Lachen, welches im Duett mit Erichs Lache ertönte.
Ich hatte genug gelauscht und war entschlossen, dem kokettierenden, gutturalen Turteln in meinem Wohnzimmer ein Ende zu bereiten, was immer auch der Anlass des Damenbesuchs war. Um ein Schäferstündchen konnte es sich ja nicht handeln, dachte ich ironisch.
Mit dem Öffnen der Wohnzimmertür brach das satte Geturtel jäh ab und machte einem betretenen Schweigen Platz. Hübsch angerichtet in den cognacfarbenen Ledersesseln präsentierten sich meinen Blicken zwei überaus fein gemachte Damen. Erich thronte wie ein Pascha, eingerahmt von seinen Haremsdamen, auf seinem Lieblingssessel in ihrer Mitte und hatte sein durch einen Unfall beschädigtes Bein dekorativ auf den eigens zum Zwecke des Hochlegens angeschafften passenden Hocker gebettet. „Ihro Gnaden“, mein Gatte, trug im Gegensatz zu den herausgeputzten Frauen die übliche verblichene Jeans und ein blauweiß kariertes Hemd, das am Kragen von seinem rauen Bart ganz abgewetzt war. Das am Hals weit offenstehende Hemd – sonst hatte er immer nur den obersten Knopf auf – ließ ein paar blonde, kringelige Brusthaare über die Knöpfe blitzen und verlieh ihm dadurch ein betont männlich-potentes Aussehen.





























