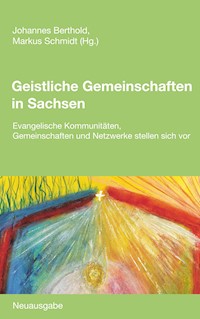
Geistliche Gemeinschaften in Sachsen E-Book
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kommunitäten, Gemeinschaften und Netzwerke innerhalb der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens stellen sich vor. Ihre Texte zeugen von dem spirituellen Reichtum verbindlichen evangelischen Christseins, das in diesen Gemeinschaften gelebt wird. Lange galt es in den Kirchen der Reformation als unvorstellbar, dass evangelische Orden und Lebensgemeinschaften mit einer geregelten Spiritualität überhaupt ein Existenzrecht neben den Kirchengemeinden hätten. Aber es gibt sie nicht nur neben, sondern mit und für die Gemeinden. Die Neuausgabe versammelt in erweiterter und überarbeiteter Fassung nunmehr 23 Selbstvorstellungen von Geistlichen Gemeinschaften in Sachsen. Beiträge von Peter Zimmerling und Jürgen Johannesdotter führen theologisch in Auftrag und Bedeutung evangelischer Kommunitäten ein. Mit Geleitworten von Oberlandeskirchenrat Thilo Daniel und Landesbischof Christoph Meyns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Thilo Daniel
Geleitwort der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Christoph Meyns
Geleitwort des EKD-Beauftragten
Johannes Berthold, Markus Schmidt
Einführung
Grundlagen
Peter Zimmerling
Die Bedeutung der Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften für die evangelische Kirche
Jürgen Johannesdotter
Geistliche Gemeinschaften als Lebensäußerung der Kirche
Christian Schreier
Wie es zu den Treffen Geistlicher Gemeinschaften in Sachsen kam
Dekade der Umkehr 2019–2029
Selbstvorstellungen
Gilbert Peikert, Markus Schmidt
Bruderschaft Liemehna
Susanne Meinel
BRUNNEN Christliche Lebensgemeinschaft
Ruth Gulbins
churchconvention
Manfred Kießig
Communität Christusbruderschaft Selbitz
Manfred Kießig
Tertiärgemeinschaft der Communität Christusbruderschaft Selbitz
Esther Selle
Diakonische Gemeinschaft der Evangelisch-Lutherischen Diakonissenanstalt Dresden
Ingeborg Geiger, Birgit Kenner, Gudrun Stellwag
Evangelische Lebensgemeinschaft Leipzig
Reinhold Fritz
Evangelische Michaelsbruderschaft
Karsten Klipphahn, Christian Zschuppe
Evangelisch-Lutherische Bekenntnisgemeinschaft
Gaston Nogrady, Christian Zschuppe
Evangelisch-Lutherische Gebetsbruderschaft
Christa Knüpfer
Evangelisch-Lutherisches Diakonissen-Mutterhaus Borsdorf
Klaus Tietze, Friedemann Beyer
Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen
David Wohlgemuth
Glaubens- und Lebenszentrum INSEL
Thomas Schönfuß
Haus der Stille Grumbach
Frank Pierel
Hochkirchliche St.-Johannes-Bruderschaft
Friedemann Kuppler
Jesus-Bruderschaft Hennersdorf, Werk- und Studienzentrum
Wolfgang Freitag
Lauenhainkreis
Michael Ahner, Christoph Richter
Oase des gemeinsamen Lebens
Reinhold Nürnberger
Pfarrerinnen- und Pfarrer-Gebetsbund
Alexander Wieckowski
Sächsische Genossenschaft des Johanniterordens
Frauke Groß, Gisela Nowack
Sächsisches Gemeinschafts-Diakonissenhaus ZION e.V. Aue
David Keller, Stefan Kämpf
Theokreis Leipzig
Bertram Viertel
Volksmissionskreis Sachsen
Informationen
Autorinnen und Autoren
Anschriften
Thilo Daniel
Geleitwort der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Liebe Schwestern und Brüder,
Geistliche Gemeinschaften – wenigstens zweierlei ist dazu zu sagen:
Geistlich sind sie. Verbunden in einem Geist. Dem Geist, den uns Jesus Christus selber an die Seite gibt und der zu aller Zeit und an allen Orten Gemeinschaft stiftet (Johannes 14,17).
Das führt gleich das andere nach sich: Gemeinschaft gibt es wohl nur im Plural. Die Gemeinschaft lebt in Gemeinschaften. Einem römisch-katholischen Theologen, Wolfgang Beinert, verdanke ich die Einsicht, dass Einheit immer die Vielfalt voraussetzt. Ansonsten erleben wir „Uniformismus“ anstatt Einheit.
Die Geistlichen Gemeinschaften bilden aus meiner Sicht den Reichtum des Glaubens in der Landeskirche ab. Die Synode der Landeskirche Sachsens hat dieser Bedeutung durch ein erneuertes Gesetz zum Amt der Diakonin und des Diakons Rechnung getragen. An die Geistlichen Gemeinschaften ist die Einladung ergangen, sich in die Landeskirche weiter einzubringen und geistliche Heimat zu geben. Die Gemeinschaften sind ein Zuhause in der Kirche. Sie verbinden den Wunsch nach Verbindlichkeit mit dem lebendigen Ideal, Leben und Glauben zu verbinden. Dies wird wohl in der Landeskirche in Zukunft noch mehr gebraucht als bislang.
Während dieses Geleitwort entsteht, entbehren wir dieser Gemeinschaft auf nie gekannte Weise. Die Bedeutung der Gemeinschaft im Glauben tritt deutlich vor Augen. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf wird der Satz zugesprochen: „Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft“. Diese Feststellung hat an Bedeutung keineswegs eingebüßt.
Diese Veröffentlichung dokumentiert den Reichtum und die Vielfalt der Geistlichen Gemeinschaften im Bereich unserer Landeskirche und die Verbundenheit untereinander, die es vermag, auch unterschiedliche Auffassungen und Haltungen miteinander zu verbinden. Denn die Gemeinschaften wissen sich in der Kirche Jesu Christi verbunden.
Deshalb wünsche ich der Neuausgabe dieser Veröffentlichung eine weite Verbreitung. Das ist mit der Hoffnung verbunden, dass die Gemeinschaften für den Glauben be-geistern können. Den Gemeinschaften wünsche ich, dass sie offen bleiben für diejenigen, die sich begeistern lassen. So kann die Gemeinschaft vielfältig bleiben und weiter mitwirken am Auftrag der Kirche, der im 1. Petrusbrief ausgesprochen wird:
„als lebendige Steine zum geistlichen Hause zu erbauen“ (1. Petrus 2,5).
In herzlicher Verbundenheit,
Dr. Thilo Daniel,
Oberlandeskirchenrat
Christoph Meyns
Geleitwort des Beauftragten des Rates der EKD für den Kontakt zu den geistlichen Gemeinschaften und evangelischen Kommunitäten
In der Vergangenheit haben sich Reformvorschläge im Bereich der Kirche – in Anlehnung an Methoden aus Marketing und Management – immer wieder an der Frage orientiert, welche organisatorischen Maßnahmen geeignet sind, um Gottesdienstbesuch, Amtshandlungs- und Mitgliederzahlen zu steigern. Eher weniger haben Kirchenleitungen über Fragen diskutiert, die die geistliche Dimension des kirchlichen Lebens betreffen.
Eben an dieser Stelle liegt der besondere Beitrag, den die geistlichen Gemeinschaften für die Vitalität der Kirche leisten können.
Mit Stundengebeten, Gottesdiensten und Gebetszeiten sowie mit ihrer liturgischen und musikalischen Arbeit, in der sakralen Kunst, der Gestaltung ihrer Räume und ihrer Gärten, mit ihrer Gastfreundschaft, ihrem gemeinsamen Leben und ihrem diakonischen Engagement gestalten sie auf intensive Weise geistliches Leben. Von besonderer Bedeutung ist für mich dabei der Raum des Rückzugs in die Stille, den sie Menschen bieten.
In einer Zeit, in der Glaube immer weniger durch institutionelle Bindungen gestützt wird, kommt es darauf an, dass Menschen eigene geistliche Erfahrungen machen können. Gott redet ebenso deutlich und verständlich zu uns wie in jeder anderen Epoche der Menschheitsgeschichte. Das Problem besteht darin, dass unsere Zeit so laut ist und jeden Tag mit so vielen Stimmen gefüllt wird, dass wir seine Stimme im Alltag kaum mehr hören. Menschen brauchen „Wüstenorte“, Räume des Schweigens, in denen die Chance besteht, dass die äußeren und inneren Stimmen zur Ruhe kommen und das Hören auf Gott wieder möglich wird.
Wer sich in der Mischung aus Ordnung und Freiheit für längere Zeit auf die Stille einlässt, wird auf neue Weise hellhörig im Blick auf sich selbst, auf seine Umgebung und auf die Gegenwart Gottes. Es ist ein Weg in die Tiefe, von der Ebene der bewussten Sprache über die Welt der Bilder und Träume, die Dimension körperlicher Empfindungen und Gefühle bis hinein in das kontemplative Sein vor Gott jenseits dessen, was sich direkt zur Sprache bringen lässt.
Ich meine deshalb, dass den geistlichen Gemeinschaften eine große Bedeutung für die Erhaltung und Erneuerung des kirchlichen Lebens zukommt. Als Beauftragter des Rates der EKD für den Kontakt zu den geistlichen Gemeinschaften und evangelischen Kommunitäten freue ich mich daher über die Neuausgabe dieses Buches. Möge es viele Leserinnen und Leser finden, die darin Inspiration für ihr geistliches Leben entdecken.
Dr. Christoph Meyns,
Landesbischof der Ev.-Luth. Landeskirche in Braunschweig
Johannes Berthold, Markus Schmidt
Einführung
Gemeinschaften stellen sich vor
Ein Buch nicht nur über, sondern von Geistlichen Gemeinschaften mag als eine Selbstempfehlung erscheinen, die deren Wesen eigentlich fremd ist. Doch die Gemeinschaften erfahren solche Empfehlungen im Raum der evangelischen Kirche eher von außen. So heißt es in dem Perspektivpapier „Kirche der Freiheit“, das der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Jahr 2006 veröffentlich hatte:
„Ein ganz neues Gewicht gewinnen Kommunitäten und klosterähnliche Gemeinschaften an besonderen kirchlichen Orten. Die Zahl evangelischer Gemeinschaften mit einer verbindlichen geistlichen Lebensform wächst; oftmals erfüllen sie herausgehobene geistliche Räume mit ihrem spirituellen Leben. Sie wollen und sollen den Dienst der Ortsgemeinden ergänzen. An solche Orte kommen Menschen, die Zeiten der Stille und des gemeinsamen geistlichen Lebens, also ein ,Kloster auf Zeit‘ suchen. Soweit ihre Gottesdienste und Gebetszeiten öffentlich sind und sie sich im Rahmen der kirchlichen Glaubens- und Lebensordnungen bewegen, sind diese Kommunitäten ein Schatz der evangelischen Kirche, dessen Bedeutung für die evangelische Frömmigkeit im Wachsen ist“.1
Solche Hochschätzung kann leicht zur Überschätzung führen. Am ehesten wird sie vermieden, wenn Geistliche Gemeinschaften sich selbst beschreiben. Sie kennen sich selbst am besten – ihr Anliegen und ihre Verwirklichung, ihre Träume und ihre Enttäuschungen, ihren Reichtum und ihre Armut.
In diesem vorliegenden Buch stellen sich evangelische Kommunitäten, Geistliche Gemeinschaften und Netzwerke in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens selbst vor. Sie sind in der Verschiedenheit ihrer Geschichte und ihrer Anliegen wie bunte Blumen. Sie haben unterschiedliche Wurzeln und Farben. Und doch sind sie zusammengebunden in dem gemeinsamen Wunsch, der geistlichen Erneuerung unserer Kirche zu dienen.
Treffen Geistlicher Gemeinschaften in Sachsen
Seit 2007 sind die meisten dieser Gemeinschaften in den Treffen Geistlicher Gemeinschaften in Sachsen vernetzt. Bei diesen regelmäßigen Begegnungstagen kommen Mitglieder und Interessierte zusammen. Trotz des ökumenischen Anliegens unserer Gemeinschaften konzentrieren sich die Treffen auf die evangelischen Gruppen in Sachsen, um diesen lange vernachlässigten Bestandteil evangelischer Spiritualität zu stärken.
Im Mai 2020 ist das Netzwerk der Geistlichen Gemeinschaften online gegangen: www.geistliche-gemeinschaften-sachsen.de.
Mittlerweile sind unsere Gemeinschaften eine feste Größe in der sächsischen Landeskirche. Seit 2014 haben sie sogar einen Sitz in der Landessynode, den in der aktuellen Legislaturperiode (27. Landessynode bis 2020) Sr. Esther Selle von der Diakonischen Gemeinschaft der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Dresden wahrnimmt. Diese Entwicklung zeigt, wie die Gemeinschaften einen nicht wegzudenkenden Bestandteil der lebendigen Spiritualität in der sächsischen Landeskirche bilden. Sie bestätigt damit, was der frühere Tübinger Praktische Theologe Werner Jetter (1913–2004) festgestellt hatte:
Die Kirche Jesu Christi könne grundsätzlich „nicht auf die Intimität ihrer Glaubensgemeinschaft verzichten, ohne sich selbst zu entleiben. So ist es zu verstehen, daß sie in ihrer Geschichte, nicht nur in der Ursprungszeit, sondern auch, je größer sie wurde, immer wieder mit der Bildung von Gruppengemeinschaften und dem Ruf nach solchen zu tun hatte. Dies ist zwar nie eine problemlose, aber immer eine besonders wichtige konstruktive ekklesiale Realität gewesen“.2
Es sei gerade die kleine Gruppengemeinschaft, die die „Lücken der großkirchlichen Praxis“, so Jetter, mit ihrer unterscheidbaren Lebensgestaltung, ihrem konkreten Nächstendienst und ihrem klaren Bekenntnis schließe.
Die 23 im Buch vertretenen Gemeinschaften
Diese Neuausgabe unseres erstmals 2016 in zwei Auflagen erschienenen Buches ist gewachsen. Sie erscheint erweitert und vollständig überarbeitet. Von den fast 30 Gruppen sind in diesem Buch nunmehr 23 mit eigenen Beiträgen vertreten.
Wie könnte besser die Verschiedenartigkeit dieser Gruppen und ihrer Mitglieder am besten beschrieben werden? Die einen bestehen aus noch jungen Mitgliedern, andere verbinden Menschen unterschiedlicher Generationen, einige sind schon in die Jahre gekommen. Manche entstammen als diakonisch oder missionarisch ausgerichtete Gemeinschaften der Inneren Mission des 19. Jahrhunderts, andere repräsentieren die klösterlichen Kommunitäten der Nachkriegszeit. Manche leben ehelos, manche verheiratet, manche bilden Lebensgemeinschaften auf Zeit und andere wiederum kommen in regelmäßigen Abständen zusammen. Die einen stellen Gemeinschaften von Pfarrerinnen und Pfarrern, Vikaren oder Theologiestudierenden dar, während andere verschiedene Berufe verbinden. Einige leben nach einer festen Regel, einige organisieren sich eher spontan. Hochkirchlich, pietistisch, betont lutherisch, evangelikal und / oder charismatisch sind sie. Es ist unmöglich, sie einfach einer Schublade zuzuordnen.
Was sie alle verbindet: das ora et labora, das „bete und arbeite“, das Benedikt von Nursia (ca. 480–547) seiner Mönchsgemeinschaft auf dem Monte Cassino ins Stammbuch (die Regel) geschrieben hatte und das sich über den Benediktinerorden hinaus als eine Grundregel christlicher Spiritualität erwiesen hat. Dieses Motto wird verschieden gelebt und führt doch auf die allen gemeinsame Wurzel der verbindlich gestalteten, gemeinschaftlichen Nachfolge Jesu Christi zurück.
Neben den im Buch vertretenen Gemeinschaften gibt es noch einige weitere, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Beitrag liefern konnten. Sie seien an dieser Stelle erwähnt: die Schwesternschaft vom Trinitatis-Ring in Leipzig, die Christophorus-Bruderschaft, die Christusträger-Bruderschaft, die Burgarbeit Christliches Sozialwerk und Lebenshilfe in Leipzig3.
Inhalt und Aufbau des Buches
Diese Neuausgabe ist in drei Teile gegliedert: Der erste Teil bietet grundlegende theologische und historische Reflexionen zu Geistlichen Gemeinschaften in der evangelischen Kirche bzw. in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens. Im zweiten Teil, dem Hauptteil des Bandes, stellen sich 23 Kommunitäten, Gemeinschaften und Netzwerke selbst vor. Den Schluss bilden Anschriften und die Autorenübersicht.
Der Leipziger Praktische Theologe Peter Zimmerling steuert auch für diese Neuauflage seinen grundlegenden und wegweisenden Text zur Bedeutung der Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften für die evangelische Kirche wieder bei. Zimmerling hatte seine Gedanken für den EKD-Text „Verbindlich leben. Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ein Votum des Rates der EKD zur Stärkung evangelischer Spiritualität“4 von 2007 entwickelt und im gleichen Jahr auf dem ersten Treffen Geistlicher Gemeinschaften in Sachsen vorgetragen.
Der frühere Beauftragte des Rates der EKD für den Kontakt zu den Kommunitäten, Landesbischof i.R. Jürgen Johannesdotter liefert einen einleitenden Beitrag, indem er theologische und historische Eckdaten der Entstehung evangelischer Kommunitätenbzw. Gemeinschaften markiert. Er formuliert Beobachtungen über aktuelle Entwicklungen der Gemeinschaften in Deutschland.
Pfarrer Christian Schreier beschreibt, wie es zu den Treffen Geistlicher Gemeinschaften in Sachsen kam. Als Vordenker dieser Treffen hält er persönliche Erinnerungen fest.
Von ihm stammt auch die Anregung für eine Dekade der Umkehr, die auf dem Treffen Geistlicher Gemeinschaften am 29. und 30. November 2019 in Moritzburg angenommen wurde. Der entstandene Text wird ebenfalls im ersten Teil dieses Buches dokumentiert.
Den Kern und größten Teil des Buches bilden die Selbstvorstellungen der sächsischen Kommunitäten, Gemeinschaften und Netzwerke. Sie sind von Schwestern und Brüdern der einzelnen Gruppen verfasst. Die alphabethisch geordneten Beiträge folgen einem gleichen Aufbau, indem sie nach den sechs Abschnitten gegliedert sind:
Geschichte,
Profil,
Struktur,
Gemeinsames Leben,
Aktivitäten/Angebote,
Netzwerk.
Im Schlussteil des Buches findet sich wieder eine, auf den aktuellen Stand gebrachte, Adress- und Kontaktliste aller im Buch vertretenen Gemeinschaften sowie eine Übersicht der Autorinnen und Autoren.
Dank und Widmung
Als Herausgeber danken wir allen Schwestern und Brüdern, die sich dem Wagnis dieses Buchprojektes gestellt und einen Beitrag über ihre Gemeinschaft beigesteuert haben.
Die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens hat auch diese Neuausgabe mit einem großzügigen Druckkostenzuschuss freundlich gefördert und dadurch überhaupt ermöglicht. Dafür gilt unser besonderer Dank. Schließlich sind wir allen zu Dank verpflichtet, die unsere Kommunitäten, Gemeinschaften und Netzwerke durch ihr Interesse, ihre Freundschaft und mit finanziellen Hilfen unterstützen.
Unsere Widmung, mit der wir die erste Auflage dieses Buches versehen hatten, erneuern wir. Wir widmen es der Landeskirche Sachsens. Mögen die Leserinnen und Leser inspiriert werden, über den zukünftigen Weg unserer Kirche nachzudenken. Ihr gilt unsere Liebe und unsere Sorge – vor allem aber unsere Hoffnung. Denn wie Johannes Calvin zuversichtlich formuliert hatte:
„wenn die Kirche nicht leuchtet, halten wir sie schnell für erloschen und erledigt. Aber so wird die Kirche in der Welt erhalten, dass sie auf einmal vom Tode aufsteht, ja am Ende geschieht diese ihre Erhaltung jeden Tag unter vielen solchen Wundern. Halten wir fest: Das Leben der Kirche ist nicht ohne Auferstehung, noch mehr: nicht ohne viele Auferstehungen“.5
1 Kirche der Freiheit. Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert. Ein Impulspapier des Rates der EKD, hg. vom Kirchenamt der EKD, Hannover 2006, 56 (Hervorhebungen im Oiginal).
2 Jetter, Werner, Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst, Göttingen 21986, 231.
3 Zur Burgarbeit vgl. Drechsler, Sieglinde, Die Burgarbeit. Unsere Zeit in Liemehna, in: Schmidt, Markus (Hg.), Ein Haus aus lebendigen Steinen. 40 Jahre Bruderschaft Liemehna, Berlin 2013, 71–76.
4 Kirchenamt der EKD (Hg.), Verbindlich leben. Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ein Votum des Rates der EKD zur Stärkung evangelischer Spiritualität (EKD-Texte 88), Hannover 2007.
5 Ioannis Calvini opera quae supersunt omnia, Bd. 43, hg. von Wilhelm Baum/Eduard Cunitz/Eduard Reuss (Corpus reformatorum 71), Braunschweig 1890, 353.
Grundlagen
Peter Zimmerling
Die Bedeutung der Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften für die evangelische Kirche6
Vorbemerkungen
Im Vatikan gibt es schon lange eine eigene Kongregation für das Ordenswesen. Dieses kirchenleitende Ministerium wacht über die Ausbildung, Verwaltung und Regeltreue der Mitglieder von Orden und Säkularinstituten und kontrolliert die Integration ihres spezifischen Auftrags in die Aktivität der Kirche insgesamt. Päpste, Kardinäle und Bischöfe bringen regelmäßig in öffentlichen Verlautbarungen zum Ausdruck, dass die Orden und neuen geistlichen Gemeinschaften unerlässlich für das Leben der katholischen Kirche seien. Am durchdachtesten hat dies zuletzt 1998 der damalige Präfekt der Glaubenskongregation Joseph Kardinal Ratzinger in seiner Rede über den theologischen Ort der geistlichen Gemeinschaften getan.7 Er stellt darin fest: „Ortskirchliche Struktur und apostolische Bewegungen brauchen einander. Wo eines von beiden geschwächt wird, leidet die Kirche als Ganze“. Institutionelle und charismatische Dimension sind gleichermaßen für die Kirche unverzichtbar.
In der Evangelischen Kirche wurden die Geistlichen Gemeinschaften und Kommunitäten erst 1979 durch die Denkschrift „Evangelische Spiritualität“ kirchenamtlich anerkannt. Die Landeskirchen waren von der Entstehung zahlreicher Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften im 20. Jahrhundert mehr oder weniger überrascht worden. Mit der Denkschrift vollzog die evangelische Kirche einen tief greifenden Paradigmenwechsel. Sie brach – vorbehaltlos – mit der aus der Reformationszeit herrührenden Ablehnung monastischer Lebensformen. Die Studie geht davon aus, dass Kommunitäten eine legitime Ausprägung biblisch-reformatorischen Christseins darstellen und würdigt sie als Orte spiritueller Übung und Erfahrung: „In neuerer Zeit sind Kommunitäten und Einkehrhäuser für viele zu ‚Gnadenorten‘ geworden. Diese Entwicklung sollte gefördert werden.“
Die Vorbehalte, ob kommunitäre Spiritualität Heimatrecht im Protestantismus besitzt, sind fast 30 Jahre nach Erscheinen der Denkschrift immer noch weit verbreitet. Das jüngste Wort des Rates der EKD vom Januar 2007 zu Kommunitäten „Verbindlich leben. Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ein Votum des Rates der EKD zur Stärkung evangelischer Spiritualität“8 hat nichtsdestotrotz – erstmals seit 500 Jahren – die Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften als eine legitime Sozialgestalt der evangelischen Kirche anerkannt.
1. Zum Sprachgebrauch
Der aus dem Französischen und Englischen stammende Begriff „Kommunität“ wird im Deutschen in einem engeren und einem weiteren Sinn verwendet. Im engeren Sinn bezeichnet er evangelische Gemeinschaften, die nach der – häufig modifizierten – Regel der drei monastischen Gelübde auf Dauer zusammenleben: des Gehorsams gegen eine Leitungsinstanz, des Verzichts auf Privatbesitz und auf die Ehe (z.B. die „Communauté de Taizé“ oder die „Communität Christusbruderschaft Selbitz“). Hierher gehören auch die z.T. bereits im 19. Jahrhundert entstandenen Diakonissenmutterhäuser. Im weiteren Sinn findet der Begriff für Schwesternschaften, Bruderschaften und Gemeinschaften von Frauen und Männern Verwendung, deren Mitglieder zwar nach einer verbindlichen Regel ihr Christsein gestalten und auch regelmäßig zu Tagungen und Einkehrzeiten zusammenkommen, ohne sich aber aus Familie und Beruf zu lösen (z.B. die „Evangelische Michaelsbruderschaft“). Es gibt auch Gemeinschaften, die beide Formen umfassen (z.B. die „Jesus-Bruderschaft Gnadenthal“). Eine besondere Form geistlicher Gemeinschaften stellen schließlich die bereits aus der Reformationszeit stammenden evangelischen Damenstifte dar, die ihre Entstehung der Umwandlung vorreformatorischer Klosterkonvente verdanken. Die heutigen Selbstbezeichnungen der Gemeinschaften lassen eine bunte Vielfalt erkennen, die sich meist aus ihrer Eigenart und Entstehungszeit ergibt, aber nicht unbedingt ihre innere Struktur zum Ausdruck bringt (Kommunität, Bruder- und Schwesternschaft, Familie, Ring, Kreis, Gilde, Foyer, Oratorium, Kloster, Konvent, Cella, Priorat, Orden u.a.).
2. Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften als eine legitime Sozialgestalt der evangelischen Kirche
Der Kirchenrechtler Hans Dombois hat überzeugend nachgewiesen, dass vier Sozialgestalten für die Kirche essentiell seien. Sie bildeten sich in den ersten vier Jahrhunderten des Christentums heraus: universale Kirche, partikulare bzw. regionale Kirche, Ortsgemeinde und Orden bzw. Kloster. Ortsgemeinde und universale Kirche sind dabei gleich ursprünglich, was bereits an der Doppelbedeutung des neutestamentlichen Begriffs der Ekklesia im Sinne von Gesamtgemeinde (1Kor 15,9) und Einzelgemeinden (1Kor 1,2) sichtbar wird. Beide Gestalten von Kirche besitzen die gleiche Dignität. Sehr bald entwickelte sich auch die dritte Gestalt von Kirche, die Partikularkirche, die begrifflich neben und sachlich innerhalb der universalen Kirche steht. Ansätze zur Entwicklung von Partikularkirchen finden sich wiederum schon im Neuen Testament. Hier ist z.B. die durch die paulinische Mission entstandene griechisch geprägte Kirche zu nennen (vgl. auch 1Kor 16,1, wo Paulus von „den Gemeinden in Galatien“ spricht). An der Wende vom dritten zum vierten Jahrhundert entstand schließlich eine vierte Sozialgestalt von Kirche, die später unter der Bezeichnung Orden bzw. Kloster begrifflich zusammengefasst wurde.
Unter Orden sind alle selbständigen Gruppen zu verstehen, „die auf Grund besonderer Berufung und freier Wahl ihrer Glieder in bewußter Korrelation zu der grundsätzlich jedem Christen zugänglichen ‚Kirche‘ und ‚Gemeinde‘ stehen, aber eben darum selbst nicht Kirche oder Gemeinde zu sein beanspruchen [...]. Aus dieser bewußten Begrenzung und bejahten Bezogenheit ergibt sich über den präzisen und engeren Begriff des Ordens hinaus der hier gemeinte, für die Struktur der Kirche charakteristische Verbandstypus, dessen weiteste, schon etwas blasse Umschreibung man im Begriff der ‚besonderen Dienstgemeinschaft‘ versuchen könnte“.9
Neutestamentliche Analogien zum späteren christlichen Ordenswesen lassen sich im Zusammenleben der Jünger und Jüngerinnen des irdischen Jesus (Lk 8,1–3), ansatzweise vielleicht auch in der Jerusalemer Urgemeinde finden (Apg 2,42–47). Den Orden kommt wie den drei anderen Sozialgestalten für die Kirche konstitutive Bedeutung zu. Sie sind deshalb nicht ausschließlich durch den Verweis auf außergewöhnliche Entstehungsbedingungen, wie z.B. eine verweltlichte oder reich gewordene Kirche und darauf reagierende besondere asketische Bestrebungen zu erklären. Vielmehr kommt den Orden eine für die drei anderen Gestalten der Kirche auf Dauer unverzichtbare spirituelle und institutionelle Prägekraft zu. Die vier Sozialformen der Kirche stellen nämlich keine isolierten Größen dar, sondern verweisen aufeinander und sind untereinander verbunden. Evangelische Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften sind eine legitime Sozialgestalt auch der evangelischen Kirche.
3. Die Entstehung von evangelischen Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften im Protestantismus – Stationen auf dem Weg
Schon die Reformationszeit zeigt, dass Minderheitsbildungen im Raum der Großkirche anscheinend notwendig zu ihrer Existenz dazu gehören. Es sieht so aus, als bildeten die damals entstandenen täuferischen Gemeinschaften – der sogenannte linke Flügel der Reformation – eine Art Ersatz für das verdrängte Ordenswesen. Im Laufe der weiteren Geschichte des Protestantismus wurde zwar immer wieder versucht, alle Sondergemeinschaften zu unterdrücken. Dennoch kam es spätestens seit dem 18. Jahrhundert im Raum der evangelischen Landeskirchen zur Bildung von geistlichen Gemeinschaften, die die Rolle der Orden übernahmen.
Dabei hätte es schon während der Reformationszeit nicht zwangsläufig zur Auflösung fast aller Orden und Bruder- und Schwesternschaften kommen müssen. Es gibt durchaus positive Aussagen der Reformatoren zum Ordenswesen, aus denen hervorgeht, dass sie nur die Missbräuche abgeschafft wissen wollten, nicht aber die Sache selbst.10
Im Barockpietismus konnten Philipp Jakob Spener, Gerhard Tersteegen und Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf erste Ansätze kommunitären Lebens zum Teil dauerhaft etablieren. Einen weiteren Ansatzpunkt kommunitären Lebens in der evangelischen Kirche stellten im 19. Jahrhundert die an vorreformatorische Tradition anknüpfenden, ganz auf diakonische Aufgaben ausgerichteten Schwestern- und Bruderschaften dar. Die ersten wurden von Johann Hinrich Wichern in Hamburg (1833), von Theodor und Friederike Fliedner in Kaiserswerth (1836) und von Wilhelm Löhe in Neuendettelsau (1853) ins Leben gerufen.
Im 20. Jahrhundert schließlich gab es drei Entstehungswellen gemeinschaftlichen Lebens in der evangelischen Kirche. Zunächst schlossen sich vor und nach dem Ersten Weltkrieg einzelne Bruderschaften ohne gemeinsames Leben zusammen. Am bekanntesten und größten wurde die 1931 gegründete „Evangelische Michaelsbruderschaft“. Abgesehen von Bonhoeffers Bruderhaus in Finkenwalde 1935 und der schon 1940 gegründeten Bruderschaft in Taizé entstanden die ersten Kommunitäten mit gemeinsamem Leben erst unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals bildeten sich evangelische Orden in der Traditionslinie vorreformatorischer Regeln wie die „Communität Christusbruderschaft Selbitz“ (1949). Ende der 1960er-Jahre formierten sich Familiengemeinschaften als Erneuerungskerne in einer Zeit tief greifender gesellschaftlicher Umbrüche. Zu ihren größten zählt die Familienkommunität der „Jesus-Bruderschaft Gnadenthal“ (1968).
4. Gründe, warum Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften für die Kirche unverzichtbar sind
Martin Luther wies der reformatorischen Spiritualität Familie und Ortsgemeinde, Beruf und Gesellschaft als primäre Verwirklichungsfelder zu.11 Er verlegte damit das Zentrum der christlichen Frömmigkeit vom Kloster in die Familie und schuf auf diese Weise die Hauskirche. Gleichzeitig machte er den weltlichen Beruf und damit die Gesellschaft zum Bewährungsfeld des Glaubens. Reformatorische Spiritualität stellte gegenüber der mittelalterlichen Frömmigkeit einen qualitativen Fortschritt dar: Sie war eine Spiritualität für jedermann und zeichnete sich durch Alltagsverträglichkeit aus. Familie und Ortsgemeinde, Beruf und Gesellschaft haben sich in den folgenden Jahrhunderten als bevorzugter Raum reformatorischer Spiritualität bewährt. Luthers eigene Ehe und Familie wurde zum Prototyp der neuzeitlichen protestantischen Familie. Im evangelischen Pfarrhaus als Abbild von Luthers Haus lag auch im kleinsten Dorf die dafür nötige Veranschaulichungsinstanz vor. Im Rahmen der Familie gelang durch den Katechismus mit Unterstützung der parochialen Kirchengemeinde die Weitergabe des Evangeliums an die nächste Generation. Indem der weltliche Beruf von Luther zum Bewährungsfeld des Glaubens gemacht wurde, erhielt die weltliche Arbeit religiöse Orientierung. Jeder Christ war dazu befreit, in seinem weltlichen „Beruf“ zur Ehre Gottes und zum Wohl der Mitmenschen zu wirken. Dadurch wurden im neuzeitlichen Europa ungeahnte schöpferische Kräfte im Menschen freigesetzt.
Inzwischen hat sich die gesellschaftliche Situation gegenüber dem 16. Jahrhundert tiefgreifend gewandelt. Seit der Industriellen Revolution entwickelte sich die mittelalterliche und frühneuzeitliche Großfamilie über die Kleinfamilie zur Kleinstfamilie. Sie wurde zunehmend weniger im reformatorischen Sinn als Hauskirche erlebt. Ihre religiöse Grundierung ging verloren. Mit der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft verlor auch der lutherische Berufsgedanke seine religiöse Prägung. Inzwischen wird der Beruf kaum noch als Bewährungsfeld des Glaubens, sondern als Ort des Geldverdienens und der Selbstverwirklichung verstanden. Neben Familie und Beruf trat in den vergangenen Jahrzehnten auch die Ortsgemeinde in ihrer Bedeutung für die Spiritualität des einzelnen Kirchenmitglieds zurück. Die Bewohner einer Großstadt wählen unter den verschiedenen Angeboten den Gottesdienst aus, der ihnen zusagt. Die parochiale Struktur reicht inzwischen weder aus, um einen Großteil der Menschen einer mobilen, pluralistischen Gesellschaft mit dem Evangelium zu erreichen, noch um die Weitergabe des Evangeliums an die nachfolgende Generation zu gewährleisten. Das zunehmende Auseinanderdriften in unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und verschiedene ästhetische Milieus, die kaum eine gemeinsame Kommunikationsebene haben, macht es notwendig, das herkömmliche parochiale System durch zusätzliche Sozialgestalten von Kirche zu ergänzen. Dabei sind die Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften unverzichtbar.
Überdies bilden Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften ein notwendiges Gegengewicht zu einem im 19. Jahrhundert herausgebildeten protestantischen Frömmigkeitstypus, der von Individualismus, Subjektivismus und Innerlichkeit bestimmt ist. Mehr und mehr ist der traditionellen evangelischen Spiritualität der Gemeindehorizont verloren gegangen. Eine gewisse Unverbindlichkeit und Profillosigkeit waren die Konsequenz. Gleichzeitig drohte evangelischer Spiritualität der Verlust der Form. Die Bedeutung von Symbol und Ritual für den Glauben wurde unterschätzt. Mitglieder von Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften setzen stattdessen auf eine gemeinsam gelebte verbindliche Glaubenspraxis, zur der regelmäßige Gottesdienste und nach Möglichkeit auch Stundengebete gehören. Dabei hat sich die Pflege von liturgischen und anderen spirituellen Formen als unverzichtbar herausgestellt. Aus der gemeinsam gelebten praxis pietatis rührt die Möglichkeit der Kommunitäten, als „Gnadenorte“ wirksam zu werden.
Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass kommunitäres Christsein auch mit Risiken verbunden sein kann. Es kann als Hochform evangelischer Spiritualität missverstanden werden, die von einigen wenigen religiösen Virtuosen stellvertretend für andere gelebt wird. Eine solche Interpretation entspricht zwar dem Trend des modernen Lebens mit seinem zunehmenden Spezialistentum, das konsequenterweise auch religiöse Spezialisten verlangt. Sie würde aber einen Rückfall in ein vorreformatorisches Zwei-Stufen-Christsein bedeuten: von Christen erster Klasse, die kommunitär lebten, und von Christen zweiter Klasse, die in Familie, Beruf und Kirchengemeinde verblieben. Auf diese Weise ginge die Ausrichtung reformatorischer Spiritualität auf die Welt und das damit verbundene immer neue Ringen um ihre Alltagsverträglichkeit verloren. Ein weiteres Risiko kommunitären Christseins besteht darin, dass es in Abhängigkeit vom Leiter oder der Leiterin der Gemeinschaft geraten kann. Manche Menschen unterwerfen sich nur zu gerne einem geistlichen Leiter, um dadurch von der Last der Eigenverantwortung für Leben und Glauben frei zu werden. Dadurch würde jedoch die reformatorische Errungenschaft der Freiheit des individuellen Gewissens preisgegeben. Kommunitäres Christsein kann schließlich zu einer Überbetonung der Gemeinschaft führen. Sie wird z.B. am fehlenden Eigenprofil der Spiritualität des einzelnen Kommunitätsmitglieds sichtbar. Der Glaube der Gemeinschaft kann zum Surrogat des eigenen Glaubens werden. Persönliche Zweifel und Meinungsunterschiede werden unterdrückt, um die emotionale Sicherung durch die Gruppe nicht aufs Spiel zu setzen. Im Wissen um diese Gefährdung ist es für jede christliche Gemeinschaft notwendig, ihren Mitgliedern ein möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung, Partizipation und Initiative in Fragen des Glaubens und des gemeinsamen Lebens einzuräumen.
Gerade angesichts dieser Risiken ist es wichtig, Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften, Kirchengemeinden und Landeskirchen bzw. EKD in Zukunft stärker aufeinander zu beziehen, und zwar im Sinne gegenseitiger Ergänzung und Korrektur. Erst wenn Kommunitäten, Kirchengemeinden und Landeskirchen sowohl ihre Gleichwertigkeit und Unterschiedlichkeit als auch ihr bleibendes Aufeinanderangewiesensein erkennen, wird es zu einer echten gegenseitigen Bereicherung kommen.
5. Was Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften konkret zum Leben der Kirche beitragen können – Zehn Thesen
1. Indem sie dem Gottesdienst nichts vorziehen (Benedikt), stärken sie die geistliche Mitte der Kirche.
Das Zentrum kommunitärer Spiritualität bildet die Feier des Gottesdienstes. Kommunitäten wenden sich gegen die „Herabsetzung des liturgischen Gottesdienstes zu einem bloßen Mittel zur Verwirklichung des vernünftigen Gottesdienstes“12. Für die primär an den Früchten des Glaubens orientierte volkskirchliche Spiritualität (diakonisches und sozialethisches Engagement) bildet kommunitäre Spiritualität auch aus diesem Grund ein unverzichtbares Korrektiv.
2. Angesichts der „Selbstsäkularisierung“ des Protestantismus (Wolfgang Huber) helfen sie zur notwendigen Profilierung evangelischen Christseins.
Die in Kommunitäten gelebte verbindliche Spiritualität bildet angesichts der bei der überwiegenden Mehrzahl der evangelischen Kirchenmitglieder zu beobachtenden Unkenntnis und Unverbindlichkeit des Glaubens, die sich z.B. an fehlender Teilnahme am Gottesdienst und dem übrigen Gemeindeleben und an der Unkenntnis der Gebote Gottes zeigt, ein wichtiges Gegengewicht.
3. Kommunitäten zeigen durch die Vielfalt ihrer Erscheinungsformen, dass in der Kirche ein schöpferischer Pluralismus möglich ist, der nicht relativierend und dissoziierend wirken muss.
Beim Vergleich der unterschiedlichen Kommunitäten zeigt sich, dass ihre Spiritualität pluralistisch ist, ohne deshalb in unverbundene Spiritualitäten zu zersplittern. Die unterschiedlichen kommunitären Spiritualitäten besitzen eine gemeinsame Mitte im christozentrisch geprägten Glauben, in der Liebe zur Bibel, in der Hochschätzung des Gottesdienstes einschließlich der Sakramente und in der Ausrichtung auf Gemeinschaft, Kirche und Gesellschaft. Der Pluralismus der kommunitären Spiritualitäten wirkt dadurch bereichernd und nicht dissoziierend.13 Auf diese Weise können Kommunitäten dazu beitragen, in der Gesamtkirche die Bedeutung eines schöpferischen Pluralismus14 zu entdecken – eine auf dem Hintergrund der oft zerstörerischen Flügelkämpfe zwischen den Anhängern verschiedener theologischer Richtungen in der Gesamtkirche und in den Parochialgemeinden besonders dringliche Aufgabe.
4. Kommunitäten stellen einen Schritt auf dem Weg zur praktischen Verwirklichung des allgemeinen Priestertums dar, das durch die Reformation zwar wieder entdeckt, aber nicht praktisch umgesetzt wurde.
Indem die geistlichen Gemeinschaften die Bedeutung der Charismen für den Gemeindeaufbau entdeckt haben, tragen sie zur Überwindung der Konzentration des Charismas auf den Amtsträger bei, die für die Gesamtkirche immer noch typisch ist, und helfen so, die reformatorische Forderung nach dem „Allgemeinen Priestertum“ praktisch umzusetzen.15
5. Kommunitäten lassen erkennen, dass im evangelischen Glauben Individualität und Sozialität untrennbar zusammengehören.
Gegenüber dem gegenwärtig vorherrschenden protestantischen Frömmigkeitstypus, der seit dem 19. Jahrhundert zunehmend von Individualismus, Subjektivismus und Innerlichkeit geprägt wurde, stellt die Neuentdeckung der ekklesiologischen Ausrichtung des Glaubens durch die Kommunitäten ein notwendiges Korrektiv dar. Zinzendorf: „Kein Christentum ohne Gemeinschaft“.
6. Die Ewigkeitsorientierung der Spiritualität von Kommunitäten stellt ein notwendiges Gegengewicht zur Diesseitsverliebtheit der gegenwärtigen volkskirchlichen Frömmigkeit dar.
Die eschatologische Ausrichtung kommunitärer Spiritualität stellt eine unverzichtbare Herausforderung gegenüber einer die volkskirchliche Frömmigkeit dominierenden Diesseitsorientierung dar.
7. Kommunitäten haben durch die Wiederentdeckung von Symbolen und Ritualen die Notwendigkeit der Gestaltwerdung für den Glauben erkannt.
Kommunitäten plädieren für ein Christentum mit Leib und Seele. Die protestantische Phobie vor der Form ist an ihnen gnädig vorübergegangen. Darum wird ihre Spiritualität wesentlich durch Symbole und Rituale geprägt. Die Wiederentdeckung des Symbols wirkt sich bis in der Gestaltung der Wohnräume unter Einbeziehung geistlicher Gesichtspunkte aus: Eine „schöne Ecke“ mit Kruzifix gehört zur Einrichtung vieler Zimmer in Kommunitäten. Die Hochschätzung des Rituals als Glaubenshilfe zeigt sich z.B. in der Praxis der Beichte.
8. Kommunitäten vermitteln durch die Durchführung von Vorträgen, Seminaren, Tagungen und Freizeiten Impulse für die konkrete Gestaltung des spirituellen Lebens.
Die Kommunitäten bieten als „evangelische Gnadenorte“ Besuchern und Besucherinnen die Möglichkeit, geistlich aufzutanken. Diesem Zweck dienen spirituelle Tagungsangebote vonseiten der Kommunitäten und die Einladung, für kürzere oder längere Zeit in den Kommunitäten mitzuleben („Kommunität auf Zeit“). In Kommunitäten erfahren Menschen in einer sonst von Lärm und Leistungsdruck geprägten Gesellschaft innere Entspannung:16 Die von Stundengebeten und Gottesdiensten getragene Spiritualität hilft, zur Stille zu kommen.17
9. Angesichts fortschreitender Entkirchlichungs- und Säkularisierungsprozesse bieten Kommunitäten – gerade für junge Menschen – wichtige Experimentierräume für Glaubenserfahrungen an (FSJ, „Kloster auf Zeit“). 1112





























