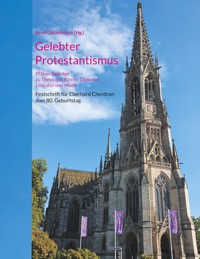
Gelebter Protestantismus E-Book
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gelebter Protestantismus in der und für die Pfalz sowie darüber hinaus: Dieses Thema verbindet das Lebenswerk von Kirchenpräsident i.R. Eberhard Cherdron mit dem Anliegen dieses Buches. 18 Beiträge zu Person und Werk Eberhard Cherdrons, zu Theologie und Kirchengeschichte, zu Diakonie und Seelsorge sowie zu Literatur und Musik sind E. Cherdron als Festschrift zum 80. Geburtstag gewidmet. Als Autorinnen und Autoren wirkten mit Reinhold Ahr, Albrecht Bähr, Klaus Bümlein, Claudia und Hartmut Metzger, Karin Feldner-Westphal, Rolf Freudenberg, Günter Geisthardt, Arnd Götzelmann, Friedhelm Hans, Bernd Höppner, Karin Kessel, Wolfgang Müller, Marita Rödszus-Hecker, Wolfgang Roth, Friedhelm Schneider, Martin Schuck, Gerhard Vidal und Dieter Wittmann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eberhard Cherdron, September 2021, Prot. Auferstehungs- kirche Speyer
Inhalt
Zur Einführung – A
RND
G
ÖTZELMANN
1. Zu Person und Werk
Zu jeder Zeit am richtigen Ort – Ein reformierter Pfälzer und die weite Welt – C
LAUDIA
und H
ARTMUT
M
ETZGER
Das Pfarrhaus als Lebensort – F
RIEDHELM
H
ANS
Eberhard Cherdron – ein Mann des Wohlklangs. Hommage mit spitzer Feder – R
EINHOLD
A
HR
Verzeichnis der Publikationen von Eberhard Cherdron. November 1969 bis Juni 2023 – K
ARIN
F
ELDNER
-W
ESTPHAL
2. Zu Theologie und Kirchengeschichte
Für ein neues Vielleicht – K
LAUS
B
ÜMLEIN
Von der Theologie zur Tiefenpsychologie – „Was dürfen wir denken, hoffen und glauben?“ – D
IETER
W
ITTMANN
Wähle das Leben. Ein anderer Blick auf das Gleichnis vom Verlorenen Sohn (Lukas 15,11-32) – G
ERHARD
V
IDAL
Glaube als Resonanzerfahrung. Eine neue Sichtweise zum Verständnis religiöser Erfahrung – B
ERND
H
ÖPPNER
Was sind eigentlich Staatsleistungen? – K
ARIN
K
ESSEL
„Das Predigterlebnis vom Buß- und Bettag 1938 ist mir unvergeßlich.“ Aus den Erinnerungen des Kaiserslauterer Pfarrers Karl Groß – W
OLFGANG
M
ÜLLER
1977. Theologie und Kirche zwischen Barth, Sozialismus und Liberalismus – M
ARTIN
S
CHUCK
..
3. Zu Diakonie und Seelsorge
Ethik (in) der Unternehmensdiakonie. Fragmentarische Gedanken zu einem strittigen Thema – G
ÜNTER
G
EISTHARDT
„Der Verwaltungsrat soll … die aktuellen Grundsätze des diakonischen Corporate Governance Kodex berücksichtigen.“ Aufsicht und Leitung in Unternehmen der Diakonie – R
OLF
F
REUDENBERG
Gemeinwesendiakonie: Kirche und Diakonie – im Sozialraum verankert – A
LBRECHT
B
ÄHR
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Ein diakonietheologischer Zugang in der Tradition der Hebräischen Bibel – A
RND
G
ÖTZELMANN
Beziehungsreich. Zwölf Perspektiven einer Pastoralpsychologie – W
OLFGANG
R
OTH
4. Zu Literatur und Musik
„Asyl für hoffnungslose Tage“ Tagebuchaufzeichnungen von Franz Kafka, Franziska zu Reventlow und Victor Klemperer – M
ARITA
R
ÖDSZUS
-H
ECKER
„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder?“ Gesungene Kriegskritik im Spannungsfeld von friedensbewegtem Protest und obrigkeitlicher Abwehr – F
RIEDHELM
S
CHNEIDER
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
ARND GÖTZELMANNZur Einführung
„Gelebter Protestantismus“ in der und für die Pfalz sowie darüber hinaus – dieses Thema verbindet das Lebenswerk von Eberhard Cherdron mit dem Anliegen dieses Buches. Ein segensreiches Leben und eine lange Berufsbiografie führten den Pfälzer Pfarrerssohn aus einer Hugenottenfamilie, Eberhard Cherdron, von seinem Theologie- und später Volkswirtschaftsstudium über viele wichtige protestantische Berufsstationen in der Pfälzischen Landeskirche – Gemeindepfarrer in Neuhofen, Landesjugendpfarrrer, Landesdiakoniepfarrer, Oberkirchenrat und Personaldezernent, Kirchenpräsident –, ließ ihn manch bedeutsame Position in Gremien der EKD, des Diakonischen Werkes der EKD etc. besetzen und eröffnete ihm, und das nicht erst im Ruhestand, Optionen, sich, meist mit wissenschaftlichem Anspruch und unermüdlichem Elan, einer breiten Palette von Themen zu widmen. Sie hatten und haben zu tun mit seiner Pfälzischen Heimat, ihrer Kirche und Diakonie in Geschichte und Gegenwart, der Kirchenmusik und Regionalgeschichte sowie biblischen und historischen, dogmatischen und praktisch-theologischen Fachgebieten.
Überblickt man das reichhaltige Verzeichnis seiner Publikationen, das die Bibliothekarin der Pfälzischen Landeskirche, Karin Feldner-Westphal aus Heidelberg, in 193 Titeln recherchiert und geordnet hat, dann wird deutlich: Eberhard Cherdron brannte und brennt für biblische, historische, systematische und kulturell-musikalische Themen, die oftmals einen Bezug zur Pfalz haben.
Es wird also nicht wundern, wenn auch dieser Sammelband, der als Festgabe anlässlich seines 80. Geburtstags am 7. November 2023 zusammengestellt wurde, wie schon die erste ihm zu seinem 65. Geburtstag zugeeignete Festschrift „Impulse und Erträge“1, durch die Auswahl der Mitwirkenden und ihrer Themen etwas mit Person und Werk des Jubilars zu tun haben. Folglich spiegelt die hier vorgenommene systematische Gliederung etwas von seinem Lebensweg und Lebenswerk.
Im ersten Buchteil konzentriert sich alles direkt auf Person und Werk Eberhard Cherdrons. Den Weg des „reformierten Pfälzers“ innerhalb und außerhalb der Pfalz, wie sie ihn in vielen Begegnungen und Reisen erlebt haben, verfolgen die Journalisten CLAUDIA EBERHARD-METZGER und HARTMUT METZGER aus Maikammer. Der Pfarrer im Ruhestand und Schriftleiter des Vereins für Pfälzische Kirchengeschichte, FRIEDHELM HANS aus Landau, überschreibt seinen Beitrag mit „Das Pfarrhaus als Lebensort“ und zeigt – auch anhand von Fotos – die Pfarrhäuser auf, die Eberhard Cherdron geprägt haben, um sie zeitgeschichtlich und sozialräumlich zu kontextualisieren. Eine poetisch-literarische Hommage an den Jubilar mit Erinnerungen an Begegnungen mit ihm und den Gremien der Pfälzischen Landeskirche hat „mit spitzer Feder“ der Ruhestandspfarrer, Psychotherapeut, Arzt und Literat Dr. med. REINHOLD AHR aus Mainz, verfasst. Er empfindet Eberhard Cherdron als „Mann des Wohlklangs“ und widmet ihm etliche Gedichte. Das bereits genannte Publikationsverzeichnis von KARIN FELDNER-WESTPHAL folgt.
Der zweite Teil vereint Beiträge zu Theologie und Kirchengeschichte. Der langjährige theologische Weggefährte – von der theologischen Ausbildung über die Kirchenleitung bis in den Ruhestand – Oberkirchenrat i.R. Dr. theol. KLAUS BÜMLEIN versucht sich an dem Thema der Glaubenspraxis zwischen Gewissheit und Zweifel unter dem spannenden und durchaus Ambivalenz verratenden Titel „Für ein neues Vielleicht“. Es folgt ein Beitrag zum Verhältnis von protestantischer Theologie und Tiefenpsychologie mit exemplarischen autobiographischen Reminiszenzen des Ludwigshafener emeritierten Professors und Rektors der 2008 aufgelösten Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen, Dr. theol. DIETER WITTMANN, der ebenso zum Freundeskreis des Jubilars seit Studienzeiten gehört. Eine neue Perspektive auf das Gleichnis vom Verlorenen Sohn entwickelt der Pfarrer im Ruhestand und theologische wie musikalische Weggefährte des Jubilars, Dr. theol. GERHARD VIDAL aus Neuhofen. Aus dem Resonanzverständnis des Jenaer Soziologen Hartmut Rosa gewinnt der badische Ruhestandspfarrer BERND HÖPPNER, mittlerweile zusammen mit seiner Frau in Speyer wohnhaft, neue Sichtweisen für den christlichen Glauben und die religiöse Erfahrung. Mit der Erhellung der historischen Hintergründe der „Staatsleistungen“ wendet sich die Speyerer Juristin, Oberkirchenrätin KARIN KESSEL, einem ebenso aktuellen wie kontroversen Thema der Kirchenfinanzierung zu. Der Saarbrücker Universitätsarchivar und Schriftführer des Vereins für Pfälzische Kirchengeschichte, Dr. phil. WOLFGANG MÜLLER aus Kaiserslautern, gibt die Buß- und Bettagspredigt des Kaiserslauterer Pfarrers Karl Groß aus dem Jahr 1938 wieder und setzt sie in den Kontext des protestantischen Widerstands im NS-Regime. Der historisch-zeitgeschichtliche Teil dieses Kapitel wird mit einem Beitrag des Schriftleiters des Pfälzischen Pfarrerblatts, Pfarrer Dr. theol. MARTIN SCHUCK aus Speyer, abgeschlossen. Er erinnert sich an den ersten Zeitpunkt der Begegnung mit dem Jubilar im Jahr 1977. Dieses Jahr deutet er im Anschluss an das Buch des Züricher Historikers Philipp Sarasin als eine wichtige, auch kirchlich-theologische Transformationsphase.
Im dritten Teil sind Beiträge zu Diakonie und Seelsorge zusammengeführt. Er setzt ein mit einem Beitrag zur Ethik der und in der unternehmerischen Diakonie, die Pfarrer i.R. Dr. theol. GÜNTER GEISTHARDT aus Landau auf der Basis eigener Praxisreflexion als ehemals Theologischer Vorstand von „Diakonissen Speyer“ thematisiert und kritisch in den aktuellen Fachdiskurs einbettet. Das Verhältnis von Aufsicht und Leitung in diakonischen Unternehmen systematisiert der langjährige theologische Vorstand des Landesvereins für Innere Mission in der Pfalz, Pfarrer i.R. ROLF FREUDENBERG aus Ludwigshafen am Rhein. Dabei erinnert er nicht nur an das Zusammenspiel mit dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Eberhard Cherdron, sondern erhellt das Thema empirisch und gibt Empfehlungen für eine gelingendere Leitungspraxis. Der Pfälzische Landespfarrer für Diakonie und Sprecher der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Diakonie in Rheinland-Pfalz, ALBRECHT BÄHR, nimmt uns hinein in das Thema Gemeinwesendiakonie, das die Diakonischen Werke der Landeskirchen, so auch der Pfalz, seit Jahren konzeptionell beschäftigt. Für die christliche Ethik will mein Beitrag die sozialethischen und diakonietheologischen Traditionen der Hebräischen Bibel, die uns in den Begriffen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geläufig sind, fruchtbar machen und als Ergänzung einer vom Neuen Testament geprägten Ethik aufzeigen. Der Pastoralpsychologe und Pfarrer i.R. WOLFGANG ROTH aus St. Martin wendet sich der Seelsorgelehre zu und eröffnet unter dem Leitbegriff „Beziehungsreich“ zwölf Perspektiven für die Pastoralpsychologie, wie sie für die Kirche hilfreich wäre.
Zu Literatur und Musik findet sich im vierten Teil zunächst der Beitrag von Pfarrerin i.R. MARITA RÖDSZUS-HECKER aus Heidelberg, die als Öffentlichkeitsreferentin der Pfälzischen Landeskirche mit dem Jubilar zusammengearbeitet hatte. Sie geht den Tagebuchaufzeichnungen von Franz Kafka, Franziska zu Reventlow und Victor Klemperer nach. Der frühere Leiter der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Landeskirche, Pfarrer i.R. FRIEDHELM SCHNEIDER aus Speyer, widmet sich dem Thema der gesungenen Kriegskritik im Spannungsfeld von friedensbewegtem Protest und obrigkeitlicher Abwehr anhand ausgewählter Lieder aus verschiedenen Ländern und in drei Sprachen.
Die letzten Seiten des Buches füllt das Verzeichnis der Autorinnen und Autoren. Der am Ende jeder Nennung aufgeführte Ort bezeichnet den aktuellen Wohnort der betr. Person.
Mein Dank gilt allen hier Mitwirkenden, die Eberhard Cherdrons Anliegen eines zeitgemäßen und zugleich traditionsbewussten „gelebten Protestantismus“ fachlich in ihren „Pfälzer Beiträgen“ mit Leben gefüllt haben.
Mein und unser gemeinsamer Dank in dieser „Gemeinschaft der Schreibenden auf Zeit“ gilt dem Jubilar Eberhard Cherdron selbst. Ohne sein in jeder Hinsicht großzügiges Wesen, seine offene Art auf Menschen zuzugehen, sein vielfältiges Engagement, seinen Kenntnisreichtum auf den genannten und vielen anderen Gebieten wäre der Protestantismus, wäre die Pfalz, wären wir alle ärmer. Durch sein Vorbild ist es leichter, den eigenen Protestantismus in gut Pfälzer Manier zu leben und weiterzugeben.
Zugleich gratulieren wir ihm zu seinem achtzigsten Geburtstag und wünschen ihm Gottes Segen, damit er weiterhin gesund und motiviert bleibe, seine liebe Frau Dorothea in ihrer Krankheit zu begleiten und sich seiner Familie, dem Freundeskreis, der christlichen wie weltlichen Gemeinschaft, den Künsten und Wissenschaften so zuzuwenden, wie er es gern möchte und wie es ihm passend erscheint.
Herzlich danke sagen möchte ich außerdem Dieter Wittmann. Wir beide haben unabhängig voneinander und zur selben Zeit im vergangenen Herbst dieselbe Idee zu einer Festschrift entwickelt und ausgetauscht. Von ihm stammen viele Anregungen zu ihr und er beteiligte sich u.a. am Korrekturlesen. Daran haben seine Frau Gerlinde Wittmann, Oberstudienrätin i.R., und meine Frau, Pfarrerin Claudia Enders-Götzelmann, ebenso mitgewirkt, wofür ich ihnen herzlich dankbar bin.
Möge dieses Buch allen Leserinnen und Lesern vielfältige Anregungen geben und einen bescheidenen Eindruck von dem vermitteln, was wir Eberhard Cherdron, dem Achtzigjährigen verdanken.
Arnd Götzelmann
Speyer, im September 2023
1 Vgl. Müller, Gottfried (Hg.) (2008): Impulse und Erträge. Festschrift zum 65. Geburtstag von Kirchenpräsident Eberhard Cherdron, Speyer: Evangelischer Presseverlag Pfalz.
1. Zu Person und Werk
CLAUDIA und HARTMUT METZGER
Zu jeder Zeit am richtigen Ort – Ein reformierter Pfälzer und die weite Welt
Eberhard Cherdron ist ein weltoffener Reisender, zu jeder Zeit am richtigen Ort. Es kommt nicht häufig vor, dass sich die Stationen in langen und ereignisreichen Lebensläufen so glücklich fügen. Und sollten an dieser Stimmigkeit irgendwann einmal leise Zweifel aufgekommen sein, hätte er sicherlich frohgemut festgestellt, dass das hier und jetzt so richtig ist.
1. Bei den reformierten Pfälzern in Braunschweig
Jedenfalls war es richtig, dass Kirchenpräsident Cherdron zur 300-Jahr-Feier der selbstständigen reformierten Gemeinde in Braunschweig reiste. Herzog Anton Ulrich hatte am 8. Mai 1704 den reformierten Pfälzern zur Ansiedlung im Braunschweiger Umland das Privileg erteilt, „ihren Gottesdienst alhir öffentlich und ungehindert anstellen und verrichten“ zu dürfen. 300 Jahre später sollte dieses Jubiläum der damals noch selbstständigen „Evangelisch-reformierten Gemeinde Braunschweig“ groß gefeiert werden. Und da deren ältere Mitglieder im ländlichen Gemeindeteil Veltenhof noch immer pfälzisch sprachen, lud der reformierte Pastor zielsicher den pfälzischen Kirchenpräsidenten ein, der selbstverständlich spontan zusagte.
Bei der Reisevorbereitung stellte sich bald heraus, dass diese „Braunschweiger Pfälzer“ vor 300 Jahren zwar aus den reformierten Gemeinden der damaligen Kurpfalz ausgewandert waren – aber aus den Gemeinden auf der rechtsrheinischen Seite, die heutzutage zur badischen Landeskirche gehören. Daher wäre eine Einladung des badischen Landesbischofs zu Festvortrag und Gottesdienst – rein formal gesehen – schon richtiger gewesen. Aber Eberhard Cherdron hatte auch diesen für die reformierte Festgemeinde misslichen Zustand sofort erkannt und frohgemut beschlossen: „Natürlich fahre ich nach Braunschweig, schließlich kann ich Pfälzisch und der Richtige nicht.“
Auf jeden Fall flogen ihm die Herzen zu, als er diese äußerlichen regionalen Unstimmigkeiten vor der versammelten Festgemeinde erläuterte – angeblich so sehr, dass deren Pastor im Nachhinein einige Mühe hatte, das hohe Gut der Unabhängigkeit seiner Braunschweiger Gemeinde von einer Landeskirche zu verteidigen, obgleich es dort nur einen reformierten Pastor und keinen pfälzischen Kirchenpräsidenten gab. Vielleicht haben diese Erfahrungen der überaus geglückten Jubiläumsfeier auch dazu beigetragen, dass es dem – nicht gänzlich unbeteiligten – „Evangelischen Kirchenboten“ Jahre später gelang, den ehemaligen Kirchenpräsidenten als Reiseleiter zu gewinnen.
2. Auf Rundreise in Jordanien
Diese Reise-Primiz begann am 6. Oktober 2011 und führte für eine Woche nach Jordanien. Der Name „Cherdron“ erwies sich als ausgesprochen werbewirksam, die Reisegruppe zählte zahlreiche Köpfe aller Altersklassen, nicht nur aus dem Verbreitungsgebiet des „Kirchenboten“, sondern auch aus dem des hessen-nassauischen Sonntagsblatts; darunter der Pfarrer einer kleinen hessischen Gemeinde. Er hatte sich der Leserreise nicht ohne Hintergedanken angeschlossen: Auch er wollte seinen Gemeindemitgliedern künftig gemeinschaftliche Reisen anbieten – und sich bei Eberhard Cherdron abschauen, wie man das so macht.
Quirlig ging es zu bei dieser Reise, munter und immer bunter: Tempelbesuch in Jerash, ein Hauch von Orient im Basar von Amman, der weite Blick vom Berg Nebo, ein Spaziergang durch Petra, der rosaroten Stadt aus Stein, Picknick auf tiefrotem Sand und Wüstenfahrt im Wadi Rum, Schwimmen im Toten Meer – allerdings ohne den Reiseleiter: „zu nass, zu salzig, zu sandig, zu heiß“.
Die Reisegruppe schien wie von selbst zu laufen, sie organisierte sich rund um ihn herum ebenso fröhlich wie eigenständig. So blieb die vom hessischen Pfarrer so innig herbeigesehnte „Leitung“ aus. Eberhard Cherdron hatte die autonom-kreative Kraft der Gruppe sofort erkannt – eine Anleitung, so sein Fazit, hätte hier nur gestört. Die seinerzeit von der allgemeinen Reiselust und Reisefreude absorbierte Reiseleitung hat Eberhard Cherdron trotz der begeisterten Belobigungen seiner Reiseteilnehmer gänzlich aufgegeben und nicht wiederholt. Der lernbegierige Pfarrer aus Hessen ist als Reiseleiter allerdings bis heute in aller Herren Länder unterwegs.
3. Mit Gitarre und Gesang in Paris
Eine andere Reise, eine andere Zeit, ein anderer Ort: Leise schaukelte das Schiff in einer lauen Frühlingsnacht auf den Wassern der Seine mitten in Paris. Ein Blick aus dem Fenster zeigte hoch oben, scheinbar frei am Abendhimmel schwebend, eine Uhr. Sie zählte die Stunden bis zum Ende des zweiten Jahrtausends: Es waren nur noch wenige. Im Bauch des Schiffes fast am Fuße des Eifelturms saßen Menschen aus Frankreich, Italien und aus Deutschland beisammen im ernsten Bemühen der babylonischen Sprachenvielfalt Herr zu werden, was dem einen mehr, dem anderen weniger gelang. So manch einer blickte stumm und wie auf himmlische Hilfe hoffend zu der über allem thronenden Uhr.
Da holte Eberhard Cherdron seine Gitarre heraus und stimmte ein Lied an. Bald darauf ließ der Gitarrist auf Zuruf französische, italienische oder deutsche Weisen erklingen. Niemand redete mehr, alle sangen, die meisten ohne jeden Text, aber das machte nichts. So endete einer der letzten Abende im alten Jahrtausend im Sinne des europäischen Gedankens bei völkerverständigenden Gitarrenweisen in musikalisch transformierter Harmonie: Singend sah man zu späterer Stunde überraschende internationale Neugruppierungen unter der unablässig tickenden Milleniums-Uhr des Eifelturms in der blauschwarzen Nacht verschwinden …
4. Am Klavier zuhause in Speyer
Die vereinende Kraft der Musik wusste Eberhard Cherdron schon immer einzusetzen, gerne auch bei seinen Hauskonzerten. Anwerbungen geschehen beispielsweise so: „Du singst doch auch!“, sagt Eberhard. „Ja schon, aber nur so aus Hobby, aus Spaß“, antwortet die Sängerin. „Und Du hast doch auch etwas geschrieben, in einem Jugendbuch, über eine Astronomin aus dem Barock?“ – „Auch das, ja.“ – „Prima. Dann machen wir jetzt etwas zusammen“, beschließt Eberhard. „Ich spiele auf dem Flügel, und Du singst. Bei mir zu Hause, an meinem Geburtstag, irgendwas aus dem Barock. Und anschließend liest Du aus dem Buch. Wird Dir das zu viel?“ – „Ach nein“, sagt die Sängerin.
Bald sind zwei passende Lieder gefunden, das eine ist von Henry Purcell, das andere von Giacomo Carissimi. Es trägt den Titel „Vittoria!“. Die Lieder sind nicht einfach – für die Sängerin. Besonders die kleine Koloratur in „Vittoria!“, die macht der Sängerin Angst. Der Pianist greift bei jeder Probe souverän in die Tasten. Weil die Sängerin aber nur eine Hobbysängerin ist, fliegt sie bei der von ihr gefürchteten Koloraturstelle trotz aller Hilfen und Mühen ständig raus. „Das macht nichts“, befindet der Pianist schließlich. „Wenn das passiert, dann lachst Du einfach!“. Der Tag der Aufführung ist da, viele Gäste sind geladen, der Pianist spielt, die Sängerin singt, die Koloraturstelle kommt – die Sängerin lacht …
5. Vor Landessynode und Kirchengericht
Eberhard Cherdron hingegen hatte – berufsbedingt und unverschuldet – nicht allzu viel zu lachen bei dem wohl letzten großen Thema der 1818 gegründeten „Vereinigten protestantisch-evangelisch-christlichen Kirche der Pfalz“. „Hohe Synode, wenn ich ehrlich sein soll, dann würde ich jetzt lieber weiter mit Ihnen singen“, sagte er 1994 vor der pfälzischen Landessynode bei seiner inhaltlichen Einführung in den Namensstreit der Gemeinden. Damals war er noch Oberkirchenrat, und seine lieben Kollegen hatten ihn selbstlos mit der Vertretung der Landeskirche in dieser über lange Jahre hinweg die Gemüter erregenden Frage bedacht: Sind wir jetzt evangelisch oder protestantisch?
An zahlreichen Wochenenden traf man ihn damals, Anfang der 1990er Jahre, vor dem kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsgericht, vor dem „evangelische“ Gemeinden dagegen klagten, dass sie sich künftig wieder protestantisch nennen sollen. Für Journalisten war das eine schöne Zeit. Nur ihm hat die stets gleiche und betont sachliche Begrüßung des vorsitzenden Richters offensichtlich nicht gefallen: Oberkirchenrat Eberhard Cherdron als Vertreter der beklagten „Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)“. Seit einem hochoffiziellen Beschluss der Landessynode müssen sich nun alle Kirchengemeinden der pfälzischen Landeskirche wieder protestantisch nennen. So steht es jedenfalls in der Kirchenverfassung. Gut, dass sich alle daran halten …
6. Im Rotary Club Speyer für die Frauen
In anderen Glaubensfragen stand Eberhard Cherdron hingegen an vorderster Front der Reformer: etwa in der Frage, ob der traditionsreiche Rotary Club Speyer Frauen aufnimmt oder nicht. Nach langen Jahren tiefschürfender Debatten überzeugte die rotarische Präsidentschaft des soeben erst in den Ruhestand getretenen Kirchenpräsidenten die rund 60 Mitglieder des Speyerer Clubs, dass die Aufnahme von Frauen hier und jetzt so richtig ist. Cherdron wählte allerdings eine so charmante und diplomatische Aufnahmetechnik, dass keiner zu widersprechen wagte. Tatsächlich wurde diese Verfahrensweise „nach Cherdron“ bereits in benachbarten Rotary Clubs erfolgreich kopiert.
Eberhard Cherdron schlug einfach die auch beruflich gestandene Ehefrau eines verstorbenen Freundes zur Aufnahme vor. Gegen sie konnte kein Mitglied Einspruch erheben, womit sich der Rotary Club Speyer mit diesem Ja-Wort für die Aufnahme von Frauen entschieden hatte. Dass Cherdrons Nachfolger im Amt des Präsidenten in seinem rotarischen Jahr dann gleich vier Frauen aufnehmen konnte, hielten allerdings nicht alle Mitglieder des Speyerer Clubs für schieren Zufall.
7. Unterwegs als freier Redner ohne Manuskript
Kein Zufall war es hingegen, dass Eberhard Cherdron als Kirchenpräsident, der die pfälzische Landeskirche mit der Kraft des Wortes in der Öffentlichkeit vertritt, sein Pressereferat durch den vollständigen Verzicht auf Redemanuskripte schier zur Verzweiflung brachte. Ein gestandener epd-Redakteur bezeichnete ihn beim Abschied aus dem Amt als Antityp des deutschen Redners, dem ja nachgesagt werde, er trenne sich leichter von seiner Frau als von seinem Redemanuskript.
Und so war es durchaus ein Höhepunkt im Berufsleben seiner Pressereferentin, als sie auf einer denkwürdigen Pressekonferenz zu einem besonders wichtigen Anlass stolz verkünden konnte: Der Kirchenpräsident werde eine Rede halten, und sie – die Pressereferentin – habe den Schriftsatz des noch nicht Gesagten. Eberhard Cherdron kommentierte diese Vorfreude mit den Worten: Sie könne dieses Manuskript gerne verteilen, ob er sich aber daran halte, sei völlig offen.
Eine Redakteurin fasste die Verblüffung der anwesenden Journalisten in die Worte: Was denn geschehe, wenn sie aus dem Manuskript zitiere, der Kirchenpräsident jedoch etwas völlig anderes sage. Die Antwort Cherdrons wurde in kirchlichen Journalistenkreisen bald zu einem geflügelten Wort: „Nichts. Ich dementiere nie.“
Angesichts dieses eklatanten Mangels an abheftbaren Redemanuskripten sann die gute Seele des kirchenpräsidentlichen Büros recht bald auf Abhilfe. Sie gab dem Präsidenten, immer wenn er eine Kanzel besteigen durfte, ein kleines Aufnahmegerät mit, das sie später in die Lage versetzen sollte, das von ihm Gesagte abzutippen. Und so geschah es auch einige Male. Eberhard Cherdron bestieg – mit seinen drei Stichworten im Kopf oder bestenfalls auf einem kleinen Zettel notiert – die Kanzel, stellte das kleine Aufnahmegerät vor sich, predigte seiner Gemeinde und ging. Nachdem bei diesem wundersamen Geschehen das dritte Aufnahmegerät verschwunden war, stellte das Sekretariat auch diese Abhörversuche ein und fand sich mit den fehlenden Redemanuskripten ab.
Als Redner und Prediger hielt sich Eberhard Cherdron nie an das geschriebene Wort. Er nahm seine Gemeinde wahr, und die Worte folgten ihm. Auch in konfliktgeladenen Situationen konnte er frei, treffsicher und schnörkellos grundlegende Dinge auf den Punkt bringen, ohne zu verletzen. So sagte er in der Frage der gottesdienstlichen Begleitung homosexueller Paare 2002 vor der Landessynode: „Wenn Sie ein Loch in den Boden graben, dann ist es nur natürlich, dass es nach unten zu immer enger wird. Manche Menschen lesen nun so in der Bibel, wie sie ein Loch in die Erde graben.“
8. Für die Landeskirchen und ihre evangelische Publizistik
Als Kirchenpräsident und Vorsitzender des erfolgreichen Evangelischen Presseverbandes in der Pfalz wurde Eberhard Cherdron auch bald zu einem Reisenden an den konfliktreichen Zonen der evangelischen Medienpolitik. Während seiner zehnjährigen Amtszeit stieg die Auflage des „Evangelischen Kirchenboten“ deutlich an: Das pfälzische Sonntagsblatt hatte die höchste Haushaltsabdeckung im Vergleich aller Landeskirchen in der EKD. Zudem entstand aus dem alten epd-Pfalz die epd-Mitte GmbH mit Sitz in Speyer, welche die bisherigen epd-Träger Pfalz, Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck bis Ende des Jahres 2022 unter einem Dach vereinte.
Daher bemerkte der Kirchenpräsident auch recht bald, dass es in vielen Landeskirchen um die evangelische Publizistik schlechter bestellt war als in der Pfalz, dass sie oft recht unbeliebt und (vielleicht gerade deshalb) auch recht teuer war. Und so meldete er sich im Januar 2003 erstmals pointiert zu Wort, als die rheinische Landessynode beschloss, ihre evangelische Wochenzeitung „Der Weg“ zum Ende des Jahres einzustellen – eine Stellungnahme, die in der west- und in der ostdeutschen Presse mit großem Interesse wahrgenommen und weit verbreitet wurde.
Cherdron unterstrich damals in einer von der Nachrichtenagentur „Evangelischer Pressedienst (epd)“ verbreiteten Meldung, dass das Aufgeben evangelischer Sonntagsblätter für die Landeskirchen einen „erheblichen Verlust an wöchentlicher Information und Meinungsbildung“ bedeute und Kirche „an journalistischer Professionalität und redaktioneller Unabhängigkeit interessiert sein“ müsse. In den Redaktionen evangelischer Wochenzeitungen seien Menschen am Werk, die „ihr Handwerk verstehen, ohne dass es zur Gefälligkeitsschreibe kommt, was in landeskirchlich verantworteten Mitteilungsblättern leicht geschehen kann“. Die evangelische Publizistik könne die Gemeinden in weit größerem Umfang über die Meinungsbildung in den Landeskirchen und in der EKD informieren als Tageszeitung, Rundfunk und Fernsehen.
Und Cherdron machte deutlich, dass er es ernst meint mit der Unterscheidung zwischen Publizistik und Öffentlichkeitsarbeit: Kirchliche Mitteilungen könnten diese Aufgabe der Information und Meinungsbildung nicht übernehmen und kosteten zudem viel Geld. Sie seien an die Interessenlage der jeweiligen Landeskirche gebunden und schon durch ihre Erscheinungshäufigkeit nicht in der Lage, die Breite des Themenangebots und der Berichterstattung unabhängiger Wochenblätter zu gewährleisten. „Ich hielte es für absolut fatal, wenn man meinte, man könnte das eine durch das andere ersetzen“, sagte er.
Wenn der „Kirchenbote“ Informationen bereitstelle, die die Gemeindemitglieder interessieren und ihnen eine eigene Meinungsbildung ermöglichen, dann „liegt das im Interesse unserer Landeskirche“, sagte Cherdon. Die Wochenzeitung sei für die Identität der Landeskirche unverzichtbar. Die Kirche müsse daher sorgsam darauf achten, dass die Bedingungen stimmen, damit sich die Blätter halten können. „Das Monatsmagazin Chrismon halte ich für gut“, sagte Cherdron im Januar 2003, „aber für absolut ungeeignet, diese Aufgaben zu übernehmen“.
Auch den schon damals verbreiteten Fusionsgedanken erteilte Cherdron eine eindeutige Absage. Zusammenschlüsse von Wochenzeitungen mit gemeinsamen überregionalen Teilen hätten seiner Ansicht nach keine Zukunft: „Ich glaube nicht, dass man in Bielefeld oder Hamburg darüber entscheiden kann, was unsere Leser lesen wollen.“
In den medienpolitischen Auseinandersetzungen seiner Zeit als Kirchenpräsident verliefen die Interessenkonflikte meist zwischen Landeskirchen und Kirchenamt der EKD. Als Moderator auf Bundesebene übernahm Eberhard Cherdon Verantwortung an vorderster Front – aber er ließ sich nicht kaufen. Er war sich immer auch seiner Verantwortung gegenüber seiner eigenen Landeskirche bewusst. Er konnte Adressaten- und Absenderorientierung auseinanderhalten, durchschaute die Gemengelage und machte es sich nicht bequem. Dabei ging es nicht nur lustig zu. So musste er sich auf einer der vielen Sitzungen von interessierter Seite den Vorwurf anhören: „Die Pfalz mauert.“
Es ist nicht überliefert, ob er über die spontane Antwort eines pfälzischen Redakteurs innerlich schmunzelte: „Herr Sowieso (Name von der Redaktion geändert), Sie kommen mir vor wie der Betrunkene, der um die Litfaßsäule läuft und laut schreit: Hilfe, ich bin eingemauert!“ Und so ist auch nicht bekannt, wo er als weltoffener Reisender den medienpolitischen Sachverstand der heutigen pfälzischen Kirchenleitung verortet: noch außerhalb oder gar schon innerhalb einer dunklen Litfaßsäule, in der man sich zwar mitten im Geschehen wähnt, aber keine nach draußen sichtbaren Plakate mehr kleben kann. Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Publizistik war Eberhard Cherdron also zu jeder Zeit am richtigen Ort. Ob das aber hier und jetzt so richtig ist?
FRIEDHELM HANSDas Pfarrhaus als Lebensort
Die Literatur zum und aus dem Pfarrhaus ist unübersehbar. Schriftstellerinnen sind aus dem Pfarrhaus hervorgegangen und Schriftsteller. Dazu gehören Ina Seidel (1885-1974), um nur einen bekannten Namen zu nennen, oder Heinrich Wolfgang Seidel (1876-1945), Inas Ehemann, der seine Vikarszeit in einem brandenburgischen Pfarrhaus in Boitzenburg literarisch thematisiert hat.2 Theologen und Soziologen haben das Pfarrhaus in alle Richtungen untersucht, manche haben es verklärt, andere gehasst.3 Viele seiner Bewohner haben es offen gehalten, andere sahen sich darin eingesperrt. Karl Barth (1886-1968) hat bemerkt, dass Dorfbewohner dieses besondere Haus nur dann betreten haben, wenn sie offenkundigen Grund dafür hatten.4 Die Ambivalenz des protestantischen Pfarrhauses behandelte am 11. Februar 2012 eine Tagung zum Thema in Karlsruhe: Das Pfarrhaus zwischen Bildungsinstitution und Leerstand.5 Der pfälzische Pfarrer Hans Hermann Risch (1903-1985) hat in einem frühen Turmhahnheft einen beachtlichen Beitrag über das Pfarrhaus verfasst. Risch entstammte einer pfälzischen Pfarrerdynastie. Somit wusste er, wovon er sprach und worüber er schrieb.
Aus der Arbeit von Risch möchte ich eine bemerkenswerte Beobachtung aufgreifen: „In düsteren Zeiten ist das Pfarrhaus oft der einzige Ort, an dem man sich frei aussprechen kann, noch nicht einmal Kirche und Gottesdienst bieten hierfür den Raum.“6 Risch folgert aus dieser Erfahrung, dass das Pfarrhaus wegen seiner Diskretion unter Umständen das wichtigste kirchliche Gebäude im Ort sei, wichtiger noch als die Kirche. In der Kirche ist Beobachtung möglich, während das Pfarrhaus Freiheit und relativen Schutz selbst in düsterster Zeit bietet. Wir kennen das Problem sowohl aus dem Dritten Reich wie aus dem SED-Staat mit seiner Bespitzelung, Telefonabhör und am schlimmsten wegen der Diskrimination zahlreicher Pfarrerskinder. Das Pfarrhaus war eine der Keimzellen des demokratischen Umbruchs im Jahre 1989. Günter Bezzenberger und Günther Wegener griffen für ihr populäres Pfarrhausbüchlein ein bekanntes Bonmot auf: „Im Pfarrhaus brennt noch Licht.“7 In diesem Wort steckt viel Wahrheit. Das Pfarrhaus kann ich unangemeldet noch zu später Stunde betreten. Der Pfarrer arbeitet an seiner Predigt bis tief in die Nacht. Sein Haus aber steht für das Leben, Willkommenskultur, Schutz und Asyl. Wir könnten weitere Attribute hinzufügen.
Bleiben wir beim pfälzischen Pfarrhaus. Es genügt, auf das Beispiel des Pfarrers Hans Hermann Risch zu verweisen. Bei Risch und seiner Familie mag sogar manche Einzelheit an die Pfarrerfamilie Cherdron und ihre Vorfahren erinnern. Risch geht in seinem Rückblick vom Pfarrhaus in Ulmet aus. Dort war er vom 15. Januar 1931 bis zum Einzug in die Wehrmacht am 10. September 1944 Pfarrer; nach seiner Rückkehr aus amerikanischtschechischer Kriegsgefangenschaft, zeitweise war Risch Lagerpfarrer in Brünn-Jundrow, kehrte er am 10. August 1946 nach Ulmet zurück. Etwas mehr als drei Jahre danach zog es ihn nach Kaiserslautern; am 15. Januar 1950 wurde Hans Hermann Risch zum Pfarrer der Pfarrei Kaiserslautern IV (Lutherkirche 1) ernannt.
Im genannten Turmhahnheft hat sich Risch mit der Geschichte des Pfarrhauses in Ulmet befasst: Ein gewissenhafter Kaplan namens Anton Preuel († 20.11.1566) tritt zur Reformation über und vertritt bei einer Kirchenvisitation einen eigenständigen und theologisch durchdachten Standpunkt. Das 1595 errichtete Pfarrhaus geht beim Kroatensturm 1635 in Flammen auf. Ein Bauernhaus muss das Pfarrhaus ersetzen, bis dieses seinerseits in den Reunionskriegen ein Raub der Flammen wird. Pfarrer Johann Philipp Culmann (17151791) baut es wieder auf. Erst 1783 entsteht ein kircheneigenes Pfarrhaus mit bäuerlichen Nebengebäuden „im französischen Stil“ (Barock). Philipp Collin (1746-1824), ein Hugenottenspross, erlebt die Eroberung durch die Französische Revolution. Es folgen geistlich dürftige Jahre. Das Pfarrhaus steht anfangs in starker Abhängigkeit von der bürgerlichen Gemeinde. Neigt ein Pfarrer einer Partei im Dorfe zu, erntet er das Misstrauen der anderen. Der nächste wahrt den Abstand und versteht sich auf der Volksbildung. Er gründet eine Bücherei, verlegt die Taufe in den Außenorten vom Amtszimmer in die Häuser und macht sein Haus zur festen Burg. Der Übernächste betreibt fleißig Schulunterricht und setzt seine Kraft für die Vereinsarbeit und die Schwesternstation ein. Er sammelt die Jugend. Das Zeitalter der Pfarrfrau bricht an. In der Nachbarpfarrei sorgt der Pfarrer für Arbeit im Steinbruch – die Steine wandern zum Bau des Reichtagsgebäudes bis nach Berlin. In diesem Ort Mühlbach erbaut die Dorfgemeinde während der Weltwirtschaftskrise trotz der schlechten Zeit ihr Kirchlein am Berge. Die Einwohner gelten erst als Kommunisten, 1934 erhält die neue Kirche aber eine dem Reichskanzler Adolf Hitler geweihte Glocke mit Hakenkreuz. Diese Glocke ist – soll man sagen: Zum Glück? – im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen worden. Für mich entscheidend: Die Mühlbacher ordnen ihren christlichen Sinn weder den linken noch den rechten Parolen unter. Hauptsache, ihre Kirche wird gebaut, geweiht und gepflegt.8
Das Pfarrhaus in Ulmet nimmt in Rischs eigener Zeit 1939 Flüchtlinge von der Saar und später aus den Ostgebieten auf. Es sieht deutsche und amerikanische Truppen durchziehen und bietet einsamen Christen und Pfarrersoldaten samt ihren Frauen Zuflucht. Für Hans Hermann Risch war das Pfarrhaus ein Zufluchtsort. Er beschreibt ein Beispiel aus dem elterlichen Pfarrhaus, das sich ihm wegen seiner historischen Dimension ins Gedächtnis eingebrannt hat. 1932 betritt ein mittelloser Bruder von Georg Elser (1903-1945)9 das Pfarrhaus der Eltern in Landau. Der mittellose Ludwig Elser will nach Diemerstein reisen und bittet um das Fahrgeld. Durchwandererhilfe und Hilfe für Verfolgte berühren sich.
Eberhard Cherdron entstammt einem pfälzischen Pfarrhaus, wenn auch keiner Pfarrerdynastie. Die Familie ist hugenottischer Abstammung und siedelt zuerst im pfälzischen Otterberg bei Kaiserslautern.10 In Haßloch brachten es der Großvater Postmeister Philipp Cherdron (* Otterberg 1.10.1869, † Haßloch 2.10.1948) und seine Ehefrau Karoline Hacker (* Kreuzle bei Maienfels 26.9.1876, † Haßloch 12.2.1942) zu einigem Ansehen. Für Philipp Cherdron war Bildung eine Lebensaufgabe; eine Tante Eberhards wurde eine nicht weniger angesehene Lehrerin. Vater Friedrich genannt Fritz Cherdron kam am 7. September 1910 in Haßloch zur Welt und starb am 5. Mai 1991. Friedrich Cherdron studierte von 1930 bis 1934 Theologie in Tübingen, Berlin und Erlangen. 1934 trat er in den pfälzischen Kirchendienst ein und bestand im Jahre 1937 das Zweite Theologische Examen in Speyer. Im gleichen Jahr finden wir Fritz Cherdron in Ludwigshafen als einen der Unterzeichner eines Rundschreibens „Erklärung und Aufruf!“ vom Ostersonntag, dem 18. März 1937. Damit befindet sich der junge Vikar mitten im Kirchenkampf.
Im Aufruf heißt es:
„Aus Verantwortung vor Gott und unseren Gemeinden geben wir unterzeichneten Ludwigshafener Pfarrer, Religionslehrer und Katechetinnen folgende Erklärung ab:
1. wir stehen unbeirrt zur Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes und zur Kirche der Reformation.
2. wir sehen den aus dem Lager des ‚Bundes für deutsches Christentum‘ (Thüringer deutsche Christen) kommenden Versuch, auf nicht biblischer Grundlage eine Nationalkirche zu bilden, als Verrat am Evangelium an und lehnen ihn mit aller Entschiedenheit ab.
3. In einer Zeit, in welcher es um Sein oder Nichtsein auch unserer pfälzischen Unionskirche geht, erinnern wir unsere Gemeindeglieder mit Eindringlichkeit an ihr Konfirmationsgelübde vor dem Altar. Wir bitten sie: Lasst uns in unserem Abwehrkampf nicht allein! Steht in dieser Zeit des Ringens um die Grundlage unserer Kirche mit besonderer Treue zu Euren Pfarrern! Gebt unserer Kirche das, was wir nach Frage 47 unseres Katechismus11 ihr schulden. Wenn Geistliche und Laien furchtlos das Erbe der Väter verteidigen, wird die heutige Verwirrung der Geister bald das Ende nehmen, das sie verdient: dann kann der Herr der Kirche ihr nahe sein mit seinem Erbarmen.
Vertrauensvoll legen die Unterzeichneten das Schicksal unseres Volkes sowohl, wie unserer deutschen evangelischen Kirche in seine gnädige Hand.
Ludwigshafen a/Rh., Ostersonntag, 28.3.37.gez. Bergmann12, Ferckel E.13, Ferckel L., Fuchs, Gauch, Knecht, Kreiselmeier, Rupp, Ebert14, Engel15, Gotthold, Schneider, Cherdron, Ebrecht, Lafrenz, Schlarb, Werron, Glasser, Holzäpfel.
Vorstehender Aufruf wurde von der Ludwigshafener Geistlichkeit in den Ostergottesdiensten von den Kanzeln verlesen. Vielleicht ist er auch für Ihre Gemeinde von Bedeutung.“16
Das Ereignis hat Richard Bergmann in seinen Lebenserinnerungen dokumentiert: „In Ludwigshafen wurde sie eröffnet mit einer Versammlung der Nationalkirche im Gesellschaftshaus. Es folgte am Abend des 17.3.1937 eine große Kundgebung der zu einer Einheitsfront zusammengeschlossenen Ludwigshafener Pfarrer in der Lutherkirche. Was ich an diesem Abend in Ludwigshafen erlebt habe, gehört zum Ergreifendsten in meinem ganzen Leben und wird mir unvergessen bleiben, solange ich lebe. Die Stadt war in Bewegung gekommen. Von allen Seiten strömten die Menschen herbei. 5.000 Menschen füllten die Kirche bis zum letzten Platz. Auch die Säle im Lutherheim und Gemeindehaus waren überfüllt. Ungezählte fanden nirgends Platz und es musste um 10 Uhr ein zweiter Gottesdienst stattfinden. Im zweiten Band meiner Documenta sind zwei Berichte über diese Großkundgebung enthalten. Die Geistlichen (Pfarrer, Vikare, Religionslehrer) mit Ausnahme des Dekans versammelten sich am 17.3.1937 bei mir im Pfarrhaus und wir zogen im Talar in die Kirche ein. Um den Altar herum versammelten wir uns und jeder legte mit einem Bibelwort ein Bekenntnis ab. Es sprachen Knecht, Bergmann, Fuchs und im zweiten Gottesdienst außer mir auch noch Stempel. Eine ehemalige Schülerin von mir (Hilde Wahl) hat einen in Doc. II, 569 abgedruckten Bericht über diese Kundgebung geschrieben, dessen Schluss lautet: ‚Mir wird diese erhebende Feierstunde, die mitten an einem Werktag in der Woche gewesen ist, ein unvergessliches Geschehen in unserer evang(elisch) prot(estantischen) Kirche bleiben.‘ Was sie geschrieben, war das Urteil vieler, die diesen Abend miterlebt haben. Ein Kaplan hat an der Feier teilgenommen und Prälat Walzer berichtet, wie tief beeindruckt er von der Feier gewesen sei.“17
Die Stationen des Vikars Friedrich Cherdron waren Ludwigshafen-Friesenheim und als Verweser in Schönau bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, als der Ort innerhalb der sog. Roten Zone geräumt werden musste. Daher ging es von 1943 bis 1945 nach Hinzweiler. Gleich nach dem Krieg, am 1. Juli 1945, hat der Landeskirchenrat Fritz Cherdron als Verweser in Kandel eingesetzt. Fritz Cherdron war in dem Städtchen einer von vielen Aushilfsgeistlichen an der Seite des Ortspfarrers Karl Ludwig Theodor Steitz (1898-1963, in Kandel Pfarrer bis 1948), die schon vor dem Zweiten Weltkrieg oft nur für kurze Zeit in Kandel eingesetzt waren.
Am 1. Mai 1946 erfolgte die Versetzung nach Niederhochstadt. Hier, auf seiner ersten Pfarrstelle, folgte er dem verstorbenen Pfarrer Eugen Héraucourt (Gommersheim 17.6. 1878 – Heidelberg 13.5.1940). Héraucourts Tochter Gertrud (Biedesheim 19.6.1916, † 2.12.2013) heiratete den Pfarrer Theo Fehn aus Speyer (1910-1984), später Glockensachverständiger der Pfälzischen Landeskirche.18 Das alte Pfarrhaus, in dem Eberhard Cherdron aufgewachsen ist, war 1967 bei der Drucklegung von Wolfgang Egers Handbuch der Pfälzischen Landeskirche19 bereits verkauft. Der vorletzte Pfarrer, der darin gewohnt hat, war Fritz Cherdrons Nachfolger, Gottfried Eichler (1925-2010, in Hochstadt 1958-1964). Eichlers Nachfolger Hardo Lünenbürger (1935-1987) bezog das alte Hochstadter Pfarrhaus vermutlich nicht mehr, bezog aber das neue mit Baujahr 1969.20
Am 16. April 1958 zog Fritz Cherdron mit seiner Familie wiederum nach Kandel, diesmal als Pfarrer. Seine Vorgänger waren von 1947 bis 1949 der vormalige Pfarrer in Sarajewo Karl Michael Hamm (1906-1976) und von 1949 bis 1957 Pfarrer Georg Oswald Damian (1889-1978)21. In der Vakanz kam zuerst der Vikar Erich Blinn (geb. 1943) aus Miesau zum Einsatz. Die Krankenhausseelsorge war dem Ruhestandspfarrer Friedrich Gottlob Laukenmann (1900-?) übertragen. Ins noch nicht ganz fertige Pfarrhaus in der Schillerstraße 10 zog Ernst Ludwig Spitzner mit seiner Familie am 13. Mai 1970 ein.22
In den Ruhestand trat der Vater zum 1. Mai 1968. Leben auf Zeit im Pfarrhaus ist so ein eigenes Pfarrhausthema, das ein Menschenleben prägt. Aus der am 23. September 1937 in Ludwigshafen geschlossenen Ehe mit Gertrud Stumpf (* Ludwigshafen 6. Juli 1914, † 25.8.1994) entsprangen insgesamt vier Kinder.23
Die Pfarrhäuser
1. Niederhochstadt. Die ortsgeschichtliche Literatur zu Niederhochstadt beschreibt wohl den langwierigen Wiederaufbau der Kirche unter den Pfarrern Georg Keßler und Wilhelm Hermanni, geht aber nirgends auf den Bau des Pfarrhauses von 1740 ein.24 Bei einer Visitation am 24. Oktober 1954 schloss sich nach dem Gottesdienst im Pfarrhaus eine Gemeindeversammlung an.25 1968 wurde das Pfarrhaus von 1740 verkauft, ein Neubau vorgesehen26; das neue Pfarrhaus in der Hauptstraße 119 steht seit 1968.27
Das alte Pfarrhaus in Hochstadt von 1740, Aufnahme von Friedhelm Hans. Für Hinweise danke ich Frau Else Heim in Hochstadt.
2. Kandel. Die Nachkriegsjahre waren für die Besitzverhältnisse in gleich vier Kirchen turbulent. Das Bistum Speyer setzte seine unter den Bischöfen Konrad von Busch (18471910) und Michael von Faulhaber (1869-1952) bereits seit der Jahrhundertwende betriebene Politik der Aufhebung der Simultaneen fort. Was die Gemeinschaft Guttenberg anging, stand die Aufteilung von gleich vier Simultankirchen in Billigheim, Kandel, Rechtenbach und Schweigen zur Disposition. Jedes Mal hat die Landeskirche die alten, zum Teil mittelalterlichen Kirchen erworben, während die Katholiken anschließend neue eigene Kirchenbauten errichtet haben. Für Kandel und die Landeskirche verhandelten die Oberkirchenräte Willi Hussong (1903-1981) und Dr. Christian Roßkopf (1930-2020) mit dem Bistum. Für Kandel einigte man sich auf eine Ablösesumme von 400.000 DM.28
In die kirchlichen Akten der Gemeinde Kandel muss man sich erst genau einlesen, denn die Gemeinde verfügte über zwei Pfarrhäuser, wobei das zweite vormals die Wohnung des Vikars war. Dieses Pfarrhaus „Am Plätzel“ war der Kirchengemeinde im Jahre 1956 dank des Stadtbürgermeisters und Presbyters Oskar Böhm (1916-2001) wieder rückübertragen worden, nachdem die Nationalsozialisten während des Dritten Reiches eine Abtretung erzwungen hatten. Unter Pfarrer Joachim Kreiter als Verweser wurde es 1957 zum Kindergarten umgebaut und renoviert.29 Im Jahre 2013 wurde der Kindergarten baupolizeilich geschlossen und verkauft; der Käufer starb aber schon ein halbes Jahr darauf. Seither ist das Haus ungenutzt und seine Zukunft ungewiss.30
Das Pfarrhaus 1, wie wir es hier nennen wollen, hat das Baujahr 1829 und stand in der Marktstraße 35. Es war mit einer Warmwasseretagenheizung und Einzelöfen ausgestattet, besaß aber keine Garage.31 Das Pfarrhaus war nicht Eigentum der Kirchengemeinde, sondern befand sich im Eigentum der Protestantischen Kirchenschaffnei Guttenberg. Den Unterhalt bzw. die Reparaturen trug die Schaffnei meist unter Beteiligung der Kirchengemeinde. Noch vor dem Einzug der Pfarrfamilie Cherdron stand eine Renovierung an; es blieb aber bei einem Herd und Einzelöfen zur Beheizung. Fritz Cherdron ging im Jahresbericht für 1958 auf die Nebengebäude ein. Viele alte Pfarrhöfe besaßen Nebengebäude mit Stallungen, Scheune und Remise sowie Wohnraum für das Gesinde. Das Scheunendach in Kandel war schlecht und schadhaft, es wurde ausgebessert.
Das alte Pfarrhaus in Kandel von 1829 in der Marktstraße 35, eingeschossiger siebenachsiger Halbwalmdachbau, Aufnahme von Friedhelm Hans
Das alte Kandeler Pfarrhaus von der Schillerstraße aus gesehen mit seinem charakteristichen Erkertürmchen, Aufnahme von Friedhelm Hans
Ausführlich dokumentiert ist die Visitation vom 29. November 1959. Nach dem Gottesdienst versammeln sich Kommission und Pfarrer zum gemeinsamen Mittagessen im Pfarrhaus. Anschließend findet dort eine Sitzung des Presbyteriums und ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen mit den Presbytern und ihren Frauen statt. Anwesend sind Stadtbürgermeister Oskar Böhm und Stadtoberinspektor Maupais, der Kirchenrechner der Gemeinde. Der Visitator und Dekan Karl Reich (1911-2000) weilte im Anschluss bei Vikar Gottfried Capelle (1925-2008) und seiner Frau.
Laut Jahresbericht 1960 mussten erneut Schäden an den Nebengebäuden behoben werden; bereits 1958 fielen u.a. umfangreiche Erneuerung von Türen und Fenstern an. 1965 wurden einige Zimmer instandgesetzt.32 Fritz Cherdron schreibt im Jahresbericht: „Ein Haus, das bewohnt ist, instandzuhalten ist eine zermürbende Arbeit.“
Als Fritz Cherdron 1968 in den Ruhestand trat, stellte sich die Frage nach einer umfassenden Instandsetzung oder einem Neubau. Nach dem Jahresbericht für 1969 beschloss das Presbyterium, das Pfarrhaus Marktstraße 35 zu verkaufen, um einen Neubau in der Schillerstraße zu errichten. Den Auftrag dafür erteilte man an eine Fertigungsgesellschaft Stuttgart.33
Erster Bewohner war Pfarrer Ernst Ludwig Spitzner (1940-?). Spitzner war 1968 zuerst hauptamtlicher Verwalter der Pfarrstelle Kandel, ehe er im Jahre 1974 nach Karlsruhe zur Erwachsenenbildung wechselte und schließlich von 1983 bis 2000 Vorsteher des Elisabethenstifts in Darmstadt wurde. Das Pfarrhaus mit Baujahr 1970 wurde 1983 renoviert.34
Ins alte Pfarrhaus zog die Familie des Ruhestandpfarrers Damian ein, der bis 1957 Ortspfarrer in Kandel war. Schließlich verkaufte die Kirchengemeinde das Pfarrhaus an Familie Damian.35
Es gelangte anschließend in den Besitz der Pfarrfamilie Wolfgang Koschut (1943-2022), der zuvor ebenfalls Pfarrer in Kandel war.
3. Neuhofen. Das Neuhofener Pfarrhaus Kirchgäßl 1 wurde 1853 errichtet. Es umfasst eine Fläche von 160 qm und verfügt mit Stand von 1961 über eine Warmwasserzentralheizung mit Ölfeuerung. Nennenswerte Erneuerungen finden 1954, 1961, 1965, 1991 und 2005 statt. Ein Anbau mit Amtszimmer und Garage datiert von 1965.36 Derzeit ist das Pfarrhaus über die Kreisverwaltung angemietet und dient als Unterkunft für Flüchtlinge.37
Das Pfarrhaus in Neuhofen von 1853, Aufnahmen von Friedhelm Hans
Die Vorgänger von Eberhard Cherdron als Pfarrer in Neuhofen hießen Heinrich Kron (1923-2007) und Fred Bach (1932-2019). Kron wechselte seinerzeit nach Kaiserslautern-West, ihm folgte im November 1960 Fred Bach. Heinrich Kron, der Vorgänger Bachs, und Nachbar Pfarrer Otto Franz (1912-1989) aus Limburgerhof waren die Assistenten bei Bachs Installation am 16. April 1961.38 Bach wechselte wie Kron nach Kaiserslautern, auf ihn folgte Eberhard Cherdron am 1. September 1974. Eberhard Cherdrons Assistenten bei der Einführung auf die Pfarrstelle Neuhofen waren sein Vater und ein Herr Bein, Presbyter in Neuhofen39. Bei seinem Einzug stand eine umfangreiche Erneuerungsarbeit am Pfarrhaus an (Maler und Elektriker).40 In den Folgejahren waren immer wieder kleinere Instandsetzungsarbeiten erforderlich, so 1975 das Badezimmer.41 Am 1. September 1977 verließ Eberhard Cherdron die Pfarrstelle. Er zog wie seine beiden Vorgänger ebenfalls nach Kaiserslautern, um dort das Amt des Landesjugendpfarrers zu übernehmen. Der nächste Pfarrer in Neuhofen hieß Dietrich Lauter.42
Pfarrer Ralph Gölzer überliefert eine Anekdote vom Herbst 1974:
„… ein Mann klingelt am Pfarrhaus in Neuhofen. Da niemand öffnet, geht der Mann ums Haus herum und betritt den großen Pfarrgarten Dort ist ein offensichtlich noch recht junger Mann mit Gartenarbeiten beschäftigt. Der bärtige Arbeiter – er trägt kurze Jeans, ein kariertes Hemd und sogenannte Jesuslatschen – schaut von seiner Gartenarbeit auf zu dem Fremden hin.
‚Ist der Pfarrer nicht da?‘, fragt dieser.
‚Im Haus ist er jedenfalls nicht‘, bekommt der Mann zu hören.
Eberhard Cherdron schmunzelt, als der Fremde wieder geht, und kann sich in Ruhe weiter seiner Gartenarbeit widmen.“43 Der Besucher hatte offensichtlich kein dringliches Anliegen.
Gölzer will an dieser Begebenheit ein neues Pfarrerbild erkennen. Wie hat ein Pfarrer auszusehen, und wie hat er sich zu kleiden oder sein Pfarramt zu führen. – Der Pfarrer ist anders, stellt Manfred Josuttis 1982 fest. Gölzer wertet weiter u.a. die Jahresberichte Cherdrons in Neuhofen aus. Er sieht Chancen für neue Gottesdienstformen, und ihn plagt der Berg an Verwaltungsarbeit. Und hofft Ende 1975 auf „eine Entlastung auf diesem Gebiet der pfarramtlichen Verwaltung“. 1976 werden ihm, dem Diplomvolkswirt, „die Schwächen der kirchlichen Verwaltung deutlich“, was auch für die Personalverwaltung gilt.44
Die Anekdote kann der Verfasser an zwei Stellen ergänzen: Tatsächlich führte Eberhard Cherdron eine kleine Verwaltungsreform durch und sammelte die Einzelvergütungen der Organisten, um sie auf einmal auszuzahlen, allerdings mit der Folge, dass eingesetzte Orgelschüler mitunter sehr lange auf ihr Honorar warten mussten.
Zum anderen eine Anmerkung aus dem eigenen Pfarrhausleben. Wenige Jahre nach der Begebenheit im Neuhofener Pfarrgarten klingelte ein Fremder in Kallstadt an der Haustür. Der junge Pfarrer war diesmal tatsächlich nicht zu Hause. Der jungen Pfarrfrau stellte der Fremde die Frage: „Ist Ihr Vater zuhause?“ Mit gutem Wissen antwortete die Pfarrfrau: „Nein, mein Vater ist nicht da.“ Der Fremde gab sich mit der Auskunft zufrieden und zog weiter.
Wenige Monate später ließ die gleiche Pfarrfrau einen zweifelhaft auftretenden älteren Herrn, der nach dem Pfarrer fragte, nicht ins Haus. Später stellte sich aber heraus, dass es sich um den Pfarrer Otmar Fischer (1935-2022) aus Weisenheim am Berg handelte, der in seiner Arbeitskleidung auf der Fahrt von seinem Wingert in Friedelsheim nach Weisenheim am Berg fuhr und am Kallstadter Pfarrhaus Station machte.
In den Akten finden wir nicht viel von dem, wie die Pfarrfamilie Cherdron junior oder senior in den Pfarrhäusern gelebt hat. Bei Fritz Cherdron wird das offene Pfarrhaus deutlich: Die Pfarrhäuser in Hochstadt und in Kandel sind Begegnungsstätten und ersetzen mitunter das Gemeindehaus. Eberhard Cherdron lässt sich mit dem ihm eigenen Witz und offensichtlich ohne seine Pflicht zu verletzen nicht aus der Ruhe bringen und tritt damit einem überlieferten Klischee von einem Pfarrer in Schlips und Kragen entgegen. Das Pendel zwischen Dienst und Privatheit schlägt einmal in die eine und ein andermal in die andere Richtung aus.
Eberhard Cherdrons berufliches Wirken ist ohne die Musik nicht zu denken. Die Musikalität wurde ihm im Pfarrhaus in die Wiege gelegt. Musik zieht sich durch sein ganzes Leben, privat und öffentlich im Dienst an seiner Kirche und Gemeinde.45
Ein weiterer Wesenszug ist anhand der dürren Akten ablesbar: Die diakonische Verpflichtung, auch sie ist im Pfarrhaus daheim. Nicht nur, dass sich die Cherdrons um die Gemeindediakonie und später um die öffentliche Fürsorge gekümmert haben. Der Dienst an Kranken und Bedürftigen versteht man in Familie und Beruf als selbstverständliche Verpflichtung, und das angefangen und praktiziert in der eigenen Familie. Musik und Diakonie bereichern das Pfarrerleben im Hause Cherdron. Sie wurzeln in der christlichen Nächstenliebe.
2 Vgl. Heinrich Wolfgang Seidel (1951): Drei Stunden hinter Berlin. Briefe aus dem Vikariat, Husum.
3 Aus der Literatur: Martin Greiffenhagen (1984): Das evangelische Pfarrhaus: eine Kulturund Sozialgeschichte, Stuttgart. Populär: Günter E. Th. Bezzenberger & Günther S. Wegener (1984): Im Pfarrhaus brennt noch Licht. Geschichten aus deutschen Pfarrhäusern, Aachen; für die Pfalz: Friedhelm Hans (1992): Das pfälzische Pfarrhaus im Wandel der Zeit; Richard Hummel & Heinz Klein (1992): Zahlen zum Pfarrhausbau, in: Der Turmhahn 36, Heft 3/4.
4 Karl Barth (1946): Christengemeinde und Bürgergemeinde, Zürich.
5 Friedhelm Hans (2012): Das Pfarrhaus zwischen Bildungsinstitution und Leerstand. Ein Tagungsbericht, in: Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde (im Folgenden: BPfKG) 79, S. 521-525. Die Tagung wurde dokumentiert: Hansmartin Schwarzmaier & Udo Wennemuth & Jürgen Krüger (Hg.) (2014): Das Evangelische Pfarrhaus im deutschsprachigen Südwesten, Oberrheinische Studien 32, Ostfildern: Thorbecke.
6 Hans Hermann Risch (1958): Ausstrahlungen von einem evangelischen Landpfarrhaus, in: Der Turmhahn 2, Heft 4/5, S. 9-16; Friedhelm Hans (in Vorbereitung): Hans Hermann Risch (1903–1985). Liturg, Historiker und Diasporatheologe in Erinnerung an Eleonore Luise Hedwig Risch geb. Fauß (1922-2021), in: FS für Wolfgang Müller.
7 Vgl. Anm. 2
8 Brigitte Latterner (2004): Wie die Mühlbacher ihre Kirche bauten …, FS anläßlich des 70-jährigen Kirchenjubiläums, Altenglan 2004; Brigitte & Ilse Latterner (2005): Mühlbach am Glan im Wandel der Zeit, 750 Jahre: 1255–2005, Altenglan.
9 In Rischs „Erinnerungen“, 166, nur als „E.“ bezeichnet: Gemeint ist eher der ältere Bruder Ludwig (* 1909) als der jüngere Leonhard (* 1913).
10 Die Familie Cherdron erscheint in Otterberg um 1662, vgl. Arise French prophets and light the lamp. The Johann Jonas fortineux‘s family history: https://www.angelfire.com/journal2/skylark1/page13.html (14.6.2023).
11 Katechismus für die Vereinigte Protestantische Evangelisch-Christliche Kirche der Pfalz, Ausgabe Speyer 1972: „Was sind wir unserer Kirche schuldig? Wir sollten die von der Kirche uns dargebotenen Gnadenmittel des Wortes Gottes und der heiligen Sakramente dankbar benützen, die errungenen Glaubensgüter treu bewahren und durch lebendige Teilnahme an Ihrem Gedeihen mitarbeiten.“ – zitierte Bibelstellen: Hebräer 10,25; Offenbarung 3,11; 2. Korinther 1,24; ferner Offenbarung 3,15f.; Galater 5,10; 1. Petrus 5,3.
12 Angaben zu den genannten Vikaren und Pfarrern im projektierten Pfälzischen Pfarrpersonenbuch: BERGMANN, D. theol. h.c., Richard August, * 7.12.1890 Zeiskam, † 4.12.1972 Speyer/Rh. Lit.: CD Friedhelm Hans Verein für Pfälzische Kirchengeschichte: Reihe „Neue Medien“ (im Folgenden: VVPfKG-NM) 3; Lebenserinnerungen MS 1970, Neuausgabe VVPfKG-NM 3 (2018); Martin Schuck, Art. Bergmann, Richard August, D. theol. h.c., in: PoP Bd. 2, S. 655ff. Verleih. d. Ehren-Doktorwürde d. Theol. Fakultät Uni. Mainz, „Wichern-Plakette“ d. Diak. Werkes, „Johann-Eimann-Plakette“; Biundo 315, NPB 47; FERCKEL, Jakob Ludwig Karl Theodor, * 25.8.1881 Trippstadt, † 29.10.1955 Kirchheimbolanden; FUCHS, Jakob, * 4.4.1887 Oberbexbach, † 17.10.1959 Ludwigshafen-Friesenheim; GAUCH, Artur Hugo Oskar, * 30.5.1888 Gerbach, † 5.9.1943 (Fliegerangriff), Ludwigshafen; KNECHT, Otto Johannes, * 28.2.1886 Otterberg, † 17.9.1956 Ludwigshafen – trotz seiner nie verleugneten konservativ-nationalen Grundeinstellung, kein „Hitlerpfarrer“, theologisch positiv ausgerichtet, wollte sein Amt in strikter politischer Neutralität ausüben. Knecht blieb seiner Linie nach 1933 treu. Nach einer kurzen Mitgliedschaft bei d. DC 1933/34 fand er sich mit anderen theologisch positiv eingestellten Pfarrern in einer AG Pfälzer Pfarrer zusammen, die sich – bei strikter Vermeidung politischer Aussagen – gegen d. politische überfremdete Theologie d. DC aussprach; richtig: KREISELMAIER, Paul, * 30.4.1900 Neuhofen, † 25.10.1967 während eines Besuches bei seinen Kindern u. seinem Bruder in Amerika; RUPP, Johann Wilhelm, * 4.12.1891 Barbelroth, † 14.7.1942;
13 Nicht identifiziert.
14 Schwager von Richard Bergmann; Religionslehrer in Ludwigshafen, vgl. CD Friedhelm Hans VVPfKG-NM 3; Lebenserinnerungen MS 1970, Neuausgabe VVPfKG-NM 3 (2018)
15 Angaben nach dem projektierten Pfälzischen Pfarrpersonenbuch: ENGEL, Heinrich, * 18.8.1910 Steinbach a. D., † 28.8.1944 (tot erklärt); GOTTHOLD, Andreas, * 14.11.1887 Kaiserslautern, †?; SCHNEIDER, Bernhard, * 5.6.1893 Sondernheim, † 24.10.1941 Göppin-gen; EBRECHT, Walter Erich, * 27.3.1910 Ludwigshafen-Friesenheim, † 24.5.1978 Eisen-stadt/Österreich im Urlaub; Lit.: Gabriele Stüber, Walter Erich Ebrecht (1910-1978). Kirchenpräsident 1969-1975: Friedhelm Hans u Gabriele Stüber (Hg.), Pfälzische Kirchen- u. Synodalpräsidenten. VVPfKG 27 (2008), S. 159-175; LAFRENZ, Willi Ludwig, * 26.8.1910 Homburg/Saar-Erbach, † 14.1.2000 Weilerbach; SCHLARB, Alfred, * 7.4.1908 Feil, † 1.5.1980 Godramstein; WERRON Paul Heinrich, * 11.5.1912 Pirmasens, † 13.10.2005 Ludwigshafen; SCHRÖDER geb. Glaßner, Hanna Friederike, * 7.12.1911 Ludwigshafen, † 31.7.1990, Ludwigshafen; Lit.: Heiderose Gärtner, Art. Hanna Schröder geb. Glaßner, in: LfeT 2005, S. 359; HOLZÄPFEL, Johanna Barbara, * 21.5.1904 Ludwigshafen, † 20.3.1993 Landau; Lit.: Heiderose Gärtner, Art. Johanna Holzäpfel, in: LfeT.
16 Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz, Speyer (im Folgenden: ZASP) Abl. 160 Nr. 266 digital.
17 Richard Bergmann: Lebenserinnerungen S. 254f., ed. Friedhelm Hans, vgl. Anm. 12.
18 Weitere Angaben zu Eugen Héraucourt: Studium 1900/04 Erlangen, Heidelberg und Utrecht (1902), Aufnahmejahr 1904, 1.11.1906/08 Vikar, 27.12.1908 bzw. 20.11.1909/13 Pfarrer in Dennweiler-Frohnbach, 16.4.1913/27 Biedesheim, 1.9.1927/40 Niederhochstadt. Mitarbeiter des Entjudungsinstituts in Eisenach; H. wurde in d. SPD-Presse wegen seiner Nähe zur NSDAP angegriffen. Er setzte sich hiergegen in einer Stellungnahme gegenüber dem Landeskirchenrat zur Wehr und betonte, dass er sich von jeder Parteipolitik zurückhalte und mit Rücksicht auf politisch links stehende Gemeindemitglieder keine NSDAP-Versammlungen besuche. An seinem politischen Standpunkt, der mit der überwiegenden Mehrheit seiner Gemeinde übereinstimmte (diese hatte mit wenigen Ausnahmen die NSDAP gewählt), ließ er aber keinen Zweifel. Fehns Taufpate war Pfarrer Karl Philipp Hoffmann (1822-1912), 26.12.1856/71 Speyer III, 1.9.1871ff. Inspektor Diakonissen-Haus Stuttgart, vgl. das projektierte Pfälzische Pfarrpersonenbuch; Friedhelm Hans (2018): Theo Fehn, Pfarrer in Tiefenthal 1948 bis 1974 und pfälzischer Glockensachverständiger, in: 750 Jahre Tiefenthal.
19 Wolfgang Eger (1967): Handbuch der Pfälzischen Landeskirche, Speyer, S. 797.
20 Handbuch der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) (1995) hg. vom Landeskirchenrat, Speyer.
21 Nach dem Studium 1909/13 in Heidelberg, Berlin, Marburg, Zürich und Utrecht (imm. 4.6.1912) wurde Damian 1913 in den kirchlichen Dienst aufgenommen. 1913/14 Aushilfsgeistlicher in Altenglan, 1914/15 Speyer, 15.1.1915 Stadtvikar Germersheim, 16.6.1915/17 Stadtvikar Lauterecken, 1.3.1917 Stadtvikar St. Ingbert, 1.10.1917/29 Pfarrer Dahn, 1.5.1929/33 Pirmasens IV, 1933/34 in zeitl. Ruhestand (als politischer Gegner der NSDAP in Schutzhaft), 16.4.1934/37 Pfarrer Dörrenbach, 16.7.1937/49 Wilgartswiesen, 1.3.1949/57 Kandel, 1.10.1957 in Ruhe; Damian war einer der pfälzischen Wortführer des „Volksbundes evangelischer Sozialisten“, die auf der Landessynode vom 22.5.1927 als neue Kirchenpartei antrat, wurde 1931 vom kirchlichen Dienstgericht wegen Verunglimpfung der Kirche und des Pfarrerstandes in einem Zeitungsartikel (Damian: „Die Religion ist in Gefahr“) zur Versetzung wider Willen verurteilt. Nachdem er Berufung unter Vorlage von 5000 Unterschriften seiner Anhänger gegen d. Urteil eingelegt hatte, wurde er zwar auch in 2. Instanz für schuldig gefunden, die Versetzung aber in einen Verweis umgewandelt. Damian war 1933 der erste pfälzische Pfarrer, der massiv unter NS-Repressionen zu leiden hatte. Als Sozialdemokrat, Pazifist und religiöser Sozialist kam er am 20.3.1933 ins provisorische Konzentrationslager Rheinpfalz in einer Kaserne zwischen Neustadt und Lachen. Auf seine Verhaftung und „Inschutzhaftnahme“ kam von der Kirchenregierung nur müder Widerspruch: „Um des Ansehens der Kirche und des Pfarrerstandes müssen wir pflichtgemäß gegen dieses Verfahren Verwahrung einlegen.“ Der spätere Landesbischof Ludwig Diehl, suchte ihn dort auf und nahm ihm die schriftliche Erklärung ab, dass sich die Kirchenpartei der religiösen Sozialisten auflöse. Damian erklärte auch seinen Austritt aus der SPD und kam am 3.4.1933 aus der Haft frei. Wie groß Diehls Anteil daran war, ist umstritten. Damian trat 1935 den „Deutschen Christen“ bei. Der Münchner Porträtist Willy Damian (1901-1968) war ein Bruder. In erster Ehe war Damian verheiratet mit Emilie Charlotte Risch (* Heuchelheim b. L. 29.4.1891, † 28.3.1949), in zweiter Ehe mit Karoline Müller (* Altenglan 11.1.1905, † kurz vor 15.1.1998 Kandel), Veröffentl.: „Die Religion ist in Gefahr“ 1932, Verlag der Religiösen Sozialisten in Mannheim, 32 S. (eine geradezu prophetische Schrift gegen den Nationalsozialismus, vgl. BPfKG 1974, S. 36f.); Roman-MS „Zu spät“. Lit.: Die Kirche zu Dörrenbach: Union 74 (1936), S. 225ff.; BPfKG 45; Karl Meier, Der Ev. Kirchenkampf III, S. 429; schon 1933 hatte Diehl d. Entlassung d. Religiösen Sozialisten Pfarrer Damian aus dem Arbeitslager erwirkt; dazu Karl-Georg Faber, Überlegungen zu einer Geschichte des Pfälzischen Landeskirche, BPfKG 41 (1974), S. 37; Karlheinz Lipp, Gegen Faschismus u. Krieg: Der Pfälzer Pazifist und religiöse Sozialist Oswald Damian, in: Hans-Georg Meyer & Hans Berkessel (Hg.) (2000): Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz, Bd. 1, S. 50-56; Ders., Art. Damian, Georg Oswald, in: PoP Bd. 2, S. 680ff; Erich Schunk (2016): Oswald Damian als Religiöser Sozialist, in: Kaiserslauterer Jahrbuch zur pfälzischen Geschichte und Volkskunde 16, S. 395-402.
22 ZASP Abt. 8 Jahresberichte Kandel Nr. 99, Jahresbericht für 1970 von Pfarrer Ernst Ludwig Spitzner.
23 Angaben nach dem projektierten Pfälzischen Pfarrpersonenbuch.
24 Der Kirchenneubau in Niederhochstadt machte Pfarrer Georg Keßler viel Ärger. Sein letzter Eintrag im Taufregister: „Den 22.8.1739 bin ich nach ausgestandenen vielen Drangsalen zur Pfarrei Alzey transferiert worden. Gott verzeihe meinen Feinden und segne meine successores in Zeit und Ewigkeit. Amen.“ (FS Kirchengemeinde Hochstadt 1738-1988, S. 14).





























