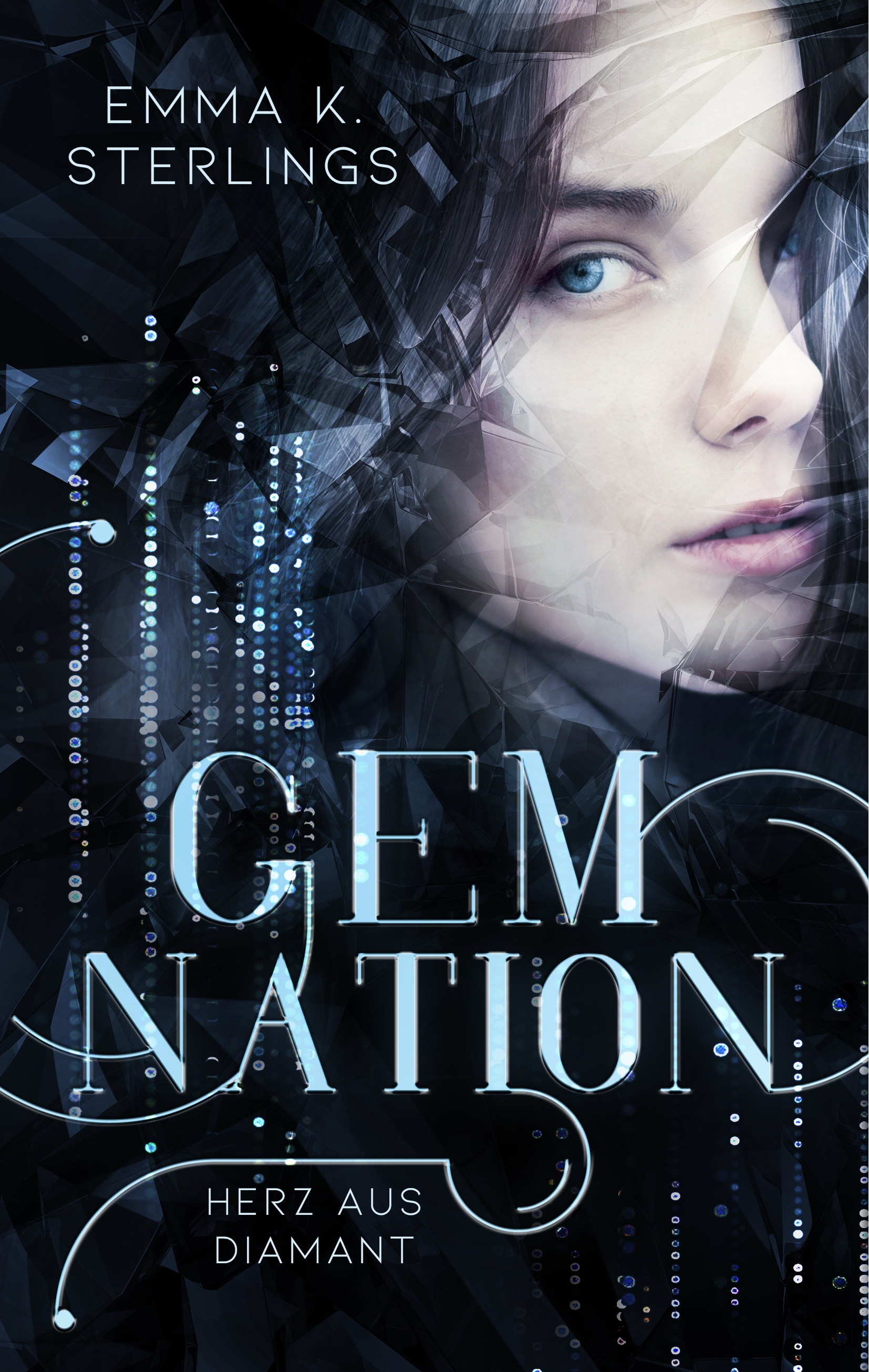
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Selbst die kleinste Flamme spendet Wärme. Bis zum Schluss. Und bevor sie erlischt, kann sie ein neues Feuer entfachen. Gwyn lebt in einer geteilten Welt. Ein Großteil der Menschheit hat die Erde verlassen, die nun überwiegend von der Gem Nation, der Edelstein Nation, bewohnt wird. Doch auch die Zirkoner, grausame und seelenlose Geschöpfe, treiben ihr Unwesen in der neuen Welt und jagen die Gem Men, um an ihre Herzen zu gelangen. Als der kleine Bruder ihrer besten Freundin verschwindet, macht sich Gwyn auf die Suche nach ihm und gerät in ein Abenteuer, das alles verändert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DAS BUCH
Selbst die kleinste Flamme spendet Wärme. Bis zum Schluss. Und bevor sie erlischt, kann sie ein neues Feuer entfachen.
Gwyn lebt in einer geteilten Welt. Ein Großteil der Menschheit hat die
Erde verlassen, die nun überwiegend von der Gem Nation, der »Edelstein-Nation«, bewohnt wird. Doch auch die Zirkoner, grausame, seelenlose Geschöpfe, treiben ihr Unwesen in der neuen Welt und jagen die Gem Men, um an ihre Herzen zu gelangen. Als der kleine Bruder ihrer besten Freundin verschwindet, macht sich Gwyn auf die Suche nach ihm und gerät in ein Abenteuer, das alles verändert...
DIE AUTORIN
Emma K. Sterlings ist das Pseudonym einer deutschen Autorin. Sie wurde 1995 in Lörrach geboren und absolvierte 2014 ihr Abitur. Die Liebe zum Lesen und zum Schreiben begleitet sie schon seit ihrer frühesten Kindheit. Heute verleiht sie ihrer Leidenschaft Ausdruck durch eine Ausbildung als Buchhändlerin und das Verfassen von fantastischen Geschichten. Gemeinsam mit ihren Eltern, vier jüngeren Geschwistern und sechs Haustieren wohnt sie auf dem Land und wartet noch immer auf ihren Brief aus Hogwarts oder die Einladung zu einem Disney-Casting.
Für alle ungeschliffenen Diamanten, Träumer und Wunschdenker da draußen. Hört nie auf, nach den Sternen zu greifen.
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
SiebzehnteS Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Epilog
ERSTES KAPITEL
Vorsichtig spähte ich über die Mauer. Dahinter verhielt sich alles ruhig und unauffällig. In der Morgendämmerung lagen die leeren Straßen da wie ausgelegte Stoffbahnen. Nur ab und zu sah man mal eine Katze oder ein Huhn, das wohl aus einem der nahe gelegenen Ställe ausgebrochen war und sich ins Innere der kleinen Stadt verirrt hatte, in einer der dunklen Gassen verschwinden. Der Nebel waberte in dichten, grauen Dunstschleiern um die Häuser des Türkiser Stammes und verhüllte deren Dächer wie ein Schleier das Gesicht einer unschuldigen Braut. Hinter keinem der Fenster brannte bisher ein Licht. Die Bewohner schienen also alle noch friedlich schlummernd in ihren Betten zu liegen.
Als ich mir dessen ganz sicher war, hievte ich mich beherzt auf die mit Moos bewachsene Stadtmauer und sprang auf der anderen Seite mit einem Satz wieder hinunter. Dabei versuchte ich, möglichst auf den Fußballen zu landen und mich mit den Handflächen auf dem kiesigen Boden abzustützen, um den Sprung besser abfedern zu können. Mit der Zeit hatte ich meine Taktik optimiert und von Mal zu Mal tat der Sturz von den knapp zweieinhalb Meter hohen Mauern weniger weh. Ich konnte mich noch genau daran erinnern, wie ich mir bei einem meiner ersten Versuche das rechte Handgelenk ordentlich verstaucht hatte, weil ich unglücklich aufgekommen und umgeknickt war. Danach konnte ich tagelang nicht mehr beim Verarbeiten der Spinnenseide helfen und mein Vater war ziemlich böse auf mich gewesen. Ich hatte zwar versucht, es vor ihm zu verheimlichen, aber eigentlich hätte ich es besser wissen sollen. Es war praktisch unmöglich, irgendetwas vor unserem Stammesoberhaupt geheim zu halten. Als er erfahren hatte, dass mein Handgelenk verletzt war, war er regelrecht ausgetickt. Er hatte mich angeschrien und mich zornig zurechtgewiesen, ich könne froh sein, dass es das rechte und nicht das linke Handgelenk gewesen sei. Denn dann wäre es lebensbedrohlich geworden. Da ich jedoch sein Temperament geerbt hatte, war ich ebenfalls böse geworden und hatte wiederum ihm entgegnet, er solle mich nicht immer wie ein Kind oder irgendeinen zerbrechlichen Gegenstand behandeln. Zumal ich ja als zusätzlichen Schutz meine Armklemme trug. Gott sei Dank war mein Vater nicht auch noch hinter den Grund für meine Verletzung gekommen. Den hatte er wohl aus lauter Ärger über die Verstauchung gar nicht mehr erfragt. Wenn er wüsste, dass ich mich des Nachts manchmal aus unserem Lager schlich, um andere Stämme um ein paar Rohstoffe zu erleichtern, ließe er mich wohl nicht mehr aus den Augen. Dabei würden wir ohne die zusätzlichen Nahrungsmittel, die ich unserem Stamm damit bescherte, wohl mehr schlecht als recht über die Runden kommen. Und außerdem stahl ich ja auch nur von den wohlhabenderen Stämmen, die in diesen schweren Tagen ohnehin mehr als genug zu essen hatten, während mein Volk mit dem Hunger rang. Damit versuchte ich stets, mein eigenes Gewissen etwas zu besänftigen.
Ich richtete mich wieder auf und schulterte meinen Rucksack, in dem ich zwei leere Leinensäcke und drei Botas untergebracht hatte. Mehr würde ich nicht tragen können. In gefülltem Zustand wögen die Behältnisse mehrere Kilos und ich musste sie wieder ganz alleine über die Mauer zu unserem Lager transportiert bekommen.
So leise wie ich nur konnte, huschte ich mit meinem Gepäck über den mit Kies bedeckten Grund und versteckte mich hinter dem nächstgelegenen Stamm eines Baumes. Wenn ich von den Mitgliedern des Türkiser Volkes unentdeckt bleiben wollte, musste ich mich möglichst unsichtbar halten. Bisher war es selten vorgekommen, dass ich bei einem meiner nächtlichen Ausflüge von jemandem gesehen wurde, aber wenn, dann war ich zum Glück immer rechtzeitig davongekommen, bevor derjenige seine Angehörigen informieren konnte und die ganze Stadt in Aufruhr geriet. Die Türkiser waren eines von insgesamt einundzwanzig Völkern unserer großen Nation. Der Gem Nation. Und ihr Volk gehörte eindeutig zu den Wohlhabenderen unter uns. Dies verdankten sie wohl unter anderem auch der Tatsache, dass sie zusammen mit den Korallen, den Lapislazuli und den Hämatiten in diesem Jahr vom Kreis der Großen Zwanzig dazu erwählt worden waren, die Nahrungsvorräte der gesamten Nation zu verwahren und verwalten. Diese bestand aus den einundzwanzig großen Völkern, die sich wiederum in mehrere hundert Stämme aufgliederten und über die gesamten Kontinente verteilt lebten. Mein Volk jedoch besaß weder Wahl- noch Mitspracherecht in jeglichen politischen Angelegenheiten. Die ehrenvolle Aufgabe der Rohstoffverwaltung wurde jedes Jahr aufs Neue an vier andere Völker vergeben, damit Gleichberechtigung und Sicherheit unter den Stämmen herrschten. Davon merkte ich jedoch nicht die Bohne. In diesem Jahr wurde jedenfalls den Türkisern diese Aufgabe zuteil, weshalb auch in dieser Stadt nur etwa die Hälfte des Stammes ansässig war. Die meisten von ihnen waren abgezogen und zur Großen Halle berufen worden, wie der Lagerort der Vorräte genannt wurde. Er befand sich auf Middle Island, einer kleinen, bislang unbewohnten Insel im Südatlantik, von wo aus die Vorräte dann in die gesamte Welt verschickt und aufgeteilt wurden. Die Verwaltung der Vorräte war eine große Verantwortung und daher wurden die Völker, die gerade damit beauftragt waren, auch entsprechend entlohnt. Dies wurde durch die großen Karren bestätigt, die immer reich beladen waren mit Rohstoffen. In der vergangenen Woche hatte ich vom Waldrand aus beobachtet, wie im Rhythmus von zwei Tagen jeweils drei der schweren Holzgefährte von mehreren schwarzen Donnerhuflern ins Innere der Türkiser Stadt gezogen wurden. Innerhalb der Stadtmauern wurden sie dann, wie bei den meisten Stämmen, in geräumigen Lagerhäusern am Stadtrand entladen und die Nahrungsmittel und Getränkevorräte dort aufbewahrt, bis irgendjemand vom Stamm etwas davon benötigte. Dann konnte er dorthin gehen und nach einer Ration verlangen. In der Regel aber wurden Teile des Vorrates immer einmal in der Woche an die ganze Stadt verteilt. Nur an unseren Stamm verteilte niemand etwas.
Achtsam lugte ich hinter meinem Versteck hervor und warf einen Blick auf das runde, steinerne Lagerhaus der Türkiser, welches einige Meter entfernt von meinem Baum im Morgendunst ruhte. Links und rechts vom Eingang bemerkte ich zwei großgewachsene Männer, deren schwarzes Haar von einigen blau-grünen Strähnen durchfärbt war. Offensichtlich waren sie dort platziert worden, um Wache zu halten und ihre Vorräte vor möglichen Dieben und Plünderern zu schützen. Was mir aufgrund der Tatsache, dass ich gerade tatsächlich vorhatte, sie zu bestehlen, ziemlich plausibel erschien. Da ich auf diese Art von Hindernis allerdings vorbereitet war, nahm ich meinen Rucksack vom Rücken und kramte aus dessen Innerem zwei dünne Blasrohre hervor, die ich selbst aus einem ausgehöhlten Ast gefertigt hatte. Dann zog ich eine Pinzette und eine kleine, gläserne Ampulle aus der Seitentasche meiner khakigrünen Jacke, die ich als Tarnung über meiner weißen Volkstracht trug. In dem schmalen Gefäß befanden sich einige braune Samenkörner. Behutsam öffnete ich den Verschluss der Ampulle und beförderte mit der Pinzette ein kieselsteingroßes Exemplar des Saatguts heraus, das ich zuvor in dem Saft eines Lianen-Gewächses getränkt hatte. Der Saft dieser Pflanzeenthielt ein Gift, das zwar eine betäubende Wirkung entwickelte, sobald es Hautkontakt bekam, sich aber ansonsten recht ungefährlich verhielt. Kam man damit in Berührung, schlief man lediglich ein und wurde für etwa einen halben Tag außer Gefecht gesetzt. Unser Stamm war durch Zufall auf dieses Gift gestoßen, als einer unserer Ältesten es vergangenes Jahr auf der Suche nach einer wirksamen pflanzlichen Medizin gegen Magenkrämpfe entdeckt hatte. Aufgrund der Nahrungsmittelknappheit innerhalb unseres Stammes mussten wir uns mit allem Möglichen behelfen, was die Natur und der Wald zu bieten hatten. Und da davon nicht immer alles genießbar war, kam es in der Vergangenheit leider nicht selten vor, dass sich irgendjemand unter uns eine Vergiftung zuzog, die fürchterliche Magenbeschwerden zur Folge hatte. Jedenfalls stieß Detor – so der Name jenes Ältesten – dadurchauf die narkotische Wirkung der Pflanze. Bei der Extraktion einiger Pflanzensäfte fand mein Vater ihn plötzlich schlummernd über seiner Arbeit wieder. Während seines Nickerchens hatte man noch so oft versuchen können, den alten Mann zu wecken – er schlief einfach weiter und wachte erst Stunden später wieder auf. Detor musste wohl versehentlich mit dem Gift der Pflanze in Berührung gekommen sein. Und da er keine Ahnung hatte, welche Wirkung es besaß, konnte er auch nicht erahnen, was geschehen würde. Nachdem er dann wieder zu sich gekommen war, untersuchte er das toxische Gewächs noch einmal vorsichtiger und kam auf diese Weise hinter sein Geheimnis.
Ich jedenfalls fand die betäubende Wirkung des Saftes überaus hilfreich und sie erwies sich bei meinen Borgungsausflügen als sehr nützlich. Mithilfe der Pinzette ließ ich nacheinander zwei der Samenkörner in den Blasrohren verschwinden und pirschte mich dann diskret an die zwei Wachen heran. Als sie mir ungefähr in geeigneter Reichweite schienen, duckte ich mich hinter einen Busch und ging in Schussposition. Mit einer raschen Handbewegung strich ich mir ein paar Strähnen meines widerspenstigen, weißblonden Haares aus der Stirn, welches die Angewohnheit besaß, mir andauernd ins Gesicht zu fallen. Dann legte ich das erste Blasrohr an die Lippen und zielte auf den Mann, der rechts neben der Tür und damit weiter von mir entfernt stand. Jetzt bloß nicht einatmen, rief ich mir in Erinnerung, sonst wäre es nämlich ich selbst, die in wenigen Augenblicken hier narkotisiert hinter dem Busch liegen würde. Mit genügend Pflanzengift intus, um bis in den späten Tag hinein durchzuschlafen. Ich wollte nicht wissen, was passieren würde, wenn ein Stammesmitglied der Türkiser mich hier bewusstlos, beziehungsweise laut schnarchend auffinden würde.
Mit einem gekonnt dosierten Atemstoß beförderte ich das erste Samenkorn aus dem Rohr und sah erleichtert, wie es den Wachmann an einer Stelle am Hals unterhalb des Kinns traf. Der Mann gab einen überraschten Laut von sich und fuhr sich mit der Hand über die getroffene Stelle. Doch noch ehe er oder sein Kollege überhaupt begreifen konnten, was geschehen war, griff ich blitzschnell nach dem zweiten Rohr und beglückwünschte mich selbst, als auch das verbliebene Samenkorn sein Ziel fand. Es vergingen keine dreißig Sekunden mehr und die beiden Männer fielen bewusstlos und wie ich bemerkte, etwas unsanft zu Boden. Das würde sicherlich ein paar blaue Flecken geben. Als ich leise über ihre schlafenden Körper hinweg stieg, entschuldigte ich mich im Stillen dafür.
Im Inneren des Speicherhauses war es trocken und warm. Durch ein kleines Fenster unterhalb des Daches fiel ein dämmriges Licht in den halbdunklen Raum. Überall waren Kisten und Kanister aufeinandergestapelt, gefüllt mit Obst und Gemüse, getrocknetem Fleisch, Wasser und Saft. In dem, von mir aus gesehen, hinteren Teil des runden Raumes, lehnten schwere Säcke an der Wand, in denen sich unter anderem Mehl, Mais und verschiedene Getreidesorten befanden. Gleich daneben standen noch einige hölzerne Fässer und Kästen mit Garn, Fellen und Spinnenseide. Rasch durchquerte ich den Raum und holte zunächst die drei Botas aus meinem Rucksack, um sie mit Trinkwasser aus den Kanistern zu befüllen. Als sie voll waren, ließ ich sie wieder im Inneren des Rucksacks verschwinden und griff nach den Leinensäcken. Ich begann damit, Mehl und Getreide in einen der großen Säcke zu schaufeln, da sich diese am längsten halten würden. Obst und Gemüse nahm ich immer nur in kleineren Mengen mit, da sie ziemlich schnell faulten und in größeren Vorkommen in unserem Lager auffallen würden. Unser Volk kam – wenn überhaupt – nur schwer an Lebensmittel dieser Art heran. Ich hatte den ersten Sack schon beinahe bis zur Hälfte gefüllt, als ich hörte, wie hinter mir plötzlich jemand scharf die Luft einsog. Erschrocken fuhr ich herum.
»Was tust du hier!?«, herrschte mich eine raue Stimme an.
Im Eingang des Hauses stand eine schlanke Männergestalt.
Verflixt! Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mich jemand ertappen würde. Was sollte ich nun tun?
Zuerst dachte ich an Flucht, aber dann würde ich all meine Sachen hier zurücklassen müssen. Die gesamte Arbeit wäre umsonst gewesen. Zudem war der einzige Weg nach draußen versperrt.
Mein Entdecker trat einen Schritt näher an mich heran, um mich besser sehen zu können, da ich mich im Dunkeln verbarg. Als er endlich etwas erkennen konnte, sah ich, wie sich seine Augen vor Überraschung weiteten.
Na toll! Das hatte mir gerade noch gefehlt. Als wäre es nicht schon genug, dass er eine Fremde dabei erwischt hatte, wie sie seinen Stamm bestahl, nun hatte er auch noch gesehen, wie ich aussah. Und er schien zu begreifen, wen er da vor sich hatte. Gleich würden Wellen der Panik über die ganze Stadt hereinbrechen. Ich war geliefert!
Instinktiv versuchte ich, doch zu flüchten. Ich rannte auf den Mann zu, stieß ihn mit aller Kraft zur Seite, so dass er etwas taumelte, und hastete an ihm vorbei auf die Tür zu.
»Gwyn!?«
Abrupt hielt ich inne. Der Fremde hatte meinen Namen genannt. Nun war es an mir, erstaunt dreinzublicken. Zögerlich wandte ich mich zu ihm um und betrachtete ihn genauer.
Der Mann war mit einem tiefblauen Hemd und der dazu farblich passenden Hose aus leichtem Stoff bekleidet. Er trug keine Schuhe, war barfüßig. Der Saum seines Oberteiles war mit kleinen, grün schimmernden Steinen bestickt, von denen sich auch einige in einer seiner pechschwarzen Haarsträhnen entdecken ließen, die ihm in die Stirn fielen. Wie auch bei den Wachen zuvor, und bei eigentlich so gut wie allen Mitgliedern des Stammes der Türkiser, fanden sich wenige blau-grüne Streifen in seiner ansonsten dunklen Haarpracht wieder. Die Farbe seiner Haut war von einem hellen Karamell, genau wie seine Augen. Irgendwie kam mir der Türkiser bekannt vor. Verdammt bekannt, um ehrlich zu sein.
Und dann fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen.
»Mein Gott, Talek! Ist das möglich? Bist du es wirklich?«, aufgeregt lief ich ihm entgegen und umarmte meinen Freund aus Kindertagen stürmisch.
Ich konnte es noch gar nicht richtig glauben, dass ich ihn ausgerechnet in dieser Situation wiedertraf. Mit dem ehemals schmächtigen, kleinen Türkiserjungen von damals hatte dieser zwar immer noch schlanke, aber dennoch muskulöse, junge Mann nichts mehr gemein. Er war erwachsen geworden. So wie ich.
Talek schien sich ebenso zu freuen, mich wiederzusehen. Wenn ihm auch seine Überraschung darüber noch deutlich ins Gesicht geschrieben stand.
Talek und ich kannten uns gut von früher. Aus der Zeit, als es uns noch gestattet gewesen war, miteinander zu spielen und befreundet zu sein. Bevor man mein Volk verstoßen hatte.
Nachdem er mich eine gefühlte Ewigkeit an sich gedrückt hatte, nahm er mich bei den Schultern und schob mich sachte ein Stück weit von sich weg. Dann wurde sein Blick wieder ernst.
»Gwyn, was tust du hier?«, wiederholte er in gedämpftem Tonfall seine Frage von vorhin.
»Ich klaue eure Vorräte, das siehst du doch«, lieferte ich ihm die ehrlichste aller Antworten, die mir auf der Zunge lag. Nun, da ich von meinem ehemaligen besten Freund dabei ertappt worden war, wie ich seinen Stamm ungeniert bestahl, schämte ich mich ein wenig dafür. Auch wenn ich es tat, um mein eigenes Volk damit vor dem Hungertod zu bewahren. Ich versuchte, die Stimmung aufzulockern, und lächelte etwas. Doch Talek schüttelte nur bedenklich den Kopf.
Er eilte zur Tür, schien sich zu vergewissern, dass draußen niemand in der Nähe war, und schloss sie dann leise hinter sich.
Als er sich wieder zu mir umdrehte, wirkte er besorgt.
»Im Ernst. Wenn dich hier jemand anderes außer mir entdeckt hätte, wäre jetzt die gesamte Stadt auf den Beinen. Und alle brächen in Panik aus. Wenn dich jemand innerhalb unserer Stadtmauern antrifft, herrscht hier das komplette Chaos. Sie werden dich gefangen nehmen, weil du alleine bist. Du bist doch alleine, oder?«
Nun eher misstrauisch als besorgt wirkend, sah er sich im halbdunklen Raum um.
»Natürlich! Außer mir ist sicher keiner so leichtsinnig und schleicht sich nachts in die Stadt eines fremden Stammes, um sich dort in dessen Lagerhaus herumzutreiben«, versuchte ich immer noch, das Ganze etwas ins Lächerliche zu ziehen.
Doch Talek fand die Situation anscheinend alles andere als amüsant.
»Leichtsinnig ist genau das richtige Wort für deine Aktion hier, Gwyn! Was denkst du dir eigentlich dabei? Du könntest dir damit eine Menge Ärger einhandeln. Was glaubst du wohl, wie nahe ich davor stand, die anderen zu alarmieren, als ich die bewusstlosen Wachen vor dem Speicherhaus entdeckt habe? Du hattest Glück, dass ich genauso leichtsinnig war, indem ich einfach nachgesehen habe, wer das zu verantworten hat!« Bei seinen letzten Worten konnte er dann aber doch nicht verhindern, dass sich ein leichtes Lächeln auf seine Lippen schlich.
Ich schmunzelte ebenfalls und sah dann, wie Taleks Blick auf meinen Rucksack und den halb vollen Leinenbeutel am Boden fiel.
Flehentlich schaute ich ihn an.
»Bitte verrate mich nicht. Unserem Stamm geht es wirklich schlecht. Wir brauchen die Vorräte!«
Talek nickte verständnisvoll.
»Ich weiß, wie es um euch steht, Gwyn. Du glaubst gar nicht, wie leid mir das tut. Ich habe so oft an dich gedacht.«
Es rührte mich, dass er das sagte. Und ich wusste, dass er es ernst meinte. Talek kannte mich von klein auf, und deshalb brauchte er auch keine Angst vor mir oder meiner Familie zu haben. Mein Stamm gehörte dem Volk der Diamanten an. Eines von einundzwanzig großen Völkern der Gem Nation. Unsere Nation war über die gesamte Welt verbreitet. Jedes Volk war in mehrere kleine Stämme untergliedert, die sich über die verschiedenen Kontinente hinweg verstreuten. Das größte aller Völker bildeten die Quarze, die mit den Untervölkern, der Rosenquarze, der Citrinen, der Jaspise und der Amethysten, insgesamt vier an der Zahl waren. Jedem der Völker wurde eine ganz eigene Besonderheit oder ein Talent zuteil, das sie in bestimmte Aufgaben mit einbrachten. Wir nannten sie auch 'die Begabungen'. Die Quarze zum Beispiel waren Meister im Herstellen von Keramik und Glasarbeiten. Oder im Konstruieren und Bauen von Häusern, weshalb sie auch von Seiten der anderen Völker häufig damit beauftragt wurden. Ebenfalls zu den praktisch Begabten in der Gem Nation gehörten die Hämatiten, Achater und wir Diamanten.
Ein anderes Volk bildeten die Stämme der Rubiner. Eitle und kühle Charaktere, die aber neben den Königshäusern sozusagen unsere Elite bildeten. Sie kümmerten sich um die Gotteshäuser der Gem Men. Die meisten von ihnen fungierten in den Ämtern von Priestern und Ordensschwestern, waren sehr religiös. Ihr Hauptsitz befand sich in Teilen von Asien und Ostafrika. Unser Hohepriester Saphir (der im Übrigen auch einen ständigen Sitz im Rat der Großen Zwanzig hatte) lebte in Kenia und leitete von dort aus die gesamten Stämme der Rubiner an. Diese zählten zu den Ordnungshütern unserer Nation, ebenso wie die Amethysten und Citrinen. Natürlich brauchte man in einer solch großen Gemeinschaft auch jene, die sich um die körperlichen und seelischen Belange der Einzelnen kümmern konnten. In der Gem Nation fiel diese Aufgabe den Heilern zu. Insgesamt besaßen fünf Völker diese Gabe: die Karneoler, Türkiser, Korallen (alle drei angewendete Körperheilpraxis), Perlen und Rosenquarze (seelische Beschwerden). Die Angehörigen der Chryskollvölker, Pyriten und Jaspise fungierten in politischen Ämtern, kümmerten sich beispielsweise aber auch umalles, was mit Wirtschaft und dem Agrarwesen zu tun hatte. Künstler gab es unter uns dreierlei: Die Turmaline liebten es, die übrigen Völker zu unterhalten und verstanden es voll und ganz, alle Facetten der Schauspielerei auszuleben. Die Perlmutter waren musikalisch unübertrefflich und veranstalteten die wundervollsten Konzerte, während man Stunden des Staunens vor dem Kunstwerk eines Lapislazulis zubringen konnte. Sie verstanden es mit Farben und Pinsel ebenso umzugehen, wie mit Hammer und Meißel. Keine tatsächliche Bestimmung hatten die Nomadenvölker, die von dem Rest der Nation auch 'die Herumtreiber' genannt wurden: Die Völker der Suglitithen, der Tigeraugen und Obsidianer streiften durch die Lande und zogen von einem Ort zum anderen, schlossen sich nur sehr selten der Gemeinschaft eines anderen Stammes an und blieben meist unter sich. Und dann gab es neben all den verschiedenen Völkern noch die drei verbliebenen Königsgeschlechter. Die Painits aus Myanmar, die Roten Berylle aus dem Bereich der ehemaligen USA und die Serendibits aus Madagaskar. Einst hatte es sieben Königsgeschlechter gegeben, von denen ein jedes die Aufgabe hatte, über einen der Kontinente zu wachen. Aber vier der Könige bekriegten sich in einem langjährigen Streit, was zu vielen Opfern auf allen Seiten und letztendlich zum Aussterben ihres Geschlechts geführt hatte. Es war der größte und blutigste Krieg gewesen, den unsere Nation jemals gesehen hatte. Angeblich hatte der König der Musgraviten Anspruch auf die Herrschaft über die drei Kontinente der anderen erhoben und als diese sie ihm nicht überlassen wollten, brach die Fehde aus. Seit es nur noch drei Königsgeschlechter gab, herrschte auf den führungslosen Kontinenten immer öfter Chaos und Unfrieden. Eine Vielzahl an streitsüchtigen Parteien hatte sich gebildet, die gegen die bestehenden Königshäuser aufbegehrten und rebellierten, weil diese in überschwänglichem Reichtum lebten und nichts gegen die Angriffe der Zirkoner, unserer Nachbarnation, unternahmen. Die Gem Men in den obersten Ämtern der Großen Zwanzig (die sich aus den weisesten Männern und Frauen eines jeden Volkes zusammensetzen), versuchten zwar, die Rebellion und den herrschenden Unwillen unter den Stämmen einzudämmen, aber das gelang ihnen nur mäßig. Die Völker brauchten dringend die Unterstützung der Königshäuser. Alleine würden sie sich nicht dauerhaft gegen die Übergriffe wehren können. Es standen ihnen einfach nicht die zur Verteidigung notwendigen Mittel und Waffen zur Verfügung, mit denen die Könige dienen könnten. Viele der Gem Men lebten in Angst und Schrecken vor den Angriffen der Zirkoner, unserer brutalen und unbarmherzigen Nachbarnation, die unter der Herrschaft ihres machthungrigen Anführers Zirkon Gem Men gefangen nahmen und ermordeten. Ich war ihm zwar bislang noch nie begegnet, aufgrund seines grauenvollen Rufes jedoch war meinerseits ein gemeinsames Zusammentreffen in meinem persönlichen Terminkalender auch nicht vorgesehen. Zirkoner gehörten nicht zu den Gem Men, da sie sich nicht so wie wir, als 'Edelsteinmenschen' bezeichnen konnten. Ihre Herzen waren weder echt noch rein.
Das größte aller Probleme aber war, dass die Zirkoner äußerlich sehr den Diamanten, meinem Volk, ähnelten. Manche von ihnen sahen uns wirklich zum Verwechseln ähnlich, so dass selbst wir Diamanten innerhalb unserer eigenen Stämme manchmal nicht sicher sein konnten, ob wir gerade Freund oder Feind vor uns hatten. Um wirklich sicher zu sein, müssten wir den Fremden berühren, aber das traute sich seit den vielen Morden selbstverständlich keiner mehr. Anfangs, als das Töten begann, hatten die Zirkoner es sich sogar zu ihrem Vorteil gemacht, dass sie uns so gleich sahen. Um näher an mehrere Gem Men heranzukommen, gaben sie sich einfach als Mitglieder unseres Volkes aus. Denen, die ihnen zum Opfer fielen, offenbarte sich ihr wahres Gesicht erst, als es bereits zu spät war. Diese Tatsache machte es natürlich umso gefährlicher für alle Gem Men, da man den Widersacher nur schwerlich von den eigenen Mitgliedern seiner Nation unterscheiden konnte. Die logische Konsequenz, die die anderen Völker daraus gezogen hatten, war, dass das Volk der Diamanten aus Angst vor Übergriffen verstoßen wurde. Kamen wir auch nur in die Nähe eines anderen Stammes, gerieten dessen Angehörige sofort in Panik oder griffen uns gar an. Seither war mein Stamm, mein gesamtes Volk, auf der Flucht. Wir versteckten uns in Wäldern und in den Bergen, um keine Aufstände zu riskieren. Allerdings enthielten die anderen Völker uns auch die lebensnotwendigen Nahrungsmittel und Rohstoffe, die wir dringend zum Bauen von robusten Behausungen benötigten, vor.
Ich hörte Talek empört schnaufen. Mit seiner linken Hand raufte er sich die zerzausten Haare.
»Es ist so unfair, Gwyn!«, flüsterte er frustriert und ich konnte sehen, dass es ihm wirklich ernst war mit dem, was er sagte.
»Viele von uns haben viele von euch gekannt. Waren miteinander befreundet. Wir wissen, dass ihr niemandem etwas antun würdet. Wir wissen auch, welchem Volk ihr angehört. Warum dürfen wir euch dann kein Asylgewähren?«
Ich seufzte resigniert. Das war in der Tat eine gute Frage. Meine Familie beispielsweise war in der Vergangenheit tatsächlich ziemlich gut mit Taleks Familie befreundet gewesen. Meine Mutter kam sogar aus ihren Reihen. Sie war auch Türkiserin gewesen.
Aber da die Angriffe der Zirkoner sich in den letzten zehn Jahren beinahe verdoppelt hatten, ordneten die Rubiner sogar an, dass es aufs Strengste verboten war, jegliche Individuen unseres Aussehens innerhalb der Stadtmauern zu lassen. Man sollte einen großen Bogen um uns machen und durfte nicht einmal mit uns sprechen. Jeder Verstoß dagegen wurde geahndet und hart bestraft. Der Sinn dahinter blieb mir allerdings verschlossen.
Warum riskierte man das Verhungern und damit Aussterben eines ganzen Volkes, wenn man doch eigentlich wusste, dass wir unschuldig waren?
Ich zuckte mit den Schultern.
»Nicht jeder kennt jeden«, versuchte ich, mir eine Erklärung zurechtzulegen, die einigermaßen plausibel klang. Auch wenn das keine Entschuldigung für das Leid war, das meinem Volk mutwillig zugefügt wurde.
»Die Rubiner wollen kein Risiko eingehen. Zudem wäre es ebenso unfair denjenigen unseres Stammes gegenüber, die nirgendwo unterkommen, nur weil sie nicht mit jemandem aus einem der anderen Völker befreundet waren.«
Talek schüttelte heftig den Kopf. Er wirkte aufgebracht.
»Aber wir dürfen doch nicht die Unsrigen für etwas bestrafen, unter dem wir alle leiden! Ihr am allermeisten. Die Stämme werfen euch den Löwen zum Fraß vor, wenn sie euch aussetzen. In den Wäldern seid ihr dem Feind doch hilflos ausgeliefert ohne den Schutz der Allgemeinheit!«
»Jetzt unterschätzt du mein Volk aber. Wir können schon selbst auf uns aufpassen! Und auf die Hilfe eurer ach so tollen Rennleitung können wir gut und gerne verzichten!«, entgegnete ich etwas schnippischer als gewollt. 'Rennleitung' war eine ironische Anspielung von mir auf das Volkder Amethysten gewesen. Ihre Stämme waren sehr auf Ordnung bedacht und verhielten sich ein wenig so, wie eine Art inoffizielle Polizei der Gem Men. Sie arbeiteten eng mit den Rubinern zusammen und gaben ihr Bestes, die Krawalle und Rebellenübergriffe auf die Königshäuser unter Kontrolle zu bringen. Ich konnte sie nicht besonders gut leiden. Was waren das für Ordnungshüter, die feige kniffen, wenn nachts die Zirkoner durch unser Land strichen und unzählige Gem Men entführten oder töteten? Meist kamen die Feinde bei Einbruch der Dunkelheit, schlichen dann um die Stadtmauern herum und überfielen ahnungslose Gem Men, die spät von der Arbeit kamen.
Oder sie lauerten ihnen im Wald oder an den Grenzen zu den Sperrgebieten (wie wir die Ländereien nannten, auf denen Zirkon und seine Untertanen ihr Domizil hatten) auf.
Aber in gewisser Weise musste ich Talek recht geben. Uns Diamanten hatte es in den letzten Monaten sehr häufig getroffen.
Dass wir zumeist in den Wäldern unsere Lager errichten mussten, war von großem Nachteil. Ohne den effektiven Schutz einer Stadtmauer oder einer größeren Nachbarschaft war es für die Zirkoner ein Leichtes, uns zu überfallen. Das hatte schon einige von uns das Leben gekostet und war auch der Grund, warum wir nie lange an einem Ort verweilten, sondern häufig unsere Lagerplätze wechselten.
Talek verzog den Mund, woraufhin ich leise kicherte.
»So hatte ich das auch nicht gemeint«, sagte er zerknirscht.
»Ich weiß, dass ihr nicht ganz hilflos seid. Du alleine hast wahrscheinlich Mumm genug für euch alle!«
»Haha! Schön, dass du das so siehst!«
Talek grinste frech.
»Ich habe nicht vergessen, wie du mich damals vor dem wilden Kerchenschwein im Wald gerettet hast.«
»Oh Gott, ist das ewig her! Fast zehn Jahre, oder?«
Es wunderte mich, dass er sich an dieses Ereignis noch erinnern konnte. Ich jedenfalls hatte es schon lange vergessen, bis Talek es jetzt erwähnte. Wir mussten acht Jahre alt gewesen sein, als es passiert war. Ein Kerchenschwein war eine Art weiterentwickelter Nachfahre des ausgestorbenen Wildschweines, nur ein gutes Stück größer und viel aggressiver, wenn man es in freier Wildbahn antraf. Taleks Eltern hatten uns damals zum Sammeln von Spinnenseide in den Wald geschickt und Talek war unglücklicherweise einem sehr angriffslustigen Exemplar über den Weg gelaufen.
»Weißt du noch?«, fragte Talek lächelnd »Als es auf mich losgegangen ist, hast du dich einfach auf einen Ast geschwungen und dem Schwein von oben deinen Korb mit der bereits gesammelten Spinnenseide über den Kopf geworfen, als wir unter dir durch gerannt sind! So hat es nicht mehr gesehen, wohin es lief, und ist mit voller Wucht gegen einen Baumstamm geknallt!«
Bei dieser Erinnerung mussten wir beide schmunzeln. Es war schön, wieder einmal mit jemandem reden zu können, der nicht aus den eigenen Reihen stammte und den man nicht tagtäglich um sich hatte. Bisher hatte ich gar nicht wirklich gemerkt, wie sehr ich das vermisst hatte.
»Du warst noch nie besonders ängstlich«, meinte Talek und mit einem Blick auf die Tür hinter ihm fügte er flüsternd hinzu »und auch nie besonders vorsichtig! Wenn jemand die zwei schlafenden Wachen da draußen findet, fliegst du auf.«
Ich zuckte erneut mit den Schultern.
»Wer nicht wagt, der nicht gewinnt«, erwiderte ich leichthin und machte mich vor seinen Augen daran, meinen zur Hälfte gefüllten Sack weiter mit Hirse zu füllen.
Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie Talek die Augen verdrehte und tief die Luft einsog.
»Ich glaube nicht, dass ich das jetzt tue«, seufzte er dann in gedämpftem Tonfall und bückte sich nach dem anderen noch leeren Leinensack. Er kniete sich neben mich auf den staubigen Boden des Lagerhauses und begann damit, Mais ins Innere des Beutels zu schaufeln.
Ich neigte meinen Kopf zur Seite und lächelte ihn dankbar an. Talek erwiderte mein Lächeln und wir verrichteten im Eiltempo unsere Arbeit. Als beide Säcke bis zum Rand voll waren, band ich sie mit einem Stück Schnur oben ab und griff nach dem Rucksack mit den Botas. Dann schnürte ich die Säcke zu beiden Seiten des Rucksacks fest und schulterte das nun nicht mehr ganz so leichte Gepäck. Am Anfang taumelte ich etwas nach hinten und Talek griff erschrocken nach meinen Armen, um mich zu stützen.
Für einen Augenblick leuchtete ein winziger Teil meines und der größte Teil seines linken Handgelenkes auf. Bis ich ihm zögerlich meine Hände entriss. Das Leuchten erstarb. Auch Talek hatte unsere Herzen betrachtet. Ein trauriges Lächeln breitete sich nun auf seinem Gesicht aus.
»Ich wünschte, es wäre wieder alles wie früher«, sagte er leise und seine karamellbraunen Augen blickten dabei tief in meine eigenen eisblauen.
Ich spürte das Herz in meinem Handgelenk warm pulsieren und schluckte schwer.
»Ich auch«, gab ich zu und wandte mich dann von meinem besten Freund ab, um in Richtung Tür zu gehen, bevor mir noch schmerzhafter bewusst wurde, was ich verloren hatte. Was ein jeder von uns verloren hatte.
»Vielen Dank noch mal, dass du mich nicht verraten hast!«, flüsterte ich im Vorbeigehen.
Talek sprintete hinter mir her und hielt mir die Tür auf, nachdem er sich zuvor noch einmal vergewissert hatte, dass die Luft rein war.
»Ich muss dich wiedersehen, Gwyn! Jetzt, wo ich dich wiedergefunden habe, möchte ich dich nicht noch einmal aus den Augen verlieren!«, raunte er mir noch eindringlich zu, ehe ich mich aus dem Staub machen konnte.
Ich musste kurz darüber nachdenken. Ich wollte Talek auch wiedersehen. Aber war das schlau? Immerhin hatte ich gerade seinen Stamm bestohlen. Außerdem würden wir jedes Mal einen Aufstand riskieren, wenn wir uns heimlich trafen. Wenn irgendjemand aus seinem oder aus einem der anderen Stämme dahinter käme, würde das schwerwiegende Konsequenzen für uns beide nach sich ziehen. Andererseits hatte ich es jetzt auch schon so oft geschafft, mich heimlich aus unserem Lager zu schleichen und andere Gem Men zu bestehlen, ohne dass es überhaupt jemandem aufgefallen war.
»Kennst du den kleinen See, ein paar Kilometer von hier im Wald, an dem der letzte Mammutbaum wächst?«, fragte ich Talek. Er nickte kurz zur Bestätigung.
»Okay. Morgen früh um halb sechs. Kurz bevor die Sonne aufgeht, treffen wir uns dort. Sei da!«, wies ich ihn an.
Talek strahlte.
»Darauf kannst du dich verlassen!«
»Gut«, meinte ich dann und versuchte, eine ausdruckslose Miene vorzutäuschen, aber ich glaubte, er konnte meine Vorfreude ebenfalls spüren.
Ich drehte mich um und setzte mich, so schnell es die Last auf meinem Rücken zuließ, in Bewegung. Ich steuerte auf die Mauer vor mir zu und hatte sie noch nicht ganz erreicht, als ich ihn hinter mir noch einmal leise rufen hörte.
Als ich mich Talek erneut zu wandte, sah ich ihn einige Meter hinter mir mit den nackten Füßen im frühmorgendlich feuchten Gras stehen.
»Ja?«, hauchte ich leise, um nicht doch noch die Aufmerksamkeit irgendeines anderen Türkisers auf mich zu ziehen.
»Eines würde mich noch interessieren«, meinte Talek grinsend, die Hände lässig in den Hosentaschen vergraben.
»Wie hast du es eigentlich geschafft, dass zwei unserer stärksten Männer schlafend wie zwei Babys auf dem Boden liegen?«
Ein vielsagendes Lächeln schlich sich auf mein Gesicht, während ich in meine Jackentasche griff und ihm anschließend die Ampulle mit den Samenkörnern zuwarf. Geschickt fing er sie auf.
»Ich rate dir, den Inhalt nur zu berühren, solltest du abends mal überhaupt nicht einschlafen können!«, sagte ich geheimnisvoll und ließ damit einen völlig verdutzten Talek zurück.
ZWEITES KAPITEL
Ich erreichte unser Lager, noch bevor sich die Sonne ihren Weg durch den Nebel erkämpft hatte, der sich morgens vor allem im Wald hartnäckig hielt und in dichten Schwaden um die Baumkronen waberte. Unseren aktuellen Rastplatz hatten wir vor knapp einer Woche aufgesucht. Er befand sich auf einer kleinen, von hohen Tannen geschützten Lichtung. In der Regel wechselten wir der Sicherheit wegen etwa alle drei bis vier Wochen unseren Aufenthaltsort. Im Umkreis von wenigen Kilometern hatten außer den Türkisern noch die Stämme der Quarze, der Turmaline und der Citrine ihren festen Wohnsitz und wir wagten es nicht, das Risiko einzugehen, dass uns einer von ihnen entdeckte.
Gott sei Dank bot der Red Wood Forest, der vor einigen hundert Jahren vor der Entstehung unserer Art einmal ein größerer Nationalpark gewesen sein sollte, mit einer Fläche von etwa vierhundert Quadratkilometern sehr viel Platz zum Umherziehen. Damit war er zwar bei Weitem nicht mehr so groß, wie er es einmal gewesen war – das zu beklagende Resultat des menschlichen Wütens auf La Neonada und des damit verbundenen Klimawandels – konnte bisher aber dennoch mit genügend Versteckmöglichkeiten für uns aufwarten. Zum Red Wood gehörten auch ein naturbelassener Küstenstreifen und ein kleines Gebirge, das in früherer Zeit bekannt für seinen Bestand an Mammutbäumen, den größten aller Bäume dieses Planeten, gewesen war. Meist blieb mein Stamm jedoch im Inneren des Waldes, da die Küstenregionen – vor allem die zerklüftete Kliffküste – von einem Großteil des Perlmuttvolkesbesiedelt wurde, das neben den Perlen und den Korallen der Meeresbevölkerung angehörte. Doch während die Stämme der Perlen und Korallen zumeist in Behausungen unter Wasser lebten, bevorzugten die Perlmutter das Leben an Land. Sie wohnten in kleinen Familien- und Wohngemeinschaften in Hütten am Strand, einige wenige in nicht gefluteten Unterwasserhöhlen. Dabei dehnten sich ihre Siedlungsgebiete von den Westküsten Nordamerikas über den Golf von Mexiko bis hin nach China und Japan aus.
Ein Großteil unseres Stammes war schon auf den Beinen. Als ich mich dem Lager näherte, hörte ich schon aus einiger Entfernung das Geplänkel unserer Jüngsten beim Spielen und das laute Geräusch von aufschlagenden Hämmern und Äxten, da man bereits das Holz für unseren nächsten Umzug in ein paar Wochen bearbeitete.
Der Wald bot meinem Volk das Baumaterial für unsere zeitlich begrenzten Behausungen. Unser Lebensstil orientierte sich nämlich zu großen Teilen an dem der menschlichen Urvölker, die schon vor abertausenden von Jahren hier im Red Wood gelebt hatten. Immer, wenn wir uns an einem anderen Platz niederließen, gingen wir gemeinsam auf die Suche nach brauchbaren Zedernstämmen und anderem Holz, welches unsere Männer dann zu Planken spalteten. Zusammengehalten wurden die Wände der provisorischen Häuser durch die mehrfache Bindung von Seilen und Spinnenseide. Kleine, runde mit Balken verstärkte Öffnungen in den Konstruktionen bildeten die Eingänge zu unseren Häusern. Während diese die Ureinwohner des Waldes hauptsächlich vor den Angriffen wilder Tiere schützen sollten, gaben sie uns ein wenig das Gefühl von Sicherheit vor den Zirkonern, von denen manchmal leider auch ein paar in die Tiefen des Waldes ein- und zu uns vordrangen.
Ich schlich mich, unbemerkt von ein paar Frauen, die gerade dabei waren aus Wurzeln robuste Körbe zum Sammeln von Beeren und Spinnenseide zu flechten, geduckt hinter drei Hütten zu unserem Vorratslager. Es war ebenfalls ein kleines, aus Holzscheiten erbautes Haus, keine zehn Meter entfernt von dem, in welchem ich zusammen mit meinem Vater und meinem älteren Bruder Korsak wohnte. Da mein Vater mit neunzehn Jahren zu unserem Stammesoberhaupt ernannt worden war, wurden die Vorräte des gesamten Clans unserer Familie anvertraut und daher stets in unserer Nähe aufbewahrt. Daran hatte auch unser zwangsläufiges Nomadendasein nichts geändert.
Leise öffnete ich das aus stabilem Bambus erbaute Gatter, das den Eingang zum Vorratshaus versperrte, und huschte ins Innere.
Dort befand sich ein nicht ganz so reichhaltiges Angebot an Verpflegung, wie es zuvor bei den Türkisern der Fall gewesen war.
Unser Lagerbestand war im Vergleich zu dem der anderen Völker eher kläglich, zur Zeit aber noch recht in Ordnung. Wir hatten auch schon schlimmere Zeiten durchgemacht. Im Sommer vor zwei Jahren beispielsweise. Eine längere Trockenperiode hatte nicht nur uns selbst, sondern auch der Tier- und Pflanzenwelt, von der wir unsere Nahrung bezogen, schwer zugesetzt. Die Temperaturen auf La Neonada waren seit Beginn unserer Existenz höher gewesen als in der Zeit davor, eine langwierige Folge des damaligen Klimawandels. Und die Umwelt hatte sich auch, so gut es ging, an die tropischen Temperaturen angepasst, aber wenn diese dann doch einmal auf bis zu fünfundvierzig Grad hochkletterten – und das über eine Zeitspanne von mehreren Wochen – war das ein ernsthaftes Problem. Die anderen Völker hatten während dieser Zeit auf die Bestände der vergangenen Monate zurückgreifen können, die sie auf Middle Island gelagert hatten.
Mein Stamm aber musste alleine zusehen, wie er zurechtkam. Damals, als ich sah, wie viele von den geliebten Gem Men, an denen ich so sehr hing, mit dem Tod rangen, kam ich dann auf die Idee mit dem 'Borgen'. Ich sah nicht ein, dass sich der Rest unserer Nation gegenseitig half, während man uns im Stich ließ.
Bei dem Gedanken an diese Ungerechtigkeit pfefferte ich meinen Rucksack wütend in eine Ecke neben einen Sack voll Bambussprossen. Meist versteckte ich die Sachen, die ich mitbrachte, etwas weiter hinter den Rohstoffen, die sich unser Stamm selbst beschaffte. Anfangs hatte ich gehofft, dass meine kleinen Raubzüge auf diese Weise nicht ganz so extrem auffallen würden, was offensichtlich auch sehr gut funktionierte. Bisher schien sich noch niemand darüber zu wundern, woher eigentlich immer die zusätzlichen Lebensmittel kamen. Vermutlich war man einfach glücklich darüber, dass genügend Verpflegung vorhanden war, um die ganzen hungrigen Mäuler in unserer Gemeinschaft zu stopfen.
Da war die Frage nach dem 'Woher' dann auch nicht mehr so wichtig. Gute Dinge hinterfragte man nicht, man war dankbar dafür.
Ich verstaute meine heutige Beute hinter dem Sack mit den Bambussprossen, schnappte mir meinen leeren Rucksack und schlich mich leise wieder zum Eingang. Wenn es möglich war, würde ich mich jetzt noch ein wenig hinlegen und schlafen, bevor ich mich nachher bei der Arbeit im Lager nützlich machen musste. Ich schlüpfte hinaus und verschloss hinter mir sorgfältig das Gatter. Dann drehte ich mich herum, um zum Hintereingang unserer Hütte zu huschen, und rannte geradewegs in eine hinter mir stehende Person hinein. Zusammen gingen wir zu Boden und landeten auf dem erdigen Waldboden.
»Autsch!«, fluchte ich leise, wohl aber eher aus Reflex, als dass ich mir tatsächlich weh getan hätte. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass sich mir jemand genähert hatte.
Als ich zur Seite sah, blickte ich in ein mir nur allzu vertrautes Gesicht. Auch die neben mir am Boden liegende junge Frau schien auf unseren Zusammenprall nicht vorbereitet gewesen zu sein.
Vermutlich hatte sie damit gerechnet, dass ich sie frühzeitig entdecken und stehen bleiben würde.
»Wozu die Eile?«, sarkastisch zog meine beste Freundin auf die ihr eigene Art die linke Augenbraue hoch und sah mich tadelnd an, während sie sich mit ihren Ellenbogen auf dem Boden abstützte.
Ich stieß einen gedehnten aber erleichterten Seufzer aus (erleichtert, weil es nur sie war, die mich dabei beobachtet hatte, wie ich mich sehr verdächtig früh morgens aus unserem Vorratshaus schlich). Es war vielleicht nicht ganz richtig, dass es niemanden wirklich zu interessieren schien, woher der Zusatz an Vorräten kam. Mynna war mir bereits nach meinem vierten Raubzug auf die Schliche gekommen, als sie mich in flagranti dabei erwischt hatte, wie ich mich mitten in der Nacht, ausgerüstet mit einem Rucksack, aus dem Lager schleichen wollte. Ich hatte es damals nicht übers Herz gebracht, meine beste Freundin zu belügen. Also hatte ich ihr die Wahrheit über meine heimlichen Ausflüge gebeichtet und obwohl sie nicht gerade begeistert darüber zu sein schien, hatte sie mir im Gegenzug dafür versprochen, Stillschweigen zu bewahren.
»Weil ich nicht zu spät zum Frühstück kommen möchte. Was denkst du denn? Korsak ist dreimal so gefräßig wie dein kleiner Bruder. Weißt du, wie schwer es ist, einigermaßen satt zu werden, wenn ein solcher Nimmersatt neben dir am Tisch sitzt?«, gab ich die meiner Meinung nach zu ihrer Frage passende Antwort und grinste frech dabei.
Mynna rümpfte ihre zierliche, weiße Nase und bemühte sich darum, streng dreinzublicken. Ich aber blieb unbeeindruckt und rappelte mich stattdessen auf, um mir den Staub von den Kleidern zu klopfen. Meine Freundin tat es mir gleich und begann gleichzeitig damit, ihre Strafpredigt auszubauen.
»Gwyn! Ich suche dich schon eine Ewigkeit! Dein Vater hat bemerkt, dass du nicht mehr in deinem Bett gelegen hast und mich gefragt, ob ich weiß, wo du steckst, weil er dich nicht finden kann!«
»Mist!«, ich biss mir auf die Unterlippe. Das war allerdings ein Problem.
Mynna nickte aufgebracht, konnte jedoch nicht verhindern, dass sich ein kleines, selbstzufriedenes Lächeln auf ihre Lippen schlich. Sie liebte es, mir mit Ich habe es dir gleich gesagt-Sätzen auf die Nerven zu gehen.
»Und was hast du ihm gesagt?«
»Dass du vorhattest, früher in den Wald zu gehen, um Spinnenseide zu sammeln. Dann hätten wir später mehr Zeit am See.
Er hat zwar etwas skeptisch gewirkt, aber ich glaube, letztendlich hat er es mir abgekauft«, sagte Mynna und strich sich geistesabwesend eine ihrer weißblonden Haarsträhnen hinters Ohr.
Beruhigt atmete ich aus. Auf meine Freundin war eben Verlass.
»Dankeschön«, meinte ich und umarmte sie.
Mynna versteifte sich unter meiner ehrlich gemeinten Geste.
Ich wusste, dass das Kapitel für sie noch nicht ganz abgeschlossen war. Eine der nervigsten Eigenschaften meiner besten Freundin war ihre Sturheit. Ihrer Meinung nach neigte ich des Öfteren zu 'leichtsinnigen Aktionen' und sie machte es sich dann zur Aufgabe, mich dafür zu rügen. Dabei konnte ich ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ich brauchte niemanden, der sich Sorgen um mich machte.
»Gwyn«, hörte ich sie leise an meinem Ohr sagen. Der strenge Unterton in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
Sachte schob sie mich von sich und sah mich ernst an.
»Du weißt, dass ich dich nicht immer decken kann, wenn du verschwindest. Irgendwann wird es ihnen auffallen. Zudem möchte ich unsere Familie nicht belügen.« Mit unserer Familie meinte sie all unsere Stammesmitglieder. Das Volk der Diamanten lebte, seit es vor etwa zehn Jahren verstoßen worden war, verstreut vorwiegend über den nord- und südamerikanischen Kontinent. Alle waren wir auf der Flucht, versuchten, uns möglichst unsichtbar zu halten, und lebten daher sehr zurückgezogen. Mehrere kleine Gemeinschaften hatten sich gebildet. Manche so klein, dass man sie nicht einmal mehr als einen eigenen Stamm bezeichnen konnte. Das waren dann Gruppen von zehn oder fünfzehn Personen, die sich beispielsweise aus zwei befreundeten Familien zusammensetzten. Unser Stamm war einer der größeren, die noch übrig geblieben waren, während sich die meisten Diamantenstämme gesplittet hatten, um so weniger Aufsehen zu erregen.
Kleinere Gruppen von Gem Men fielen beim Umherziehen weniger auf und waren auf diese Weise gleichzeitig auch eine kleinere Zielscheibe für die Zirkoner. Mit uns lebten noch sieben Familien im Lager. Zusammen waren wir knapp vierzig Gem Men. Was auch nicht besonders viele waren. Jeder kannte jeden, daher verhielten wir uns eigentlich auch wie eine ganze, große Familie.
Mynna und ihre Familie waren vor fünf Jahren zu uns gestoßen, als wir von Oregon nach Kalifornien gezogen waren. Damals hatten wir unsere Lager noch im um einiges größeren Modoc Forest bezogen, der vor Millionen von Jahren einmal unter einem gigantischen Lavafluss begraben worden war und dessen mineralhaltiges Gestein sehr gut für unseren Gesundheitszustand war. Da sich mit der Zeit jedoch wieder vermehrt Menschengemeinschaften gebildet, und ihre Siedlungen dort erbaut hatten, waren wir nach Kalifornien weitergezogen. An der kalifornischen Grenze waren wir dann auf Mynna, ihre Mutter und ihren kleinen Bruder Basta getroffen. Auch sie befanden sich gerade auf der Durchreise. Mynnas Vater war damals kurz zuvor von einer Gruppe Zirkoner erfasst worden, die an der Grenze herumgelungert hatten.
Mynna hatte mir eines Nachts in einer vertrauten Minute erzählt, dass ihr Vater es geschaff thatte, seine Familie rechtzeitig vor den Feinden hinter ein paar großen Felsen zu verstecken, war dann aber noch einmal zurückgekehrt, um die Zirkoner von ihnen fortzulocken. Dabei war er ihnen dann selbst zum Opfer gefallen. Sie hatten ihn nicht einmal mit sich in die Sperrgebiete genommen, sondern ihn direkt an Ort und Stelle mit dem Aufspürer geprüft und danach getötet. Die arme Mynna und ihre Familie hatten es aus der Entfernung hilflos mit ansehen müssen. Mynna fühlte sich schuldig, weil sie damals nichts unternommen hatte, um ihren Vater vor dem Tod zu bewahren. Ich hatte ihr schon so oft zu erklären versucht, dass sie gar keine andere Wahl gehabt hatte, als sich hinter dem Felsen zu verstecken. Andernfalls wäre auch sie heute nicht mehr am Leben. Aber ihre Schuldgefühle konnte ich ihr damit dennoch nicht nehmen. Wenn sie in unserem Beisammensein manchmal plötzlich verstummte und traurig ins Leere blickte, dann wusste ich, dass sie wieder einmal an ihren Vater dachte, der so heldenhaft für seine Familie gestorben war. Darüber reden wollte sie jedoch in den wenigsten Fällen.
Vom ersten Augenblick an als wir uns begegnet waren, hatten Mynna und ich uns gut verstanden und waren seitdem unzertrennlich. Für unseren Stamm war es gar keine Frage, dass wir Mynnas Familie in unsere Gemeinschaft mit aufnehmen würden.
Und ich war froh, dass es so gekommen war.
Auch wenn Mynna mich in diesem Moment ansah, als würde sie mich am liebsten einmal quer durch einen Bottich voll Milch ziehen und mich dann einem ausgehungerten Katzenvolk vor die Füße werfen wollen.
»Jetzt mach doch kein solches Drama daraus! Dann werde ich halt in Zukunft noch früher losgehen, so dass mein Vater gar nicht erst auf die Idee kommt, nachzusehen, ob ich noch schlafe«, winkte ich ab und wandte mich zum Gehen.
Ich hörte meine Freundin hinter mir empört nach Luft schnappen.
»Du verstehst überhaupt nicht, worum es mir eigentlich geht, oder? Es ist so oder so gefährlich für uns, sich in die Städte anderer Völker zu schleichen. Und rechtens ist es schon gar nicht, sie zu bestehlen!«, schimpfte sie erregt und lief im Eiltempo neben mir her, um mit mir Schritt halten zu können. Für den Moment wollte ich einfach nur noch schnell in unsere Hütte und eine Runde schlafen.
»Also erstens, brauchst du dir absolut keine Sorgen um mich zu machen. Ich bin stets vorsichtig und noch nie beim 'Borgen' erwischt worden.« Gut, das entsprach nicht ganz der Wahrheit, aber den heutigen Zwischenfall mit Talek ließ ich in Mynnas Gegenwart lieber unausgesprochen. Ich wollte ihr nicht noch mehr Grund zur Aufregung geben.
»Und zweitens«, setzte ich meinen Rechtfertigungsversuch fort »ist es ja wohl viel ungerechter von den übrigen Völkern, uns wie Verbrecher und Aussätzige zu behandeln. Zudem habe ich mir im Prinzip auch nur genommen, was Korsak und mir zusteht. Na ja, heute zumindest«, endete ich trotzig.
Mynna seufzte resigniert. Ich wusste, dass sie es nun höchstwahrscheinlich dabei belassen würde. Ich hatte die 'toter Elternteil-Karte' ausgespielt. Denn so, wie sie nicht gerne über ihren Vater redete, wollte auch ich nicht öfter als nötig an das Schicksal meiner Mutter denken. Mynna wusste, dass meine Mutter einst Türkiserin gewesen war, bis sie meinen Vater geheiratet hatte und dadurch in den Kreis der Diamanten aufgenommen worden war.
Heirateten zwei Mitglieder verschiedener Völker, so verließ traditionelldie Frau (oder bei gleichgeschlechtlichen Paaren der jüngere Partner) ihr Volk und wurde in das ihres Mannes mit eingegliedert. Allerdings nur symbolisch, ihr Herz war natürlich immer noch mit dem Volk ihrer Herkunft verbunden. Und bekam ein solches Paar, bestehend aus zwei reinen, jedoch verschiedenen Gem Men, Kinder, handelte es sich bei diesen dann um Halbedelsteine, sogenannte 'Halblinge'. Derlei Kinder waren zwar äußerlich sehr schön anzusehen, wurden von den Zirkonern aber als weniger wertvoll erachtet als ihre reinherzigen Eltern. Unter uns Gem Men spielten Genvermischungen dieser Art keine besondere Rolle. Aufgrund der Tatsache, dass unser Vater ein gebürtiger Diamant und unsere Mutter vor ihrer Hochzeit eine Angehörige des Türkiser Volkes gewesen war, waren mein Bruder Korsak und ich solche Halblinge. Gefürchtet wurden wir von den anderen Völkern jedoch genauso, wie die Kinder zweier reinherziger Diamanteneltern, da Kinder unserer Nation immer das Aussehen des Vaters vererbt bekamen. Natürlich bekam man auch von Seiten der Mutter gewisse Merkmale. Das konnten beispielsweise formgebende Merkmale, wie (im schlechten Fall) eine krumme Nase oder ein paar zu eng beieinanderliegende Augen sein. Wenn man wiederum Glück hatte, konnte es sich dabei aber auch um eine süße Stupsnase oder ein niedliches Muttermal auf der rechten Pobacke handeln. Die Veranlagung für ein gutes Hautbild oder eine Verlangsamung des Alterungsprozesses hatten wir jedoch alle.
Denn die prägnanten, ausschlaggebenden Charakteristika, die für unser allgemeines Aussehen verantwortlich waren, bekamen wir eben immer von der väterlichen Seite des Elternpaares vererbt.
Und jedes Volk in der Gem Nation hatte seine eigenen, ganz individuellen Merkmale. So konnte man, wenn man beispielsweise auf einen Gem Man traf, der eine im Sonnenlicht bunt schillernde Haut sowie silbernes Haar und matt glänzende Lippen besaß, mit Sicherheit davon ausgehen, dass er dem Volk der Perlmutter angehörte. Oder die Rubiner, die mit ihren roten, glatten Haaren und den markanten Gesichtern ein von Natur aus eher strenges Aussehen hatten. Die Lapislazuli, von denen die meisten auf dem osteuropäischen Kontinent in Russland lebten, waren von jeher groß gewachsen, amazonenhaft schlank und trugen lange, blaue Haare. Diese Äußerlichkeiten wurden stets vom Vater zum Kinde weitergetragen. Das bedeutete, dass auch Korsak und ich mit unserem weiß blonden Haar und den eisblauen Augen, den feindlichen Zirkonern zum Verwechseln ähnlich sahen.
»Ich wünschte dennoch, dass du langsam etwas verantwortungsvoller handeln würdest und nicht andauernd mit deinem hübschen Kopf durch die Wand wolltest. Wir sind jetzt achtzehn, Gwyn. Da sollten wir uns auch altersentsprechend verhalten. Deine Unternehmungen sind mehr als riskant. Ich bin sicher, dass dir ein jeder von uns hier dankbar wäre, wenn er wüsste, wieso wir nicht kurz vor dem Hungertod stehen. Deine Gefangenschaft oder Schlimmeres – an das ich jetzt nicht einmal denken möchte –wenn du erwischt würdest, nützte aber auch niemandem!«
Mynna war stehen geblieben und sah mich aus sorgenvollen Augen an. Auch die ihrigen hatten die Farbe von schmelzenden Gletschern.
Als ich nichts auf ihre Rede erwiderte, seufzte sie tief.
»Ach Gwynnie! Ich mache mir doch nur Sorgen um dich!«
Nun seufzte auch ich und verdrehte zugleich die Augen. Wie konnte ich bei einer so einfühlsamen Freundin kalt bleiben?
»Das weiß ich doch, Mynna. Aber wie gesagt, dazu hast du keinen Grund. Ich gebe auf mich acht. Versprochen. Das habe ich schon immer getan.«
Meine Freundin zog, wie schon zuvor, ihre linke Augenbraue hoch. Doch dann nickte sie.
»Gut. Dann lasse ich dich jetzt 'frühstücken' gehen, bevor du gar nichts mehr abbekommst. Wir wissen beide, wie schlecht gelaunt du bist, wenn du Hunger hast. Nicht wahr?« Ironisch schürzte sie die Lippen, was mich zum Lachen brachte.
»Wo sie recht hat, hat sie recht«, sinnierte ich und streckte beteuernd den Zeigefinger meiner rechten Hand in die Höhe. Auch Mynna grinste, als ich zum Abschied winkte und endlich zum Hintereingang unserer Hütte lief.
Eine kleine, mit Holzscheiten verstärkte Öffnung in der hinteren Hälfte unserer Hütte führte direkt in den Hauptraum. Sozusagen unser Wohnzimmer, wenn man es so nennen wollte. Im Prinzip war das auch schon der größte Teil unseres Heims. Denn außer dem gemeinsamen Wohnbereich gab es nur noch drei kleinere Kabinen ähnliche Abteile, die mittels dreier Bärenfelle, die von quer in der Dachkonstruktion verankerten Stöcken herunter hingen, unsere 'Schlafzimmer' vom Rest des Hauses abtrennten. Jede Familie hatte ihr eigenes Standardinventar, das sie bei jedem Ortswechsel mitnahm und dann für die nächsten paar Wochen wieder in ihrem Wohnbereich aufstellte. Sanitäre Bereiche gab es im Inneren unserer Hütten nicht, das Verlegen von Wasserrohren oder Bauen von Toiletten lohnte sich für uns aufgrund der häufigen Umzüge ebenso wenig, wie eine feste Küchenzeile. Wer sich gründlich waschen wollte, musste dies in einem Fluss oder kleineren See erledigen, in deren Nähe wir möglichst immer versuchten, unsere Lager zu beziehen. Wer dem Ruf der Natur Folge leisten musste, ging einfach etwas tiefer in den Wald. Das Kochen übernahm alle zwei bis drei Tage eine andere Familie aus unseren Reihen. Üblicherweise bereitete diese dann das Essen für den gesamten Stamm zu. Meist kamen wir alle abends in der Mitte unseres Lagers zusammen und aßen gemeinschaftlich, während wir uns die neuesten Ereignisse erzählten oder Vorhaben besprachen.
Mein Schlafbereich befand sich, wenn man die Hütte von hinten betrat, gleich zur Linken und ich schlüpfte schnell hinter das davor hängende Bärenfell, um mich dann auf eine am Boden liegende Schicht aus Stofflaken fallen zu lassen, die wiederum auf einen Haufen Stroh gespannt war. Schnell schlüpfte ich noch aus meiner khakifarbenen Tarnjacke und ließ sie unter dem Stroh verschwinden. Dann schloss ich erschöpft die Augen.
Endlich schlafen!
Sekunden später wurde das Fell vor meinem Bett erneut zur Seite gerissen.
»Gwyn! Seit wann bist du wieder hier!? Ich dachte, du seist im Wald um Spinnenseide zu sammeln!«
Stöhnend öffnete ich wieder meine Augen. Aus der Traum von einer Stunde Schlaf. Vor mir ragte die hochgewachsene Gestalt meines älteren Bruders auf. Korsak war schlank, aber dennoch gut gebaut. Seine Haare waren länger als meine. Sie waren hinten im Nacken zu einem kunstvollen Zopf geflochten. Sein markantes Gesicht wurde durch scharfe Wangenknochen und eine etwas zu spitze Nase geprägt.
»War ich ja auch. Ich habe aber nicht sehr viel gefunden und bin darum umgekehrt. Die Gegend hier scheint schon weitestgehend abgeerntet«, maulte ich heiser vor Müdigkeit.
»Das kann ja gar nicht sein! Sylt ist gestern erst mit zwei vollen Körben zurückgekommen. Und ihre Mutter hatte noch einmal so viel dabei. Du stellst dich bei der Suche vermutlich einfach nur dämlich an!«, meinte Korsak überheblich.
»Vielleicht aber hat deine ach so wundervolle Freundin ja schon alles an sich gerissen!«, brachte ich zähneknirschend hervor.
Sylt war Korsaks Verlobte und im selben Alter wie ich. Sie lebte mit ihren Eltern nur zwei Hütten entfernt von uns. Wir kannten uns schon seit unserer Kindheit. Sie war mir noch nie besonders sympathisch gewesen. Ich kam nur schwer mit ihrer überheblichen, dünkelhaften und herablassenden Art klar. Was sie äußerlich an Schönheit zu bieten hatte, machte ihr mieser Charakter wieder zunichte. Na ja, jedenfalls verhielt sie sich Mynna und mir gegenüber derart arrogant. In Gegenwart meines Bruders und meines Vaters verhielt sie sich stets wie der unschuldigste aller Engel. Doch mir machte sie nichts vor. Meiner Meinung nach war Sylt einfach nur berechnend. Meinem Bruder schmiss sie sich sicherlich nicht an den Hals, weil sie ihn tatsächlich liebte. Das tat sie doch nur, weil er in unserem Stamm als Sohn des Oberhauptes eben die beste Partie abgab. Korsak war drei Jahre älter als wir und fuhr anscheinend voll auf sie ab. Wann immer er konnte, erwähnte er sie und gab mit ihr an, was mittlerweile schon dazu führte, dass mein eigenes Ego sich manchmal unbeabsichtigt mit ihr verglich.
Korsak wiegelte meinen Einwand Kopf schüttelnd ab.
»Ach Quatsch. Vielleicht hattest du auch einfach kein Glück.«
Merkte er eigentlich nicht, dass er mich vom Schlaf abhielt, den ich so dringend brauchte? Er musste doch sehen, dass ich todmüde war. Ganz ehrlich, es gab Momente, da ging mir mein Bruder mächtig auf die Nerven. Dies war ein solcher Moment.
»Was willst du eigentlich von mir?«, fauchte ich ihn mit voller Absicht an.
Korsak zuckte mit den Schultern und sah mir aus unschuldigen Augen entgegen.
»Ich? Eigentlich nichts«, meinte er und ließ den Vorhang wieder beiseite gleiten.
Erleichtert ließ ich mich auf den Stoff zurückfallen.
»Aber ich soll dir von Vater ausrichten, dass er dich in fünf Minuten vor der Hütte erwartet.« Ich konnte schwören, dass man fähig war, ein höhnisches Grinsen aus einem gesagten Satz herauszuhören. Und in diesem Moment hörte ich definitiv eines heraus.
Ich wünschte mir einen riesigen Bottich voll Milch und eine Horde hungriger Katzen herbei.
DRITTES KAPITEL
Als ich genau sechs Minuten später (die zusätzliche Minute hatte ich mir just aus töchterlicher Rebellion heraus genommen) vor unsere Hütte trat, sah ich meinen Vater einige Meter entfernt mit Rysp – Mynnas und Bastas Mutter – reden. Sie wirkte auf Grund ihrer zierlichen Statur neben meinem großen und breitschultrigen Vater wie ein hageres Reh, das einem Bären gegenüber stand. Rysps Haare trug sie kurz wie ein Mann (wobei man meinen Bruder, meinen Vater und noch einige weitere Männer aus unserem Stamm hier nicht als Vergleich nennen konnte.
Ihnen allen reichte ihre Haarpracht bis fast über den gesamten Rücken hinunter) und ihre eingefallenen Wangen und die übrige magere Gestalt zeugten immer noch von dem tiefen Schmerz, den sie aufgrund des Verlustes ihres Gatten verspürte. Ich fragte mich, ob dieser Schmerz jemals vergehen würde. Oder ob es irgendwann weniger weh tun würde, wenn man sich an jene geliebte Person erinnerte, die man verloren hatte. Ich bezweifelte es.
Ich wartete noch höflich, bis die beiden ihr Gespräch beendet hatten und Rysp sich entfernte, ehe ich auf meinen Vater zu ging.
Als er mich kommen sah, vermischten sich in seinem Gesicht liebevolle, väterliche Zuneigung und ernsthafte Strenge. Noch konnte ich nicht genau sagen, was überwog, würde es aber wohl gleich herausfinden.
»Gwyn«, begrüßte er mich und legte mir seine schwere Bärenpranke auf die linke Schulter. Immer wenn Vater das tat, hatte ich das Gefühl, um mehrere Zentimeter im Erdboden zu versinken. Obwohl ich als Frau mit einer Körpergröße von einem Meter und achtundsiebzig schon relativ groß war, so überragte mich mein Vater noch einmal um beinahe zwei Köpfe.
»Vater«, erwiderte ich respektvoll seine Begrüßung und sah ihm dabei direkt in die eisblauen Augen.
»Korsak hat mir mitgeteilt, dass du mich sprechen wolltest.«
Mein Vater nickte nur bedächtig mit dem Kopf, wobei sein weißblonder, zu einem dünnen Zopf geflochtener Ziegenbart, den er am Kinn trug, wie ein kleines Pendel vor und zurück schwenkte.
»Gehen wir ein Stück«, forderte er mich auf, seine Hand immer noch auf meiner Schulter ruhend. Nebeneinander gingen wir durch das große Lager. Schweigsam. Was meiner Meinung nach kein sehr gutes Zeichen war. Wenn mein Vater schwieg, war es nicht selten der Fall, dass ihn etwas beschäftigte. Hoffentlich hatte er Mynna die Geschichte mit dem früheren Sammelausflug tatsächlich geglaubt. Andernfalls würde ich nun zusehen müssen, wie ich mir selbst eine glaubhafte Alternative für mein Verschwinden einfallen ließ.
Als er nach einer weiteren Minute des Schweigens immer noch nicht mit der Sprache heraus gerückt war, unternahm ich einen vorsichtigen Versuch, ihn aus der Reserve zu locken. Besser, ich brachte es schnell hinter mich. »Bedrückt dich etwas, Vater?«
Er sah von der Seite her auf mich herunter und blieb dann in der Nähe von ein paar Frauen stehen, die damit beschäftigt waren, Pilze und Beeren für das Abendessen in einem großen Holztrog zu waschen.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















