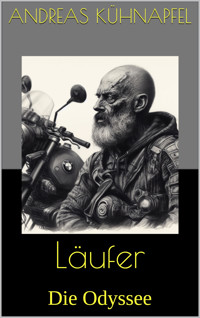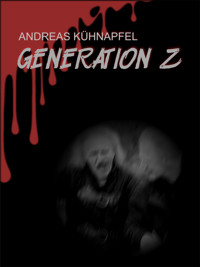
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Christopher Stern hat den vergangenen Winter in seinem Keller verbracht. Buchstäblich. Fernab der Apokalypse, in der die Toten wieder auferstehen und versuchen die Lebenden zu fressen, hat er sich in seinem Haus, in einem kleinen Ort in der Pfalz, versteckt. Ausgestattet mit genügend Lebensmitteln, einigen Waffen und dem Wissen das in den kleinen Orten weniger Menschen und damit eben auch weniger "Andere" existieren. Doch als der Frühling sich ankündigt wird ihm bewusst, dass der Lagerkoller droht. Er muss raus, will sehen, was aus der Welt geworden ist. Trifft er zunächst nur auf die "Anderen", findet er schon sehr bald weitere Überlebende. Auch wenn diese nicht immer wohlgesonnen erscheinen. Auf der US Air Base in Ramstein findet er aber nicht nur einen besonderen Menschen, sondern auch sein Schicksal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Nicht zögern
Der Wunsch nach Gesellschaft
In der leeren City
Fahren auf der Autobahn
In der Kneipe
In neuer Gemeinschaft
Keine Zeit zum Campen
Wissenschaft und Ethik
Ein »Ting«
Noch ein Feuer in der Nacht
Semper Fi
Vivisektion
Die Weinprobe
Das Fieber
Am Zaun
Geschichten und neue Bündnisse
Suchen und Retten
Ein weiterer Notfall
»We have a Situation«
Zurück im Leben
Die Legionen des Varus
Der Wunsch nach Vergeltung
Ein Sturm zieht auf
Ein sicherer Hafen
Insubordination und Verrat
Das Ende einer Ehe
Camouflage und Risiken
Ein Abend mit »Biss«
Zurück
Epilog
Impressum
Generation Z
Andreas Kühnapfel
Impressum
Copyright © 2019 Andreas Kühnapfel
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach
www.kuehnapfel.de
Veröffentlicht über Tolino Media 2025
Umschlagfoto: Sabine Kemper
Lektorat und Korrektorat: Falk Enderle
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 9783759287427
WIDMUNG
All jenen, die ihre persönliche Apokalypse bereits hinter sich haben…
… oder noch mittendrin sind.
Inhalt
Nicht zögern 3
Der Wunsch nach Gesellschaft 7
In der leeren City 14
Fahren auf der Autobahn 21
In der Kneipe 30
In neuer Gemeinschaft 41
Keine Zeit zum Campen 53
Wissenschaft und Ethik 66
Ein »Ting« 70
Noch ein Feuer in der Nacht 79
Semper Fi 81
Vivisektion 93
Die Weinprobe 97
Das Fieber 106
Am Zaun 108
Geschichten und neue Bündnisse 119
Suchen und Retten 130
Ein weiterer Notfall 136
»We have a Situation« 138
Zurück im Leben 151
Die Legionen des Varus 154
Der Wunsch nach Vergeltung 168
Ein Sturm zieht auf 169
Ein sicherer Hafen 176
Insubordination und Verrat 183
Das Ende einer Ehe 189
Camouflage und Risiken 196
Ein Abend mit »Biss« 205
Zurück 223
Epilog 228
Nicht zögern
Julius setzte das Trinkhorn ab und blickte amüsiert in die Runde. Es hatte ihn nie gestört, dass viele Menschen um ihn herum einige Jahre jünger waren. Im Gegenteil, diese pure Lebensfreude, die ihn umgab, gefiel ihm. Diese Menschen mochte er sehr, denn es war ihnen egal wie alt er war, ob er noch Single oder schon wieder Single war, oder in einer schwierigen Beziehung steckte. Sie nahmen ihn so wie er kam.
Sie hatten ihr Lager gerade erst aufgeschlagen. Wie immer, bei diesen Festen, hatten sich alle gegenseitig geholfen. Das gehörte sich eben einfach so.
Der Kuss mit dem Regina eben ihren Mann bedachte, ließ in ihm so ein Gefühl von »Mitfreuen« in ihm aufkommen. Sie und Arnold waren ungefähr so alt wie er und hatten sich erst vor kurzem gefunden. Er zog seine Streitaxt aus dem Gürtel und legte sie neben sich auf das Lammfell. Diese Mittelalterfeste waren ganz nach seinem Geschmack, doch das änderte nichts an dem leeren Trinkhorn. Julius stand auf, um sein Horn wieder am Fass zu füllen.
Indes das kühle Bier in das Horn gluckerte, sah er noch einmal zu Arnold und Regina hinüber und erschrak. Woher die Frau gekommen war, konnte er nicht einmal erkennen, doch sie sprang den Mann in der Tunika eines Kreuzritters an, riss ihn zu Boden und schon Augenblicke später schoss eine Blutfontäne aus dem Hals des Angegriffenen. Reginas entsetzter Schrei gellte über den Platz und Julius konnte nicht fassen, was er sah.
Ein Scherz?
Wenn ja, war das ein verdammt schlechter und er würde mit Arnold reden müssen. Da hörte er hinter sich einen Schrei und als er sich umwandte, sah er wie eine andere, ihm ebenfalls völlig fremde Person einen Marktbesucher zu Boden riss, und schon begann um ihn herum lautes Geschrei. Menschen begannen zu rennen, schienen alle zeitgleich dem Ausgang zu zustreben. In ihrer Panik behinderten sie sich nicht nur gegenseitig, sie waren auch geneigt Gewalt anzuwenden und die Menschen um sich herum gnadenlos zu Boden zu stoßen.
Er sah noch, wie Regina zu Boden gerissen wurde und wich, halbwegs geschickt, einem jungen, vielleicht 16 Jahre alten Mädchen mit einem pinkfarbenen T-Shirt aus.
Endlich reagierte er und wollte zu seiner Axt greifen, doch die lag noch auf seinem Lammfell, etwa zehn Meter entfernt. Gerade als er sich in Bewegung setzte, griff das Mädchen ihn wieder an, umklammerte ihn mit einer erstaunlichen Kraft und riss ihn halb zu Boden, zumal sie sich mit einem Bein um seines schlang. Er strauchelte und ergriff instinktiv an ihren Hals, in der Hoffnung sie fernhalten zu können.
Erstaunlich war für ihn, wie viel Kraft diese kleine Person freisetzte. Trotz des zusätzlichen Gewichtes und seines tiefsitzenden Schocks hielt er ihren Hals weiter fest und versuchte zu seiner Axt zu kommen. Ihre Zähne schnappten, trotz der noch unüberbrückbaren Entfernung laut klappernd nach seinem Hals. Dabei erinnerte sie ihn in ihrem Verhalten an einen Tollwütigen Hund.
Unter Aufbietung all seiner Kraft erreichte er fast seinen Platz, doch dann stießen zwei andere Personen, die ebenfalls in einen Kampf verstrickt waren, ihm heftig in die Seite, er strauchelte und stürzte. Zu seinem Glück wurde bei dem Aufprall auf dem Boden nicht nur seine Luft aus den Lungen gepresst, sondern auch das Mädchen von ihm heruntergeschleudert. Im Gegensatz zu ihm, dem sich dabei etwas Spitzes, vielleicht ein Stein, in den Rücken bohrte, schien sie keinen Schmerz zu empfinden und sprang sofort wieder auf die Beine, um sich erneut auf ihn zu werfen.
Er bekam soeben noch seine Axt zu fassen, und konnte sich, in dem er die Waffe am Stil fasste ihren Kopf auf Abstand halten. Jedoch bekam er dadurch auch Gelegenheit die junge Frau genauer zu betrachten. Ihr Gesicht war wutverzerrt, die Pupillen ihrer Augen so blass wie er es nur von Toten kannte. Das blutverschmierte Gesicht erschien ihm wie eine hassverzerrte Fratze, dabei war er sicher, diesem Mädchen noch nie begegnet zu sein. Verzweifelt kämpfte er gegen das erstaunlich starke Mädchen an, welches sich nicht einmal dadurch irritieren ließ, dass der Axtstiel direkt auf ihren Hals gepresst war, und ihr eigentlich das Atmen erschweren sollte.
Langsam wurde ihm klar, dass wohl niemand plötzlich aus den Büschen springen und etwas von »Vorsicht Kamera« rufen würde. Noch einmal brachte er alle Kraft auf, um sie von sich zu stoßen. Das Blut rauschte in seinen Ohren, die Muskeln in seinen Ohren begannen von der Anstrengung zu brennen.
Genau in dem Moment, in dem ihm klar wurde, dass er nicht mehr lange standhalten würde, erschlaffte das Mädchen über ihm. Schon erschien eine andere junge Frau in seinem Sichtfeld und zog ihren Dolch aus dem Hinterkopf der Kreatur auf ihm. Er wälzte das nun offensichtlich tote Mädchen von sich herab und sprang so schnell er konnte auf die Füße.
Ophelia, seine Retterin hatte den Dolch bereits wieder in der linken Hand, in der sie auch ihren Bogen hielt und nach und nach einen Pfeil nach dem nächsten verschoss. Jedoch wurde auch Julius schnell klar, dass nur die Treffer am Kopf Wirkung zeigten. Treffer an Brust und Schulter schienen von ihren merkwürdigen Angreifern nicht einmal wahrgenommen zu werden. Sie tappten ungelenk voran, ignorierten die Pfeile und stürzten sich anscheinend wahllos auf ihr jeweils nächstes Opfer.
Julius entschied für sich es konnte sich hier nur um einen Alptraum handeln. Und wenn das ein Alptraum war, dann musste er handeln wie in einem Alptraum. Er fasste seine Axt noch einmal fester, schritt energisch auf den, ihm am nächsten wandelnden Angreifer zu und versenkte kräftig und kompromisslos das Axtblatt im Schädel des Mannes. Dieser brach einfach, ohne Klagen oder sonstige dramatische Aktionen zusammen und blieb liegen.
Julius aber ging voran, zwei weitere Männer, einer davon in dem Kittel eines Verkäufers eines Lebensmittelmarktes, schien Julius als erstes zu bemerken, wandte sich ihm zu und brach auch schon zusammen. Gefällt mit einer Axt die Julius selber geschmiedet hatte. Das war sein Hobby. Der Schmied nahm den Schwung der Axt auf, ließ sie kreisen und versenkte das Axtblatt gleich im nächsten Schädel. Aus den Augenwinkeln nahm er einen Angreifer wahr, wandte sich ihm zu, doch in diesem Moment brach die Frau in dem geblümten Sommerkleidchen auch schon zusammen. Ophelias Sax-Messer war ihr in die Schläfe gedrungen. Julius blickte die junge Frau an.
»Jetzt schulde ich dir zwei«, keuchte er, ohne sich bewusst zu sein, dass er noch vor Minuten schockiert und unfähig war, überhaupt zu reagieren.
Da er recht groß gewachsen war, konnte er sehen, dass nun auch andere den Kampf aufgenommen hatten. Einige, besonders aus den Reihen der Besucher, kämpften mit bloßen Händen, andere wehrten sich mit allem, was ihnen zur Verfügung stand. Selbst einige der Besucher hatten offenbar Schwerter oder Äxte zu fassen bekommen.
Er sah einen jungen Mann, der ungelenk mit einem Morgenstern versuchte seine Frau und das Kind zu schützen, die er verzweifelt hinter sich schob. Gerade holte er erneut aus, als hinter der Frau plötzlich ein Mann auftauchte und ohne zu zögern seine Zähne in ihren Hals schlug. Die Frau schrie auf, der abgelenkte Mann wandte den Kopf und schon im nächsten Moment wurden alle drei regelrecht überrannt. Das Kreischen fuhr Julius unter die Haut.
Mittlerweile wuchs die Verzweiflung in ihm. Es erschien ihm fast, als würden die Angreifer immer zahlreicher, je mehr er von ihnen erschlug. Als kämpfe er gegen eine Hydra, die nicht aus mehreren Köpfen, sondern aus mehreren Körpern bestand.
Dann wurde ihm schmerzlich bewusst, dass diese Vermutung zutraf. Denn plötzlich stand Arnold vor ihm, blickte ihn aus den gleichen, verblassten Augen an, wie die anderen Angreifer und stürzte auf ihn zu. Sein Hals war seitlich, da wo er angefallen worden war, zerfetzt und offen. Die ehemals weiße Tunika Blutgetränkt, ebenso wie das Gesicht mit Blut verschmiert schien.
Einen Augenblick war der Schmied wie gelähmt und konnte sich nicht entschließen, den Mann, den er kannte, niederzustrecken.
Er zögerte zu lange.
Der Wunsch nach Gesellschaft
Träge plätscherte das Wasser von der Balkonkante über ihm, traf auf die Steinfliesen der Terrasse und jeder einzelne Tropfen zersprang in viele einzelne, kleinere Tröpfchen. Der Regen hatte bereits vor einigen Minuten aufgehört, noch trieben dunkle Wolken über die bewaldete, kahle Höhe gegenüber, aber zwischendurch brachen ein paar Sonnenstrahlen hindurch und strichen wie Leuchtfinger über die feuchten, laublosen Wälder.
Auf der Wiese im Garten zeigten sich erste Schneeglöckchen. Der Frühling kam in großen Schritten. Wenn er sich nicht verrechnet hatte, war es Anfang März. Der Rauch seiner Zigarette kräuselte durch den Rahmen der Kellertür, zog unter dem Balkon nach oben. Dieses Laster würde ihn eines Tages umbringen. Vielleicht.Zumindest, wenn er lange genug lebte. Bei dem Gedanken zog ein bitteres Lächeln über sein Gesicht und er drückte die Zigarette in den feuchten Aschenbecher, wo sie mit einem leisen Zischen erlosch. Noch immer war es für ihn erstaunlich, wie intensiv selbst leise Geräusche geworden waren. Es gab einfach kein zivilisationsbedingtes Hintergrundrauschen mehr, welches früher irgendwie alles überlagerte.
Auf der Ladefläche des rostenden Kleintransporters, der in das Schaufenster auf der anderen Straßenseite gekracht war, sammelte sich Regenwasser, in dem vereinzelte kleine Eisschollen schwammen. Drei Tage hatte es gedauert bis er genervt genug war, hinüberzugehen und dem eingeklemmten Fahrer einen Schraubenzieher in den Kopf zu rammen. Während des Winters war der Geruch erträglich gewesen, aber jetzt, da es langsam wärmer wurde, nahm auch die Verwesung zu. Sicher würde der Geruch in einigen Tagen so schlimm sein, dass es nicht auszuhalten wäre. Vielleicht sollte er rübergehen, die Überreste herausziehen und auf alten Möbeln und Matratzen verbrennen. Am besten, bevor es zu stark zum Himmel stank.
Langsam wurde es dämmrig und im Westen zog sich ein dunkelrotes Glühen über den Himmel. Er beschloss, es sei ein guter Tag für einen Drink. Die Flaschen hatte er im Herbst in einer Gaststätte irgendwo im Wald, in einer dieser alten Wanderhütten, gefunden. Eine dieser kleinen Gaststätten im Wald, meistens von Wandervereinen betrieben, um hungrigen Wanderern Obdach und Speisen zu bieten. Er ging zu dem rostigen Kellerregal, in dem er die Vorräte lagerte, entschied sich für einen Gin und schenkte sich großzügig ein.
Der Schnaps schmeckte scharf nach Wacholder und brannte in der Kehle, das aufkommende Sodbrennen ignorierte er und zündete sich eine weitere Zigarette an.
Dass beides nicht gut für ihn war, wusste er. Doch in diesen Zeiten bestand die Krebstherapie wohl darin, sich rechtzeitig eine Kugel in den Kopf zu jagen, bevor es zu übel wurde. Da er seit Monaten keine anderen Menschen gesehen hatte und er auch nicht wusste, ob es da draußen überhaupt noch Menschen gab, schien es ihm überflüssig, auf eine gesunde Lebensweise zu achten. Jahrelang hatte er dies Genevieve zuliebe getan. Wenig Kohlehydrate, wenig Cholesterin, kein Alkohol mehr und nur noch wenige Zigaretten. Nun fragte er sich, wofür er sich das alles auferlegt hatte.
Genevieve war wohl lange schon tot- oder noch schlimmer. Die Rauchfahnen, in denen die Zivilisation um ihn herum versunken war, hatten wochenlang am Himmel gestanden. Ständig fing irgendetwas Feuer.
Während Zweibrücken zum Teil ausgebrannt war, hatte er gespannt und fluchtbereit abgewartet, ob das Feuer sich vielleicht ausbreitet. Aber der viele Regen hatte wohl schlimmeres verhindert. Dennoch prüfte er noch immer jeden Morgen, ob es neue Rauchfahnen in der Umgebung gab.
Als der erste Schnee gefallen war, gab er die Suche nach Genevieve auf und war nach Hause zurückgekehrt. Monatelang hatte er gesucht. Immer wieder Sprit gefunden für den alten Land Rover, im Wagen geschlafen, weitergesucht.
Bis nach Bar-le-Duc, Genevieves Heimatstadt, waren es früher einmal drei Stunden Fahrt. Heute brauchte man dafür durchaus mal ein paar Tage.
Aber auch hier war Genevieve nicht zu finden. Nur ihre Eltern hatte er angetroffen, eigentlich eher das, was aus ihnen geworden war. Als er es beendete dachte er daran, dass ihre Mutter ihn nie gemocht hatte, schon wegen seiner deutschen Herkunft.
Dennoch tat ihm sehr leid, was er tun musste. Marie hatte letzten Endes nur ihre Tochter geliebt.
Das Labor bei Ramstein, in dem sie gearbeitet hatte, fand er schon vorher völlig ausgebrannt und verlassen vor. Nicht einmal welche von »den Anderen« waren zu sehen gewesen. Lediglich einige grauenhaft entstellte Tote, einige von ihnen zeigten deutliche Zeichen von Suizid. So lief das in diesen Zeiten. Wer irgendwie konnte, sorgte sich selbst darum, dass er nicht zu den Anderen wurde. An die Air Force Base hatte er sich nicht so nah herangetraut. Das erschien ihm damals einfach zu gefährlich.
Das letzte Mal hatte er Genevieve an dem Morgen gesehen, als die Dinge eskalierten.
Die Nachrichten waren schon ein paar Tage lang voll mit beunruhigenden Meldungen über Angriffe von angeblich Grippekranken. Zuerst hieß es, die Sicherheitskräfte hätten alles im Griff. Dann sollte die Bevölkerung vorsichtig sein, die Fahrzeugtüren verriegeln und wenn möglich daheimbleiben. Danach wurde der Ausnahmezustand verhängt. Genevieve hatte eine Ausnahmegenehmigung erhalten und durfte weiter zur Arbeit, er dagegen musste zu Hause bleiben. Da wurde ihm das erste Mal bewusst, dass seine Frau vielleicht doch mehr als nur eine Ärztin war. Doch sie schwieg dazu nur. Bis dann der seltsame Anruf kam und sie ihn bat, alles zu verriegeln und auf keinen Fall das Haus zu verlassen.
»Wir haben genug Vorräte, am besten bleibst du im Keller und verhältst dich erst einmal still.«
»Was ist denn da los? Und was zur Hölle hast du damit zu tun?«
»Ich kann dir das nicht sagen, Chris. Mach einfach, was ich gesagt habe. Bitte! Ich versuche zu erreichen, dass man dich abholt oder so. Aber jetzt, bitte, geh in den Kel…« Es knackte kurz und das Gespräch wurde unterbrochen. Christopher fühlte sich ein wenig wie in einem schlechten Thriller.
Ein Rückruf war nicht möglich, da das Netz entweder überlastet oder nicht erreichbar war. Ja, Vorräte waren da. Genevieve war lange bei Einsätzen in Afrika gewesen und hatte erlebt, was Epidemien anrichten können. Daher hatten sie immer genug Vorräte im Haus. Vorräte und Waffen.
Er war kein Freund dieser Waffen, aber da es seiner Frau wichtig war, hatte er der Anschaffung zugestimmt. Dazu kam, dass ihm die Übungen mit dem Compoundbogen auch Spaß machten und er sich nach einer Weile sogar als talentierter Schütze erwies. Nach ihrem Anruf hatte er eine Weile überlegt, was er tun sollte.
Der Keller war von der Küche aus erreichbar, besaß aber auch einen eigenen Eingang zum Garten hin. Er hatte ein eigenes kleines Bad in dem neuen, vorderen Teil aus den achtziger Jahren. Christopher hatte die alten grünen Fliesen gern als »Gelsenkirchener Barock« bezeichnet und eigentlich den Plan gehabt, diesen Raum zu modernisieren. Aber zu mehr als einem dieser modernen, heizbaren Spiegel war es nie gekommen. Der hintere Teil wurde offensichtlich schon im späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert erstellt und wies noch eine Gewölbebauweise aus rotem Sandstein auf. Der Vorteil war hier durch die gleichbleibenden Temperaturen gegeben. Das alles waren Vorteile, die Genevieve bei der Besichtigung sofort erkannte, ihn dagegen interessierte nur die Möglichkeit, ein Arbeitszimmer im ersten Stock einzurichten. Monatelang hatten sie an dem Umbau gearbeitet, um alles so einzurichten, wie es ihnen gefiel. Als Journalist und Autor konnte er von zu Hause? aus arbeiten so oft es ihm gefiel und Genevieve wollte keine Kinder.
Also ging er wieder hinauf in das Arbeitszimmer, nahm seinen Laptop und obwohl es ihm albern und unwirklich erschien, versuchte er im Keller zu arbeiten. Doch es gelang ihm nicht. Immer wieder glitten seine Gedanken ab. Genevieve und der Gedanke daran, wo sie war und wie und ob sie heimkommen würde, beschäftigten ihn einfach zu sehr. Er fragte sich, was da los war und was Genevieve damit zu schaffen hatte. Er hatte sich nie genug für ihre Arbeit interessiert und sie nicht viel darüber erzählt.
Genevieve war Mikrobiologin, das sagte zumindest die Urkunde von ihrem Abschluss an der Uni in Metz. Er erinnerte sich, dass sie sich wirklich selten darüber unterhalten hatten, was genau sie da in ihrem Labor eigentlich tat.
Mit dem Glas in der Hand sah er sich um. Sein Blick fiel auf den Reisepass im Regal und er nahm das alte Dokument, um sich noch einmal die Stempel anzuschauen und sich an frühere, bessere Zeiten zu erinnern. Das war der einzige Grund, warum er den Pass noch besaß. Die Erinnerungen. Auf der ersten Seite stand sein Name. Ihm wurde schmerzlich bewusst, den Namen schon sehr lange Zeit nicht mehr gehört zu haben.
»Christopher Stern«, murmelte er. Seit Monaten versteckte er sich daheim, seit Wochen betrat er nur noch den Keller.
Das Bild zeigte ihn vor ein paar Jahren, als dieser Pass ausgestellt wurde. Damals waren seine Haare noch nicht grau, sondern brünett. Die blauen Augen hatten noch nicht so müde gewirkt wie die, die ihn jeden Morgen aus dem schmutzigen Spiegel anstarrten. Die Narbe auf seiner Stirn gab es damals auch noch nicht und die Falten hatte er auch erst in den letzten Monaten bekommen.
Gelegentlich war er – vor allem im eben ausklingenden Winter – losgezogen, um seine Vorräte aufzufüllen. Menschen hatte er hier keine gesehen. Nur ein paar Andere, die aber nach der Begegnung mit ihm nur noch verrotteten.
Plötzlich verstand er, warum er in der letzten Nacht fast den Efeu an der Garagenwand erschossen hätte. Er hatte in der Dunkelheit nur Bewegungen gesehen und ein leises Rascheln gehört und daher geglaubt, einen Anderen oder einen Plünderer vor sich zu haben. Erst als er zielte, sah er, dass es sich nur um einen Ast handelte, der sich im Wind wog. Er war einfach schon zu lange hier. Er war zu lange allein. Es wurde Zeit, sich auf den Weg zu machen und zu sehen, was da draußen los war. Vielleicht gab es irgendwo Siedlungen? Andere Menschen, mit denen er reden konnte? Vor allem aber musste er einfach wissen, wie es andernorts aussah. Er wohnte in einem Dorf recht nah am westlichen Rand des Landes. Vielleicht gab es schon irgendwo wieder so etwas wie Zivilisation? Vielleicht rotteten sich schon wieder Menschen zusammen und begannen damit, sich etwas neu aufzubauen. Sein Entschluss stand fest!
Die Sonne war bereits untergegangen, daher machte es keinen Sinn, heute noch zu fahren. Aber er beschloss, zumindest schon einmal alles zu packen, was er benötigte.
In dem Land Rover war ausreichend Platz, Christopher besaß genug Ausrüstung und Proviant. Also schleppte er den größten Teil seiner Lebensmittel und sogar den Schnaps in das Auto. Der Compoundbogen fand seinen Platz ebenso, wie die kleine Pistolenarmbrust und die Walther P99. Für die Pistole hatte er nur noch zwei Magazine, aber er benutzte sie eh nur ungern. Der Knall lockte meist noch weitere Andere an.
Auf der langen Ladefläche des Geländewagens hatte er damals eine Schlafpritsche für sich und Genevieve eingebaut. Das war ihr Urlaubsplan: Mit dem Land Rover losfahren und einfach da anhalten, wo es ihnen gefiel. Zu dem Urlaub war es nun leider nicht mehr gekommen. Unter der Schlafpritsche hatte er Stauraum geschaffen. Hier packte er die meisten seiner Habseligkeiten hinein, um zu verhindern, dass von Fremden gewisse Begehrlichkeiten geweckt wurden. Er war in Metz schon einmal ausgeraubt worden, als er zu Fuß unterwegs war. Dass er damals zumindest einen Teil seiner Sachen zurückbekommen hatte, war reinem Glück zu verdanken. Glück und dem Training mit dem Bogen. Das musste nicht noch einmal passieren.
Als er fertig war, warf er einen Blick zu der verwesenden Leiche auf der anderen Straßenseite. Auch wenn der Gestank ihn ab morgen nicht mehr stören sollte, so war das Wesen da doch einmal ein Mensch gewesen.
Christopher hatte die umliegenden Häuser in den letzten Monaten alle durchsucht und wusste ungefähr, wo er bestimmte Dinge fand. Mit der Pistole in der Hand ging er noch einmal in das Haus, in das der Laster gekracht war, fand die Schlafzimmer und warf ein paar Matratzen durch das Fenster hinaus auf die Straße. Als er die erste warf, kicherte er und rief leise:
»Achtung da unten!« Anschließend fragte er sich, ob das Sarkasmus war oder er langsam, aber sicher durchdrehte.
Keuchend errichtete er aus den Matratzen mitten auf der Straße einen provisorischen Scheiterhaufen, zerrte den toten Lieferwagenfahrer hinauf und opferte ein paar Liter Benzin, um den Haufen in Brand zu setzen. Der Gestank war alles andere als angenehm, glücklicherweise zog der leichte Wind aber nach Westen, also von seinem Haus fort.
Hier im Ort hatte er seit Wochen lediglich streunende Hunde und Katzen gesehen. Daher zog er sich, relativ sorglos, für die letzte Nacht in seinen Keller zurück. Hier hatte er noch eine Armbrust und einige Bolzen. Also ausreichende Bewaffnung, sollten ungebetene Gäste auftauchen.
Ihm wurde bewusst, dass er in der nächsten Zeit unter Umständen nicht genug Zeit zur Hygiene haben würde. Also beschloss er, sich noch einmal ausreichend Zeit dafür zu nehmen. Mit einem Kurzhaarschneider rasierte er Bart und Haare runter bis auf einen Millimeter. Unter der Dusche verwendete er das komplette, noch zur Verfügung stehende Wasser, um sich noch einmal richtig aufzuwärmen und das saubere Wasser zu genießen. Wer wusste schon, wann er wieder einmal dazu kommen würde.
Vor dem Einschlafen trank er noch sein Glas Gin aus und fast schien es, als habe dieser Entschluss bei ihm etwas gelöst, denn er schlief tief und traumlos.
Der nächste Morgen brachte ihm zunächst die Erkenntnis, dass der Frühling sich zwar ankündigte, aber eben noch nicht da war. Über Nacht waren mehrere Zentimeter Schnee gefallen, und gerade begann es erneut zu schneien.
Der Geländewagen sprang sofort an und knirschend verdrängten die grobstolligen Reifen den frisch gefallenen Schnee. Die nasskalte Luft, die durch die offenen Fenster hereinströmte, störte Christopher nicht, wirkte im Gegenteil eher erfrischend auf ihn. Nach ein paar hundert Metern bereits erschien ihm sein Entschluss eindeutig richtig.
Er fühlte sich befreit. Befreit von der Enge der eigenen Festung. Von Mief und Nässe der schlecht zu lüftenden Kellerräume. Von der Einsamkeit.
Wenige Minuten später erreichte er das Ortsschild, ohne auch nur ein einziges Lebewesen, sei es auch nur ein Tier, oder auch nur den Schatten eines solchen gesehen zu haben. Dieser Ort war schon immer recht verschlafen gewesen, einer der Gründe, warum Genevieve und er hier wohnen wollten. Doch nun war er einfach tot und ausgestorben, nicht einmal mehr streunende Hunde trieben sich hier noch herum.
»... und nun legt sich der Schnee wie ein Leichentuch über den Ort«, dachte er laut. Er musste schmunzeln über diese abgedroschene Metapher. Das Schmunzeln erzeugte ein eigenartiges Gefühl in seiner Brust. Befreiend, als öffne sich ein Knoten und da er keinen Grund sah, sich weiterhin zusammen zu reißen, begann er zu lachen.
Es war sein Witz, nur er hatte ihn gehört und er fand ihn gut. Warum also nicht lachen?
Er gab Gas und fuhr weiter.
In der leeren City
Schon wenige Minuten später erreichte er Zweibrücken. Auf dem Weg dorthin waren nur ein paar liegen gebliebene Fahrzeuge zu sehen und die waren leicht zu umfahren. Aufmerksam hatte er sich umgesehen, aber alle Wagen standen leer und rosteten vor sich hin. Die Türen standen zumeist offen, in manche Wagen fiel der Schnee.
Die Fahrzeuge, von denen einige noch fast neu aussahen, standen da wie Zeugen einer Zeit, die längst vergangen schien.
Er erinnerte sich an einen Platz in Belgien, den er einmal mit seiner Kamera besucht hatte. In Chatillon standen einige hundert verlassene Fahrzeuge im Wald. Aneinandergereiht wie in einem Stau, von ihren Besitzern zurückgelassen, verrostet. Moos zog sich über Buicks aus den 60er Jahren, junge Bäume wuchsen aus alten Chevrolets.
Vermutlich würde es auch hier in einigen Jahren so aussehen. Autos, die verrosteten und als Zeugen einer früheren Welt dienten, die für Christopher gerade erst untergegangen war.
Obgleich er es selbst für Wahnsinn hielt, beschloss er einen Abstecher in Richtung Innenstadt zu wagen. Er wollte wissen, wie sich der Brand ausgewirkt hatte. Gab es noch irgendwas in der Stadt, das erhalten geblieben war?
Vielleicht sogar noch oder auch schon wieder Überlebende? Wieder stahl sich ein kleines Lächeln auf sein Gesicht, als ihm klar wurde, dass er aus Gewohnheit noch immer den Blinker beim Abbiegen nutzte.
Er fuhr im Schritttempo, um möglichst viel sehen zu können, ohne dabei jedoch komplett stehen zu bleiben. Am Ende der Abfahrt hielt er sich links, vorbei an der Polizeiwache.
Auch die hatte eindeutig gebrannt. Die Scheiben in den Fensterhöhlen waren zum größten Teil gesplittert und schwarze Brandspuren zogen sich an den Außenwänden nach oben. Die Glastüren, die ins Gebäude führten, waren nicht zerstört oder geplatzt, dafür aber tiefschwarz und somit nahezu blickdicht. Das Sicherheitsglas hielt also offensichtlich sogar einem starken Brand stand. Die Mühe, in das Revier einzudringen, um nach Nützlichem Ausschau zu halten, ersparte er sich. Zum einen war fraglich, ob er an den Türen überhaupt vorbeikam, zum anderen, ob das Feuer noch etwas übriggelassen hatte.
Mitten auf der Kreuzung lagen Stücke einer Zapfsäule. Zum Teil waren sie schwarz verkohlt, etwas verrostet und doch war noch einiges von dem blauen und weißen Design des Konzerns zu erkennen. Da die Säule also fraglos zu der Tankstelle an der Ecke gehörte und sicher nicht selbst die 20 Meter bis zur Kreuzung gelaufen war, konnte er sich auch diesen Weg sparen. Es eilte auch nicht.
Der Tank war fast voll und er hatte noch ca. 40 Liter in Kanistern dabei. Kurz dachte er darüber nach, dass diese Menge an Treibstoff ihn in guten Zeiten bis in Genevieves alte Heimat und zurückgebracht hätte. Und das an einem einzigen Tag. Heute würde er für die Strecke sicher den doppelten Treibstoff und mehrere Tage brauchen.
Christopher ließ den Wagen weiter in Richtung Innenstadt rollen. Gewohnheitsmäßig wollte er dem Straßenverlauf nach rechts folgen, stellte jedoch schnell fest, dass hier kein Durchkommen war. Nicht nur ein Dutzend Fahrzeuge, sondern auch jede Menge Schutt versperrten die Straße.
Dahinter konnte er den Rest einer Hausfassade wie ein zerbrochenes Gerippe noch ein Stück aufragen sehen. Große schwarze Flecken wiesen auch hier auf einen Brand hin. Vielleicht war eine Gasleitung durch den Brand explodiert und hatte so das Haus zum Einsturz gebracht. Wer wusste das schon? Also entschloss er sich, geradeaus, falsch herum in die Einbahnstraße zu fahren. Dafür hätte er früher seinen Führerschein verloren.
»Verklagt mich, wenn ihr wollt«, murmelte er und umfuhr einen aufgegebenen Streifenwagen. Die Beifahrertür des Streifenwagens stand offen und Christopher meinte zu erkennen, dass eine Dienstmütze auf dem Wagenboden lag.
Ein Teil des Fahrzeugs war von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden. Kurz stellte er sich vor, wie in diesem Wagen Polizisten gesessen und versucht hatten, wenigstens einen Teil der Ordnung aufrecht zu erhalten. In Gedanken versunken hatte er seinen Wagen einfach rollen lassen und nicht aufgepasst.
Es ruckte in der Lenkung, ein Geräusch, das einen Aufprall markierte, ein Kopf der kurz zu sehen war und dann verschwand. Instinktiv trat Christopher auf die Bremse, der Wagen hielt. Erschrocken überlegte er, was er tun sollte. Was, wenn er da soeben einen Überlebenden getötet hatte? So gering die Wahrscheinlichkeit auch war, er musste Gewissheit haben. Vorsichtig öffnete er die Fahrertür, schaute nach unten, lauschte.
Dann hörte er das röchelnde Geräusch. Das war kein Überlebender. Das war einer von denen. Er sah keinen Grund, sich in Gefahr zu bringen, um irgendwelche alten Moralvorstellungen von Erlösung oder ähnlichem zu verfolgen und zog die Tür wieder zu.
Dann legte er den Rückwärtsgang ein, setzte zurück. Das schwere Auto hoppelte leicht, als es noch einmal über den Körper rollte, dann war die Sicht auf den Anderen frei. An der Kleidung erkannte er, dass es ein Polizist gewesen sein musste. Zumindest früher einmal. Vielleicht sogar einer der Polizisten aus dem Streifenwagen, der ein paar Meter weiter hinten stand. Eine zerfetzte und verschmutzte dunkelblaue Uniform, am Gürtel hingen noch die Taschen für Handschellen, Taschenlampe und ein leerer Pistolenholster.
Die Beine zeigten deutliche Zersetzungsspuren und an der Stelle, an der der Land Rover drüber gerollt war, waren die Knochen regelrecht zermalmt. Das Gesicht wies einige sehr heftige Bissspuren auf, der Unterkiefer schien bar jeden Fleisches.
Der Andere versuchte sich umzudrehen, röchelnd suchte er nach Halt mit den Armen, seine blassen Augen wirkten bedrohlich und Christopher war klar, dass diese Kreatur noch immer gerne ihre Zähne in seinen Hals schlagen wollte. Aussteigen würde sich nicht lohnen und er hatte keine Munition zu verschwenden. Also legte er kurzerhand den Gang ein und einen Augenblick später erlosch die Existenz des Anderen unter einem seiner Vorderreifen.
Aufmerksam fuhr er weiter. Die Warnung für ihn war deutlich: Hier waren noch weitere Monster unterwegs. Er erinnerte sich ungern daran, wie er dem ersten begegnet war.
Nach dem Telefonat mit Genevieve war er vors Haus getreten, um eine Zigarette zu rauchen. Im Haus wurde nicht geraucht. Genevieve hasste das. Sergej, sein Nachbar mit russischen Wurzeln und einem gastfreundlichen Wesen arbeitete mit seiner Frau im Vorgarten. Christopher grüßte freundlich.
»Hallo Sergej, wird das das Kräuterrondell, das deine Frau haben will?« Der Angesprochene lachte zurück.
»Ja, du weißt ja: wenn Frau will, macht Mann besser sich an Arbeit. Sonst Wochen Stress und Ärger.« Christopher lachte zurück trotz der wirren Situation und dachte wieder einmal, dass Sergej ein wenig, wie Pavel Chekov klang. Immerhin kannte er Natalia. Eine bildschöne Frau Mitte 30, mit einem Temperament wie ein angreifendes Regiment Kosaken. Es war besser, ihr nicht zu widersprechen.
Maria kam eben mit ihrem Rollator vorbei. Wie immer grüßte die alte Dame freundlich. Sie war so etwas wie die gute Seele der Straße. Jeder kannte sie, sie hatte immer ein gutes Wort für jeden. Offensichtlich war sie beim Metzger am Ende der Straße gewesen, denn im Korb auf ihrem Rollator lag die entsprechende Tüte.
»Hallo Maria,« grüßte Christopher zurück. »Was gibt es denn heute Leckeres?« Er deutete auf die Tüte. Sie strahlte ihn mit ihrem faltigen Gesicht an.
»Gulasch. Ich weiß, dass du das liebst.«
Wie immer verhielt sie nicht im Schritt und eilte ohne viel Worte weiter. Sergej hatte mal gealbert, sie würde so schnell gehen, damit der Tod sie nicht einholen könne, denn der sei ja auch uralt. Christopher sah zu ihm hinüber und die beiden lachten sich an, wobei Sergej mit dem Kinn auf die davoneilende Maria deutete.
»Eilig wie immer«, grinste Christopher.
»Wie geht es Genevieve?«, fragte die eben hinzukommende Natalia.
»Ich …«, ein gellender Schrei unterbrach Christopher. Ihre Köpfe ruckten zeitgleich herum. Das Bild, das sich ihnen bot, war so unglaublich, dass Sergej und Christopher einen Moment benötigten, um zu reagieren. Dann aber rannten sie, gefolgt von Natalia, los.
Maria wurde vor ihren Augen am helllichten Tag überfallen. Sie lag mitten auf der Straße und der Täter beugte sich eben über sie, kehrte ihnen dabei den Rücken zu. Ganz so, als erwarte er nicht, dass sie überhaupt reagieren würden. Sie hetzten auf ihn zu und riefen ihn an.
Kurz bevor sie ihn erreichten, hob er den Kopf und sah sich um. Vor Schreck blieb Christopher augenblicklich stehen. Das fremde Gesicht, besonders um die Mundpartie herum, triefte geradezu vor Blut. Sergej und Natalia stoppten ebenso ruckartig,
Natalia sagte irgendwas auf Russisch. Die Augen des Mannes waren blutunterlaufen, die Haut aschfahl, ein animalisches Knurren schien aus den Tiefen seiner Brust aufzusteigen. Mit wutverzerrtem Gesicht schob sich der Mann langsam und gefährlich wirkend in die Höhe, sprungbereit, witternd.
Er kam nicht weit. Das Blut spritzte, als Natalia ihrem Mann den Spaten aus der Hand riss und damit den Schädel des Angreifers in einem Zug spaltete. Keine Frau zum Streiten, eindeutig nicht.
»Was ist das?« Christophers Flüstern war mehr an sich selbst als an seine Nachbarn gerichtet. Dann hörte er das röchelnde Knurren, - mehrstimmig!
Gleich drei blutverschmierte und monströse Personen kamen aus der Nebenstraße. Schockiert erkannte Christopher einen Nachbarn, dessen Frau und eine weitere Frau, die er noch nie gesehen hatte. Alle drei wiesen an Hals und Gesicht Verletzungen auf, die aussahen, als würden sie von Bissen stammen. Der Unbekannten fehlte der halbe linke Arm, dem Nachbarn das halbe Gesicht.
Natalia hob den Spaten, bereit zur Abwehr. Christopher und – da Natalia den Spaten übernommen hatte – auch Sergej waren waffenlos. Nervös gingen die drei rückwärts, ohne die drei Monster aus den Augen zu lassen. Die wiederum schienen es nicht eilig zu haben und schlurften röchelnd einfach weiter auf sie zu. Dabei bewegten sie sich ein wenig wie Raubtiere, die sich ihrer Beute sicher sind.
»Bei mir rein, da ist offen«, flüsterte Christopher und in diesem Moment rannten die drei Monster los. Schon im gleichen Augenblick versuchte der Nachbar, den Christopher nur vom Sehen kannte, ihn zu beißen. Christopher bekam im buchstäblich letzten Moment dessen Hals zu fassen und konnte so das blutige Gesicht auf Distanz halten. Das Röcheln wurde aggressiver, lauter und Christopher konnte durch die zerfetzten Wangen deutlich die Zähne sehen. Eher instinktiv nahm er wahr, dass Sergej zurückgedrängt wurde und hörte ein erstes, klatschendes Geräusch. Kurz darauf vernahm er das zweite und keine Sekunde später sah er, wie sich der Spaten in den Schädel seines Gegenübers grub. Natalia hob den blutigen Spaten und sah sich sichernd um. Nein, ganz sicher war die schöne Russin keine Frau zum Streiten.
Plötzlich nahm er eine Bewegung wahr, wenn auch nur leise aus den Augenwinkeln. Das reichte nicht mehr, um zu reagieren. Schon landeten die Hände klatschend auf der Seitenscheibe. Er schreckte zusammen, sein Fuß drückte kurz auf die Bremse. Dann sah er sie. Eine ganze Gruppe Andere kam aus einer Seitenstraße, auch von vorne bewegten sich ein paar Kreaturen auf ihn zu.
Er konnte sich nicht vorstellen, was sie angelockt haben könnte. Allenfalls das Motorengeräusch des Land Rovers. Das erschien ihm logisch, denn in der ansonsten leeren Stadt dürften diese Geräusche sicher weit zu hören sein. Vielleicht wäre es besser gewesen, zu Fuß zu gehen. Aber sicher auch gefährlicher. Er musste jetzt schnell handeln. Sehr schnell. Noch war die Straße nicht hoffnungslos versperrt. Er gab ein wenig Gas, nicht zu viel. Wenn er durchbrechen wollte, war es besser nicht zu schnell zu sein, da ansonsten die Körper auf der Windschutzscheibe aufprallen würden und das Glas beschädigt werden könnte. Er fuhr also langsam an und ignorierte die entstellte Frau, die an seine Seitenscheibe schlug. Die Scheiben waren zum Glück solide und hielten einiges aus. Die Bilder aus dem Nordirland der 1960er Jahre, bei denen Demonstranten auf solche Autos eingestürmt waren oder Steine geworfen hatten, gingen ihm durch den Kopf.
Der Wagen ruckte an, hoppelte über irgendetwas, das Christopher nicht erkennen konnte und er gab noch etwas mehr Gas. Er wollte nicht zu lange zögern, denn die Straße würde nicht freier werden. Durch den Ruck des anfahrenden Autos wurde die Seitenscheibe wieder frei, die ersten Anderen hatten seinen Wagen bereits erreicht. Er machte eine Ausweichbewegung und hielt dann wieder auf das Ende der Straße zu. Schon standen ihm die Monster im Weg. Er traf zwei gleichzeitig, der Rechte wurde einfach umgestoßen und rutschte an der Beifahrerseite herab. Irgendetwas schien dabei hässlich über den Lack zu kratzen. Der zweite Andere wurde frontal von der mächtigen, steil aufragenden Nase des Land Rover erfasst, schien sich aus irgendeinem vermoderten Instinkt heraus festhalten zu wollen, rutschte letzten Ende jedoch trotzdem ab und landete unter dem Auto.
Noch als ein Vorderrad über irgendeinen Teil des Anderen rumpelte, warfen sich bereits drei weitere auf den Wagen, zusätzlich zu einer Handvoll, die seitlich auftauchten. Hände klatschten auf Blech und Autoglas. Christopher konnte deutlich das aggressive, rasselnde Röcheln hören.
Christopher bemerkte zu spät, dass sich die Anzahl der Anderen vor ihm unverhältnismäßig schnell erhöht hatte. Nachdem der schwere Geländewagen drei weitere Bestien überrollt hatte, spürte Chris, wie sich die Körper unter dem Wagen festsetzten und stauten. Trotz Allradantrieb steckte er fest. Eingezwängt in der Kabine, die Schnauze in einem beeindruckenden Winkel nach oben aufragend, schien er gefangen.
Von allen Seiten drangen nun die Anderen auf den Wagen ein und auch wenn die Scheiben noch immer standhielten, war er sich nicht sicher, wie lange dieser Zustand andauern würde. Christopher wurde nervös, auch wenn das nicht sein erstes Mal in einer solchen oder ähnlichen Lage war. Seine Gedanken überschlugen sich und er spürte die erste Panik in sich aufkommen. Mit einem lauten Knacken klappte der rechte Spiegel an die Tür. Rings um sich herum sah Chris entstellte Gesichter. Viele trugen deutliche Verwesungsspuren, offene Wunden und Bisswunden. Endlich, durch den Nebel der aufsteigenden Panik hindurch, kam ihm ein Gedanke. Wenn es vorwärts nicht ging, dann vielleicht rückwärts?
Er wechselte den Gang, kuppelte, gab Gas. Ein kleines Stück, vielleicht einen halben Meter ging es rückwärts, dann steckte er erneut fest. Er schlug die Lenkung nach links ein, wechselte wieder in den ersten Gang, kuppelte, kam ein paar Zentimeter vorwärts, spürte erneuten Widerstand. Also gab er etwas mehr Gas, ruckelte über irgendwas hinweg, schlug wieder nach rechts ein.
Dieser Widerstand war anscheinend der Bordstein, denn das Fahrzeug bekam eine leichte Schieflage. Wenn auch nicht gefährlich, wirkte es in dieser Situation dennoch unangenehm.
Aber er hatte wieder einmal Glück im Unglück. Er erkannte eine Lücke, lenkte darauf zu, gab Gas, schaltete einen Gang hoch und kam frei. Ohne jegliches Zögern beschleunigte er, verließ den Stadtkern und beschloss, auf weitere Ausflüge in die Stadt zu verzichten.
Im Rückspiegel sah er, dass die Anderen ihm folgten. Stehenbleiben war also keine Option.
Fahren auf der Autobahn
In der Hoffnung, dass sich die meisten Anderen in die Ortschaften zurückgezogen hatten, lenkte er den Wagen auf die Autobahnzufahrt und stieß kurz vor Ende der Auffahrt auf das nächste Hindernis: Ein quer stehendes Auto. Er seufzte und dachte ärgerlich, dass es eigentlich ja auch einfach mal gut hätte laufen können.
Er zog die Handbremse an und erwog kurz, den Motor laufen zu lassen. Falls er schnell wegmusste, wollte er keine Verzögerungen riskieren. Dann entschied er sich aber doch dagegen. Bevor er den Wagen verließ, vergewisserte er sich seiner Ausrüstung. Das Messer hing am Gürtel, die Pistole nahm er noch an sich. Vorsichtig näherte er sich dem quer stehenden Auto. Als er um das Auto herumging, erkannte er einen dieser albernen Aufkleber. »Justin unterwegs«. Christopher war sich sicher, dass Justin nun nicht mehr unterwegs war. Es blieb nur zu hoffen, dass Justin nicht mittlerweile einen unnatürlichen Appetit auf Menschenfleisch entwickelt hatte. Die Türen waren geschlossen und durch die stark verschmutzten Scheiben konnte Chris nicht erkennen ob noch jemand in dem Auto saß. Daher klopfte er einfach an eines der Fenster. Doch nichts geschah. Das Auto, ein Ford Kombi mit einem Kindersitz auf der Rückbank, war leer. Chris sah keine Blutspuren und der dadurch entstehende Gedanke, dass die Insassen des Wagens vielleicht überlebt hatten, gefiel ihm.
»Justin doch noch unterwegs?«, murmelte er. Doch schnell wurde ihm klar, wie unrealistisch der Gedanke war.
Er öffnete die Tür, warf vorsichtshalber noch einen Blick hinter die Sitze und schob sich dann auf den Fahrersitz. Der Schlüssel steckte nicht, das Handschuhfach enthielt nur ein paar Papiere und einige Kekskrümel. Er löste die Handbremse und stellte fest, dass sie über die Zeit, vor allem jetzt nach dem Winter, wohl festsaß, aber zumindest den Gang konnte er herausnehmen. Er stieg aus dem Wagen und versuchte kurz, ihn anzuschieben, aber es rührte sich nichts. Der Wagen saß eindeutig fest, also würde er ihn mit dem Land Rover wegschieben müssen. Der Kofferraum öffnete sich mit einem leisen Knacken und gab seinen Inhalt preis. Chris begann zu suchen. Er fand jede Menge Gepäck, ein bisschen Spielzeug und dadurch wurde ihm klar, dass Justin wohl definitiv nicht mehr unterwegs sein würde.
Nachdenklich drehte er ein etwas abgegriffenes Spielzeug in der Hand. Wie viele solcher und ähnlicher Schicksale er in den letzten Jahren schon gesehen hatte. Bilder gingen ihm durch den Kopf. Bilder, die für Momentaufnahmen seiner Suche nach Genevieve standen.
In Frankreich hatte er ein ähnliches Auto untersucht. Auch das stand damals im Weg.
Er hatte sich von Sergej und Natalia am Tag zuvor verabschiedet. Nachdem sie drei Tage im Haus der Sterns verbracht hatten, hatten sich die Anderen wohl verzogen. Christopher sah den Zeitpunkt gekommen, nach Genevieve zu suchen. Er konnte nicht noch länger warten, denn die Untätigkeit raubte ihm den letzten Nerv. Sergej und Natalia wurden ebenfalls unruhig. Sie wollten nach ihren Familien sehen, die zum größten Teil hinter der Grenze in Frankreich lebten. Da an diesem Morgen keine Monster mehr in der Straße zu sehen waren, hielten die drei den Zeitpunkt für gekommen ihr Versteck zu verlassen. Sergej half Christopher noch, einiges an Ausrüstung zum Land Rover zu bringen, und der Abschied zwischen den dreien fiel kurz, aber herzlich aus. Sergej hielt ihm die Hand hin, und drückte sie.
«Sei vorsichtig, Towarisch. Viel Glück.« Er murmelte noch etwas auf Russisch hinterher. Natalia umarmte ihn und richtete ihm Grüße an Genevieve aus. Trotz der irrealen Situation standen die beiden dann noch an der Straße und winkten ihm hinterher. Er sah sie im Rückspiegel kleiner werden, bis er um die erste Kurve bog.
Er hat sie niemals wiedergesehen.
Ein paar Tage später war er kurz vor Metz. Die verstopften Autobahnen verlangten ihm einiges ab und er musste öfter stoppen als geplant. Letzten Endes war er auf Nebenstraßen ausgewichen.
Der alte Renault stand quer über der Straße und hatte sich in einen Wegweiser mit der Aufschrift »Metz 13 km« verkeilt. Schon als er noch etwa 5 Meter entfernt war, sah er den Frauenkörper, gehalten vom Sicherheitsgurt aus der Fahrertür hängen. Der Griff eines Messers ragte aus ihrem Ohr und das ausgetretene Blut hatte unregelmäßige Spuren auf dem Gesicht hinterlassen.
Während er vorsichtig nähertrat, sah er das tote Kind im Kindersitz. In den vergangenen Monaten hatte er viele ähnliche Bilder gesehen. Das Messer im Ohr der Frau wies darauf hin, dass jemand noch genug Mitgefühl gezeigt hatte, um sie zu erlösen.
Sein scharfes Kampfmesser durchschnitt kurz darauf den Sicherheitsgurt und er wich der herausrutschenden Leiche aus.
Mit einem ekelhaften Geräusch schlug der Kopf auf der Straße auf und als Christopher sich bückte, nahm er das Röcheln wahr. Sein Blick fiel auf den Kindersitz hinten im Wagen und er erstarrte. Das Kind war allenfalls zwei Jahre alt geworden.
Ein kleines Mädchen mit blutverschmiertem, wütend verzerrtem Gesicht hing in den Sicherheitsgurten und stieß dieses aggressive Röcheln aus, während es ihn anstarrte. Obschon er wusste, dass dieses kleine Wesen nicht mehr ansatzweise ein Mensch war, lief ihm ein Schauer nach dem nächsten über den Rücken. Eigentlich wusste er, was zu tun war. Doch in diesem Fall ging es um ein Kind. Genevieve hatte es abgelehnt, Kinder zu bekommen, doch in ihm war die Hoffnung geblieben. Kurz dachte er, dass er froh wäre, wenn jemand sein Kind in einer solchen Situation erlösen würde. Er musste sich entscheiden, jetzt. Seine Hand zitterte und er spürte die Tränen in seinen Augen, dann drückte er ab.
»Sie sollten sich wirklich nicht so unaufmerksam verhalten!«, Chris schrak zusammen und wirbelte herum, als die Stimme plötzlich hinter ihm die Stille durchbrach.
Etwa vier oder fünf Meter weiter stand ein Soldat. Sein Verständnis für die deutsche Bundeswehr war durch seine journalistische Arbeit entstanden. Daher erfasste er sofort, dass ein Leutnant vor ihm stand, auf dem Klettschild an der Brust war der Name »Martin« eingestickt. Die sandfarbene Tarnuniform ließ darauf schließen, dass der Mann wohl in einem Auslandseinsatz gewesen war. Das Sturmgewehr war sicher nicht so zufällig auf ihn gerichtet, wie es aussehen sollte. Trotz der hellen, grauen Augen und der etwas knarrenden, kalten Stimme wirkte das Gesicht freundlich, offen und zeigte sogar ein Lächeln.
»Ich konnte ihre Aktion da unten in der Stadt beobachten«, erklärte der Leutnant mit einem Nicken in die entsprechende Richtung. »Das war gar nicht mal schlecht. Ganz im Gegensatz zu ihrem Patzer hier. Ich konnte an sie herankommen, ohne mich groß anzustrengen.« Sein Blick wirkte forschend, abtastend, fast schon scannend.
Christopher nickte und begann sich zu fragen, wo der Mann wohl herkam. Unter dem Schmutz in dem Gesicht erkannte Christopher einige Falten. Die Entbehrungen der letzten Zeit hatten auch in diesem ansonsten freundlichen Gesicht ihre Spuren hinterlassen. Oder entstand der freundliche Gesichtsausdruck durch den wilden dunklen Vollbart? Er war sich nicht sicher. Er entschied sich, zunächst einmal den Regeln der Höflichkeit zu entsprechen. Irgendwie half ihm das, in diesem Chaos die Nerven besser zu behalten.
»Ich bin Christopher. Christopher Stern. Herr Leutnant.« Er versuchte sich in seinem freundlichsten Lächeln.
»Den Leutnant können wir sicher weglassen. Ich bin Niklas.«
»Ich muss zugeben, ich war wirklich unvorsichtig. Aber ich habe seit Monaten keine Menschen mehr getroffen und die Röchler neigen dazu, sich anzukündigen.«
Der Soldat zog die Augenbrauen hoch.
»Seit Monaten keine Menschen? Wie kommt das? Waren sie im Winterschlaf?«
Christopher lachte trocken auf.
»Ja, so etwas in der Art war es schon. Meine Frau und ich haben ein Haus. Strategisch günstige Lage. In einem Vorort, leicht zu verrammeln, kleine Ortschaft. Der Hausverkäufer nannte es damals ›ruhige Lage‹. Ruhige Lage bedeutet eben auch wenig Menschen. Und wenig Menschen bedeutet wenig von denen«, dabei nickte er hinter sich in Richtung Zweibrücken. Niklas senkte zustimmend den Kopf und blickte an Christopher vorbei, hinüber zur Stadt.
»Vielleicht können wir unseren Plausch unterwegs fortsetzen. Können… kannst du fahren und reden?«
Christopher folgte dem Blick und erkannte, dass aus der Stadt Andere herankamen. Ungefähr zwei Dutzend. Entweder waren sie ihm gefolgt, oder es war Zufall. Auf jeden Fall aber ein guter Grund zu verschwinden.
»Ich schlage vor, wir nehmen meinen Wagen.«
»Das trifft sich gut«, antwortete der Soldat. »Ich habe nämlich keinen.«
Sie rannten zum Land Rover, stiegen ein und schlossen die Türen. Niklas hatte zuvor das Sturmgewehr vom Rücken genommen und legte es sich auf die Beine.
Der Land Rover sprang entgegen Christophers vorheriger Befürchtung sofort an. Er deutete auf das Sturmgewehr.
»Haben sie genug Munition?« Niklas schüttelte leicht den Kopf.
»Das letzte Magazin, und das ist nicht mal mehr voll«, er deutete auf die Pistole, die quer vor seiner Brust hing. »Für die habe ich noch was. Aber auch nicht mehr viel.«
»Dann sollten wir uns besser nicht einholen lassen«, murmelte Christopher und erkannte im Rückspiegel, dass die ersten Monster schon recht nahe waren.
Er gab Gas, fuhr bis an die Familienkutsche heran und wurde langsamer, bis der erste Kontakt da war. Im Rückspiegel sah er, dass allenfalls noch zehn Meter zwischen ihnen und den Monstern waren. Er kuppelte, gab Gas. Mit einem hässlichen Quietschen schob sich der Geländewagen an den Kombi und begann zu schieben.
Acht Meter. Christopher lief der Schweiß über das Gesicht. Wenn die Biester an ihnen vorbeikamen, bestand die Gefahr, sich wieder festzufahren. Auch Niklas wurde nervös. Hektisch legte er immer wieder den Kopf auf die Seite, um in den Rückspiegel zu sehen, drehte den Kopf nach hinten, starrte wieder nach vorn.
»Komm schon, beweg dich. Scheißkarre.«
Sechs Meter. Der Motor drehte nun hoch, Christopher hielt die Lenkung eisern fest. Endlich begann der Kombi sich zu bewegen.
Vier Meter. Es knirschte lauter, der Kombi drückte sich gemächlich zur Seite.
»Komm schon«, flüsterte Christopher. Die Spannung schien ihn schier zu zerreißen. Er fühlte sich elend und hatte Angst, dass die Schließmuskeln versagen könnten.
Zwei Meter. Mit einem Ruck lösten sich endlich die Bremsen des Kombi. Er begann nach vorne zu rollen, wackelte, als er freikam, und bewegte sich langsam aus dem Weg. Dass der Wagen dann die kleine Böschung neben der Straße hinunter hoppelte, nahm Chris nur noch am Rande wahr. Schon hatten die ersten Anderen den Land Rover erreicht und streckten die Hände nach dem Heck aus. Doch sie waren zu spät.
Christopher gab Gas, schaltete schnell hoch und beschleunigte, so gut es eben ging. Zwar standen noch mehr Autos auf der Autobahn herum, doch die ließen sich problemlos umfahren.
Niklas atmete hörbar aus.
»Das war knapp.«
Christopher nickte zustimmend.
»Ja, war es. Verdammt knapp sogar.« Eine kleine Weile fuhren sie schweigend dahin, dann ging Christopher eine Frage durch den Kopf.
»Wieso hast du keinen fahrbaren Untersatz?«
Niklas schüttelte den Kopf.
»Ich hatte einen Wagen, aber mir ist der Sprit ausgegangen. Hier in der Nähe. Vor knapp vier Wochen.«
Christopher war überrascht.
»Vier Wochen? Was hast du in der Zeit gemacht?«
»Überlebt und nach Sprit gesucht.«, Niklas zuckte mit den Achseln. »Irgendwie ging es immer.«
Christopher nickte nachdenklich und schwieg. Sie waren kurz vor der nächsten Ausfahrt angekommen und er bemerkte, dass die Wagen hier wesentlich enger beieinanderstanden.