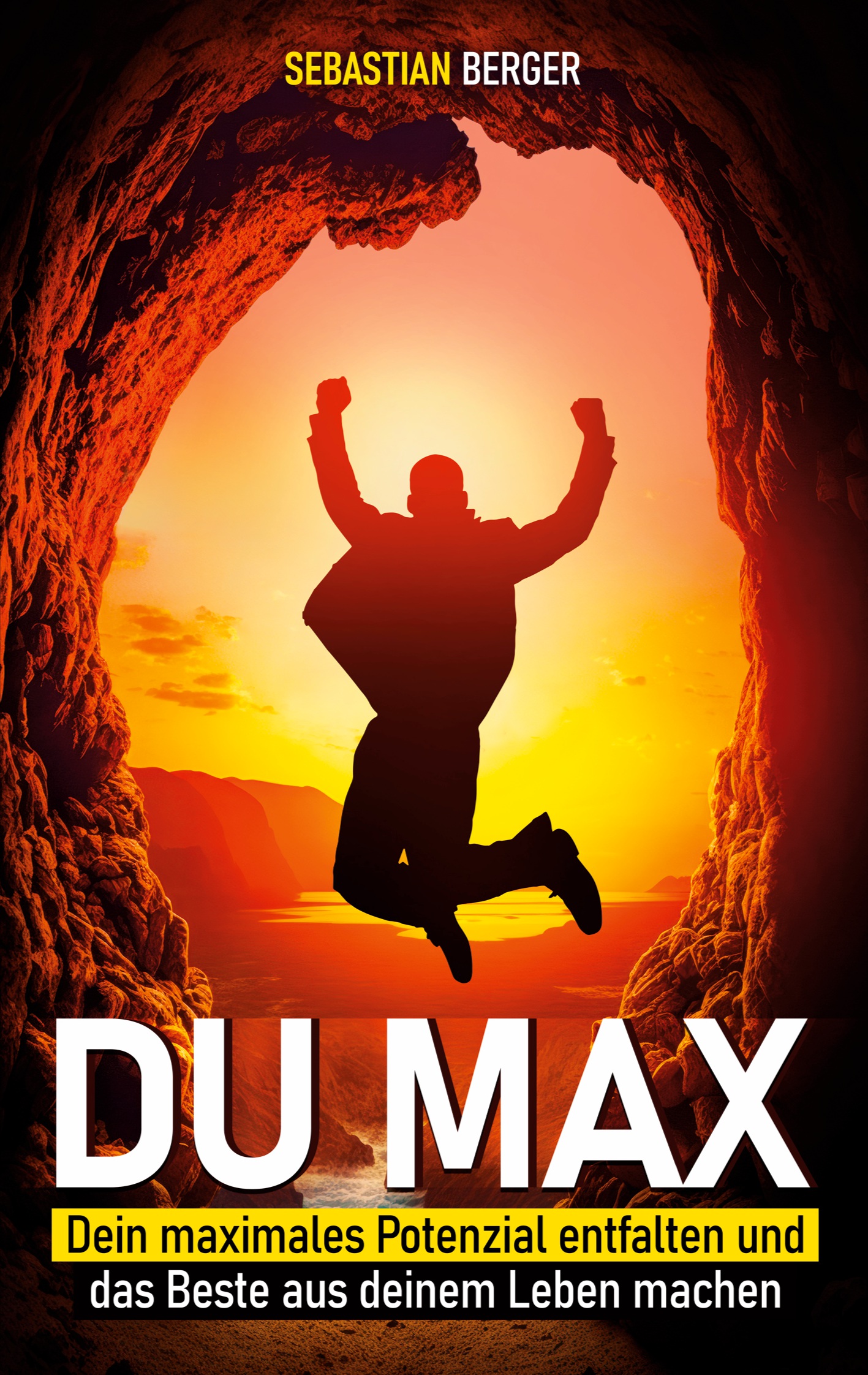17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Blick auf das menschliche Lernen
Babys sind wahre Lernwunder. Wie Wissenschaftler erkunden Sie ihre Umgebung experimentell, werten statistische Informationen aus und leiten daraus allgemeingültige Regelmäßigkeiten ab. Sebastian Berger eröffnet uns einen neuen Blick auf die faszinierende Welt dieses frühkindlichen Lernens. Er erlaubt es uns, Kinder besser zu verstehen und wertzuschätzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Wunderwerk Baby
»In jedem Jahr starten 150 Millionen Forschungsreisen, nahezu unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Die Forscher sitzen dabei nicht in Universitäten und Laboren. Es sind unsere kleinen Kinder. Der Wunsch danach, den Dingen auf den Grund zu gehen, prägt uns Menschen ab dem allerersten Tag.«
Babys sind wahre Lernwunder. Was Erwachsenen häufig als unsinniges Verhalten oder zielloser Zeitvertreib erscheint, sind jedoch Experimente, die kleine Kinder durchführen und auswerten, um sich daraus in atemberaubendem Tempo ihre Lebenswelt zu erschließen. Wer die faszinierende Welt frühkindlichen Lernens versteht, kann Kinder besser begreifen, wertschätzen und von ihnen lernen.Ein neuer Blick auf Kinder zwischen 0 und 2 Jahren
Prof. Dr. Sebastian Berger promovierte in Wirtschafts- und Sozialpsychologie an der Universität Köln. Es folgten Forschungstätigkeiten an den Universitäten Köln, Stanford und Lausanne. Seit 2015 ist er Assistenzprofessor für Organisationsforschung an der Universität Bern. Seine Forschung wurde global in den Medien diskutiert, unter anderem in der »New York Times«, »Washington Post«, »FAZ«, »SZ« und »NZZ«. Mit der Geburt seines ersten Kindes begann sich Sebastian Berger auch von einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus für kindliche Frühentwicklung zu interessieren. Er lebt mit seiner Familie in Köln.
Als der Wissenschaftler Sebastian Berger Vater wird, bemerkt er schnell: Babys werden extrem unterschätzt. In diesem Buch führt er uns in die beeindruckende Welt der kleinen Lernwunder ein. Er zeigt auf, dass Babys nicht nur weitaus schneller lernen als Erwachsene, sondern ähnlich wie Wissenschaftler die Welt experimentell erkunden, aus statistischen Informationen ihre Schlüsse ziehen und daraus allgemeingültige Regelmäßigkeiten ableiten. Aus einzelnen Beobachtungen gewinnen Kinder zum Beispiel Hinweise auf physikalische Naturgesetze und eignen sich wichtige Fähigkeiten wie Vertrauen und Kooperationsfähigkeit an. Binnen weniger Jahre sind sie so in der Lage, die Welt perfekt zu erfassen und in ihr zu navigieren. Dieses Buch bietet eine neue Perspektive darauf, was es bedeutet, Mensch zu sein. Zudem ermöglicht es Eltern, ihre Kinder besser zu verstehen und ihnen dadurch besser zu helfen, sich zu entfalten – zum Beispiel, indem sie manchmal weniger als mehr tun.
SEBASTIAN BERGER
Geniale Kindsköpfe
Wie Babys die Welt erforschen und was wir von ihnen lernen können
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlag: Weiss Werkstatt, MünchenUmschlagmotiv: © plainpicture/Angela FrankeRedaktion: Birthe VogelmannSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-23120-0V002www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
Teil 1: Das Baby als Wissenschaftler
Ein kurzer Rückblick auf unsere Stammesgeschichte
Unbeschriebenes Blatt oder angeborenes Genie?
Behaviorismus: Verhalten als einziger Pfad zur Weisheit?
Die kognitive Wende
Babys reden nicht, aber sie schauen
Babys lernen durch Forschung
Eine Theorie des Lernens
Babys und die Fähigkeit zur Logik
Babys als kleine Statistiker
»Es irrt der Mensch, solang’ er strebt«
Gott würfelt nicht, oder doch?
Mit dem Zufall umgehen
Die Entwicklung der reinen Vernunft
Wo ist das kindliche Labor?
Teil 2: Das Baby als Sozialwissenschaftler
Ein besonderes Tier
Imitation Game
Das Geheimnis der Kooperation
Leute gucken (und lernen)
Vertrauen in Vernunft
Die Qualität des Helfens
Lügen und Betrügen – eine geistige Meisterleistung
Der Brokkoli-Test
Licht einschalten per K(n)opfdruck
Moralische Babys?
Teil 3: Das Baby als Geisteswissenschaftler
Kinder und die Sprache
Ohne Sprache kein Denken?
Den Sprachcode knacken
Was ist ein Wort?
Vom linguistischen Weltbürger zum Muttersprachler
Der fünffüßige Jambus mit angehängtem Trochäus
Soziales Sprachelernen
Ein Vokabeltest für Babys
Lernen durch die Geschichten anderer
Kunst steht für etwas Reales
Musikverständnis bei Babys
Teil 4: Das Baby als Naturwissenschaftler
Mathematik: Zum Lernen nötig
Babys als Mathematiker
Ein mentaler Zahlenstrahl
Aus den Augen ist nicht aus dem Sinn
Babys als na(t)ive Biologen
Wesenskerne
Teil 5: Kindheit als Forschungszeit
Wie ist es, ein Baby zu sein?
Die Spezies, die nicht erwachsen werden wollte
Grenzenlose Neugier und Optimismus
Imitation und Innovation
Das Wissenschaftsdilemma – die Tragik der Elternschaft
Forschende Kinder und kindliche Forscher
Was ist das Ziel von Erziehung?
Individualität
Danksagung – Auf den Schultern von Giganten
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Vorwort
In jedem Jahr starten 150 Millionen Forschungsreisen in die Welt, nahezu unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Auf jeder dieser Expeditionen werden fundamentale Fragen zum Universum beantwortet: Wie funktionieren die elementaren physikalischen Gesetze? Was sind die Grundlagen der Logik und der Mathematik? Wie gelingt das soziale Miteinander der Menschen? Wie fühlt es sich an: das Leben? Die Forscher sitzen dabei nicht in den Universitäten und Laboren der Welt. Es sind unsere Babys und kleinen Kinder. Wissenschaftliche Neugier entwickelt sich nämlich nicht erst bei Studierenden im Laufe der Semester. Der Wunsch danach, den Dingen auf den Grund zu gehen und alles verstehen zu wollen, prägt uns vielmehr seit frühester Kindheit, ab dem allerersten Tag.
Dieser unglaublich früh einsetzende Erkenntnisdrang wurde mir mit der Geburt meines ersten Sohnes erst richtig bewusst. Infolgedessen begann ich mich mit all den damit zusammenhängenden Fragen zu beschäftigen: Wie genau lernen Babys eigentlich die Welt verstehen? Wie experimentieren sie? Wie ich herausfand, sind Babys schon ab der Geburt alles andere als der »perfekte Idiot«, wie sie etwas unfein von Jean-Jacques Rousseau bezeichnet wurden. Sie sind tatsächlich eher dem Wissenschaftler ähnlich und erforschen die Welt mithilfe komplexer statistischer und experimenteller Methoden. In dieser Hinsicht könnten wir Erwachsenen uns oftmals ein Beispiel an ihnen nehmen.
Joshua Tenenbaum, der am Massachusetts Institute of Technology in der Computational Cognitive Science Group forscht, ordnet seiner Arbeit eine Fragestellung über: »Wie lernen Babys und kleine Kinder so schnell durch so wenig Daten?« Denn die Entwicklungsforscher untersuchen die Verhaltensweisen unserer kleinsten Mitmenschen auch aus einem bestimmten Grund: Sie können Robotern das Denken beibringen. Das Lernen von Babys gilt als Blaupause für die Weiterentwicklung von Maschinen. Diese gelten erst als intelligent, wenn sie die Lernleistung eines Babys bewältigen.
Bei meinen Recherchen leiteten mich Fragen, die mir immer bewusster wurden, je mehr ich mich mit meinem eigenen Sprössling beschäftigte: Wie ist es, ein Kind zu sein? Was geht im Kopf eines Babys vor, wenn es die Welt entdeckt? Was navigiert den Wissensdrang der kleinen Forscher? Mit welchem Vorwissen kommen wir auf die Welt?
Ich selbst bewege mich heute scheinbar mühelos durch den Alltag und radle gedankenverloren durch die Stadt. Ich weiß, dass mich der Stein des Bürgersteiges dabei trägt, das Wasser des Sees jedoch nicht. Ich vertraue darauf, dass alle Verkehrsteilnehmer die rechte Straßenseite benutzen und fahre daher mit dem Fahrrad ebenfalls rechts. Setzt ein Auto vor der Kreuzung den Blinker nach rechts, werde ich etwas skeptisch und frage mich: Wird der Fahrer wohl an den Schulterblick denken, oder soll ich lieber anhalten?
Es braucht also offensichtlich schon sehr viel Wissen, um einfach nur morgens von zu Hause ins Büro zu kommen. Ich wende dabei Theorien der Physik (auf Asphalt kann man Fahrrad fahren) und der Psychologie (der Autofahrer schaut bestimmt nicht über die Schulter, ich fahre lieber vorsichtig in die Kreuzung hinein) an und ich weiß, dass mein Zuhause noch existiert, wenn ich auch gerade selbst nicht dort bin. Wie habe ich das eigentlich gelernt? Wann werden meine Kinder all das lernen? Wie ist es, all dieses Wissen erst zu erwerben? Gibt es einen Weg für mich als Erwachsenen, das irgendwie nachzuvollziehen? Diese Fragen ließen mich nicht mehr los.
In fast jedem Haushalt mit Kindern gibt es eine Fülle an praktischen Ratgebern, die zu jeder Elternfrage eine Antwort parat haben. Dieses Buch ist dagegen vor allem eines: unpraktisch. An keiner Stelle wird es einen konkreten Tipp geben wie: Tun Sie dies, tun Sie das! Ein guter Vater ist man so, eine gute Mutter macht dieses oder jenes. Für mich als Wissenschaftler ist »unpraktisch« kein negatives Wort. Ganz im Gegenteil. Ich will Wissen erwerben und anderen zugänglich machen, einfach um des Wissens willen – auch ohne konkrete Tipps. Und ich denke, so geht es vielen anderen Eltern auch.
Die wohl wichtigste Erkenntnis meiner Nachforschungen zu diesem Buch war die folgende: Wir sind uns ähnlich, meine Kinder und ich. Wir beide erforschen die Welt mit Neugier, wir entwickeln Theorien und überprüfen diese in manchmal sehr einfachen, häufig aber auch komplexen Experimenten. Das kindliche Gehirn speichert jede Beobachtung ab. Minutiös führt es innerlich Buch über Erfahrung um Erfahrung – so, wie ein Wissenschaftler sein Labortagebuch führt. Wie fühlt sich der Baustein an? Wie schmeckt er? Wie hört es sich an, wenn ich ihn auf den Boden werfe? Warum ist »Au-to« ein Wort, »To-au« aber eher nicht?
Während ich meinem ersten Sohn dabei zusah, wie er sich seine Welt erschloss, erfuhr ich gleichzeitig in meinen Recherchen, wie genau das Lernen bei ihm, und damit der Menschheit, eigentlich funktioniert. Es ergaben sich immer faszinierende Details und Zusammenhänge. In diesem Buch möchte ich Sie daran teilhaben lassen und in die spannende Welt der Entwicklungsforschung entführen, die die unglaublichsten Experimente auf die Beine stellt, um die Erfahrungen der ganz Kleinen nachzuvollziehen. Eines ihrer Ergebnisse ist: In ihrem ersten Lebensjahr führen Babys bereits Experimente durch, die sich vor denen von Galileo Galilei, Isaac Newton oder Sigmund Freud nicht verstecken müssen. Sie lernen sich selbst und die Welt, in der sie leben, mit atemberaubender Geschwindigkeit und Präzision kennen. Innerhalb weniger Monate können sie aus akustischen Signalen die Wünsche und Vorlieben anderer Menschen herauslesen. Sie sind im Stande, akustische und visuelle Signale auszusenden, die von anderen verstanden werden. Aus einem Meer an Information interpretieren Kleinkinder innerhalb kürzester Zeit Dinge wie »Mama ist glücklich«, »Papa hat Hunger« oder »Oma ist müde«. Bereits Momente nach der Geburt, wenn zum ersten Mal Licht ins Auge eines Babys fällt und es die Eltern betrachtet, stellt es seine erste wissenschaftliche Hypothese auf: »Ich bin wie du. Wir gehören zusammen.« Darauf aufbauend folgt ein wahrer Lernmarathon.
Diejenigen, die mit Forschern oder kleinen Kindern zusammenleben, können ein Lied davon singen, dass ihr manchmal zielloses Anhäufen von Wissen das Leben ihrer Mitmenschen nicht unbedingt einfacher macht. So wünscht sich meine Frau beispielsweise, während ich diese Zeilen schreibe, dass ich mich stattdessen endlich bei diversen Kindergärten informiere, wie wir dort einen Platz ergattern können. Ich teile dieses Bedürfnis, aber wichtiger sind mir zunächst andere Fragen: Wenn irgendwann die Menschheit als Spezies aus einem Ur-Exemplar entstanden ist, müssten ja theoretisch alle Menschen auf dieses eine Exemplar zurückgehen? Ob Anthropologen wohl bereits wissen, wer unsere ältesten Verwandten sind? Welcher Ururur(…)großvater oder welche Ururur(…)großmutter ist eigentlich unser/e aller Verwandte/r? Wo hat diese Person gelebt und wie hat sie wohl einen durchschnittlichen Tag verbracht? Ein Abend intensiver Recherche, der zwar ohne Kindergartenplatz, aber dafür mit der Erkenntnis endet, dass es eine mitochondriale Eva1 gibt, also eine Urmutter, von der wir alle abstammen und über deren Lebensumstände wir sogar sehr viel wissen, lässt mich zufrieden einschlafen.
Wissenschaftler wie Kinder prägt die Neugier, etwas wissen zu wollen, obwohl wir noch nicht abschätzen können, wozu es einmal gut sein könnte. Oft ist es so, dass später doch noch etwas »Sinnvolles« dabei herauskommt, völlig unerwartet. In dem AMES Research Center der NASA in Kalifornien steht eine Sammlung nützlicher Gegenstände, die aus der NASA-Forschung resultieren, ohne dass man dies je erwartet hätte. Es ist ein Kuriositätenkabinett, das vom Infrarotfieberthermometer über den Rauchmelder bis zur olympischen Badehose reicht. Ebenso wenig wie die Grundlagenforschung der Wissenschaftler scheint das tägliche Spiel kleiner Kinder für Außenstehende zielgerichtet zu sein. Deshalb kommt uns die kindliche Reaktion auf eine Spielunterbrechung auch oft sehr übertrieben vor. Irgendwo las ich einmal die verzweifelt-komödiantische Aussage einer jungen Mutter: »Bevor ich Kinder hatte, wusste ich nicht, dass man den Tag eines Menschen scheinbar völlig ruinieren kann, weil man diesen bittet, eine Hose anzuziehen.« Was wir als Eltern nicht wissen, ist, welches bahnbrechende Experiment wir mit dieser profanen Bitte vielleicht soeben unterbrachen.
Aus meinem gesammelten, zunächst »unpraktischen« Wissen erwuchs mir dann letztlich doch eine sehr praktische Einsicht: Ich kann als Vater getrost gelassener sein und auf den beständigen Erkenntnisfortschritt meiner Kinder vertrauen. Wir sind als Spezies schon sehr weit gekommen, und der Staffelstab wird nun einfach weitergereicht. Unser Nachwuchs steht auf den genetischen und kulturellen Schultern der gesamten Menschheit. Sie sind dafür gemacht, die Welt zu erforschen und zu verstehen, aus ureigenem Antrieb. Ich muss mir also keine Sorgen darum machen. Meine Aufgabe ist es nicht, mein Kind zu formen wie ein Zimmermann ein Stück Holz formt. Die Entwicklungspsychologin Alison Gopnik definierte nach ihrer jahrzehntelangen Forschungskarriere die Rolle der Eltern neu: Wir sollten uns als Gärtner sehen, die das Pflänzchen vor allem am Leben halten müssten, es gedeihe dann von ganz alleine.2 Und in der Tat: Wenn man die Entwicklung von Babys als Forschungsreise eines selbstmotivierten, autonomen Lebewesens ansieht, erhält man einen ganz neuen Blick auf sie. (Fast) alles, was ein Baby tut, dient dem Erlernen der Welt oder der Tatsache, dass es auch morgen noch lernen will und daher essen und schlafen muss.
Meine Söhne als kleine Wissenschaftler zu sehen, spendet also gleichzeitig Trost und Gelassenheit: Wenn das Mittagessen in gefühlter Endlosschleife auf den Boden geworfen wird, denke ich nicht mehr an den Wischmob, den ich nach jedem Essen nutzen muss. Ich denke an Isaac Newton, der durch seine Experimente der Schwerkraft auf die Spur gekommen ist. Ich stelle mir vor, wie auch mein Kind einen Aha-Moment haben wird, wenn es durch sein Tun die Gesetze der Schwerkraft verstanden und seine eigene »Gravitationstheorie« formuliert haben wird: »Egal, wie oft ich das Essen auf den Boden werfe, es wird immer auf den Fliesen landen. Es wird niemals in die Luft fliegen. Kein Gegenstand wird jemals in die Luft schweben – Brokkoli nicht, Blumenkohl nicht, Nudeln nicht, nicht mal das Käsebrot. Alles fällt auf den Boden.« Dies wird dann der letzte Tag des Experiments sein, und der Wischmob kann im Schrank bleiben.
Wenn ich morgens um fünf von einem strahlenden Kind geweckt werde, das zum ersten Mal auf zwei wackligen Beinen vor mir steht, dann denke ich nicht an die Müdigkeit, sondern mir kommen die ersten Schritte Buzz Aldrins auf dem Mond in den Sinn: Vielleicht ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für mich.3 Wenn die Murmeln der Kugelbahn seit gefühlten Stunden auf den Parkettboden knallen und den Nachbarn vermutlich den letzten Nerv rauben, sinniere ich darüber, wie Galileo Galilei wohl auf die Idee kam, Fallgesetze und die Trägheit physikalischer Körper mit ebensolchen Kugelbahnen in »Zeitlupe« zu erforschen. Langsam begreife ich die Natur meines Sohnes und was meine Aufgabe als Vater ist: Er ist kein unfertiger, präkognitiver (d. h. noch nicht denkender) Mensch, wie noch der Gründer der Entwicklungspsychologie, Jean Piaget, kleine Kinder beschrieb. Er ist ein Forscher auf Expeditionsreise und ich bin sein Assistent.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude bei der Entdeckungsreise in den Geist der kleinsten Menschen, unserer Kinder. Ich hoffe, dass sie nach der Lektüre mehr wissen als im Moment. Neben vielerlei wissenschaftlicher Erkenntnis soll das Buch auch ein Werben für das scheinbar ziellose Forschen sein und für diejenigen, die es täglich tun: geniale Kindsköpfe in Windeln – und in Laborkitteln.
Teil 1Das Baby als Wissenschaftler
Der Naturforscher Alexander von Humboldt war dafür bekannt, seinen Wissensdurst aus einem ganz besonderen Gefühl heraus zu stillen: Er empfand eine tiefe emotionale Bindung zu seinem Forschungsgegenstand, der Natur. Aus diesem Grund waren Wissenschaft und Künste, Analyse und Erlebnis, Lernen und Fühlen für ihn auch keine Gegensätze, sondern zwei Seiten ein und derselben Medaille. Alexander von Humboldt hatte ein tiefes, emotionales Bedürfnis nach neuen Erkenntnissen. Der Anblick des Chimborazo in Ecuador, den man damals noch für den höchsten Berg der Welt hielt, bewegte Humboldt so stark, dass er nicht aufhören konnte, diesen zu erforschen. Ich glaube, dass es ein ähnliches Bedürfnis gibt, wenn man selbst die aufregende Reise der Elternschaft antritt. Aus diesem Gefühl heraus entstehen ein Wissensdurst und eine Neugier, die ich selbst sehr deutlich spüre, als Wissenschaftler und als Vater. Wir beginnen unsere ganz konkrete Forschungsreise in den Geist der kleinsten Menschen, unserer Babys, mit einem Blick in unsere gemeinsame Vergangenheit – die der ganzen Menschheit.
Ein kurzer Rückblick auf unsere Stammesgeschichte
»Ich denke.« Diese Worte finden sich im Notizblock eines zum damaligen Zeitpunkt noch recht unbekannten Forschers. Die rudimentäre Zeichnung darunter zeigt den Baum des Lebens, der Autor ist Charles Darwin. Heute wird davon ausgegangen, dass diese Zeichnung (Abbildung 1) die erste Verschriftlichung seiner Evolutionstheorie ist. Die zentrale Frage von Darwins Forschung war die nach der Entstehung der Arten. Woher kommt der Mensch? Wie wurden wir, wer wir heute sind?
Die Entwicklung eines bestimmten Menschen vom Baby zum Greis – seine Ontogenese – lässt sich eigentlich nur vor dem Hintergrund der Entwicklung der ganzen Menschheit – der Phylogenese – verstehen. Eine ganz kurze Geschichte unserer Spezies hilft also, uns als Menschen einzuordnen um die Entwicklung eines heutigen Babys nachvollziehen zu können. Der Historiker Yuval Noah Harari beschreibt eine der vielen Implikationen von Darwins Theorie eindrucksvoll in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit: »Vor gerade einmal sechs Millionen Jahren brachte eine Mutter zwei Töchter zur Welt: Eine der beiden wurde die Urahnin aller Schimpansen, die andere ist unsere eigene Ur-Ur-Ur-Großmutter.«4 Die beiden Geschwister spielten vermutlich miteinander, aßen gemeinsam und schliefen zusammen bei ihrer Mutter, so wie viele Geschwister – ob Mensch oder Schimpanse – es heute noch tun. Die beiden Linien lebten etwa 3,5 Millionen Jahre lang, bevor die ersten Vertreter der Gattung Mensch, Homo, den Planeten vor etwa 2,5 Millionen Jahren betraten. Die Gattung Homo entwickelte sich aus dem Australopithecus (südlicher Affe). Dieser archaische Vertreter hatte sich bereits auf eine Reise nach Nordafrika, Europa und Asien gemacht. Wir – der Homo sapiens – sind eine von vielen menschlichen Arten, die einst auf der Erde heimisch waren. Wir sind es heute gewohnt, dass wir die einzigen Menschen auf dem Planeten Erde sind. Dies war jedoch nur in den letzten 10000 Jahren der Fall. Wir teilten uns einmal die Erde mit vielen anderen Vertretern der Gattung Homo, der bekannteste verstorbene Verwandte ist der Neandertaler, der vor etwa 30000 Jahren ausstarb. Weitere bekannte Menschenarten waren der Homo erectus, der etwa zwei Millionen Jahre existierte und damit der am längsten existierende Mensch war. Diese weiteren Menschenarten bildeten sich unabhängig vom Homo sapiens (der »weise Mensch«) aus, eben, weil Australopithecus irgendwann losmarschiert war. Wir (Homo sapiens) machten uns vor etwa 70000 Jahren auf, Ostafrika zu verlassen und trafen später auf unsere Schwestern und Brüder, die sich an anderen Orten der Welt entwickelt hatten. Binnen weniger zehntausender Jahre verbreiteten wir uns auf dem ganzen Planeten, im Jahre 1969 unserer Zeitrechnung betraten wir erstmals den Mond. Keine andere Menschenart überlebte bis heute.
Abbildung 1:Auf diesem Blatt Papier in Charles Darwins Notizblock könnte seine Evolutionstheorie der natürlichen Selektion den Anfang genommen haben. Zu sehen ist das Original im American Museum of Natural History in Manhattan5
Uns Menschen zeichnet aus, dass wir rapide lernen und verstehen können. Dem Argument, dass Babys wie Wissenschaftler lernen, liegt die Tatsache zugrunde, dass wir evolutionär dazu geprägt worden sind. Es ist interessant zu erforschen, wie die kognitiven Leistungen des modernen Menschen sich entwickelten. Eine mögliche Ursache ist das Hirnwachstum. Menschen haben in der Tat relativ große Gehirne, aber das ist ja per se kein Garant für evolutionären Erfolg. Und Forschungsarbeiten zeigen auch, dass das menschliche Gehirn schon recht lange recht groß war, bevor die rapide kognitive Entwicklung einsetzte. Mitglieder der Gattung Homo (alle Menschenarten) verfügen seit Millionen Jahren über eine große relative Hirnmasse, im Verhältnis zur Körpermasse. Das Gehirn des Neandertalers war sogar (relativ) größer als das vom Homo Sapiens. Trotzdem lebte der Mensch über lange Zeit in der Mitte der Nahrungskette. Er sammelte und jagte ein wenig, musste aber aufpassen, nicht selbst gejagt zu werden. Irgendwann änderte sich das, und er gelangte binnen kürzester Zeit an die Spitze der Nahrungskette. Heute laufen wir generell nicht mehr Gefahr, aufgefressen zu werden. Wenn es in seltenen Fällen doch passiert, beherrscht dies tagelang die Nachrichten, zum Beispiel bei Haiattacken. Die schiere Größe des Gehirns kann für unseren Aufstieg an die Spitze der Nahrungskette nicht den Ausschlag gegeben haben, denn der Aufstieg des Menschen erfolgte mit sehr großer Verzögerung auf die Entwicklung eines großen Gehirns. Was spielte sich also ab, und wann geschah das?
Vor etwa 70000 bis 30000 Jahren passierte einiges, was die Forscherwelt als Hinweis darauf akzeptiert, dass sich bestimmte Fähigkeiten des Menschen rapide entwickelt haben müssen: Zum ersten Mal bauten die Menschen Boote, nutzten Lampen und erfanden Nähnadeln.6 Ebenso tauchten zum ersten Mal Kunstgegenstände auf, welche darauf hinweisen, dass es komplexere religiöse oder andere kulturelle Rituale gab. Menschen zu dieser Zeit beherrschten eine komplexe Sprache mit linguistischen Eigenschaften, die auch heutige Sprachen noch haben. Wir – die Menschen des 21. Jahrhunderts – hätten uns mit diesen vorzeitlichen Menschen problemlos unterhalten können, nachdem wir deren Sprache gelernt hätten. Wir hätten uns gegenseitig Geschichten erzählen und unseren Vorfahren unser Verständnis der Welt erklären können.
Es ist dabei nicht völlig klar, warum sich diese Fähigkeiten beim Homo sapiens zu dieser Zeit so rapide entwickelten. Es könnten zufällig bedingte genetische Mutationen gewesen sein, die verschiedene Schaltkreise im Gehirn änderten. Vermutlich war es ebenso ein reiner Zufall, dass diese Mutationen beim Homosapiens auftraten und nicht beim Neandertaler oder beim Homo erectus.7 Kurz gesagt: Wir haben nichts dafür getan, aber diese Entwicklung scheint uns einen Vorteil gegenüber den Menschenarten verschafft zu haben, deren Schaltkreise im Gehirn nicht genauso mutiert waren.
Diese Entwicklung bezeichnet Harari als kognitive Revolution.8 Sie gilt als die Ursache für viele heutige, typisch menschliche Kompetenzen wie die Fähigkeit, mit anderen Vertretern unserer Spezies zu kooperieren. Wir kommunizieren mündlich und schriftlich, unabhängig von Zeit und Ort. Wir verstehen die physikalischen, biologischen und chemischen Gesetze und können die Welt manipulieren. Entsprechend können wir Flugzeuge konstruieren, mit denen wir fliegen können, obwohl wir keine Flügel haben. Wir bauen Züge, die uns mit 300 Kilometern pro Stunde reisen lassen, schneller als jedes andere Tier laufen kann. Ein Baby lernt all das, was uns als Menschen ausmacht, zum Beispiel, andere Menschen zu lesen und ihnen zu vertrauen oder Werkzeuge zu bauen, die uns das Leben erleichtern. All diese Fähigkeiten gehen zurück auf ein paar arbiträre genetische Mutationen, die vor 70000 bis 30000 Jahren auftraten und die der Menschheit einen Überlebensvorteil brachten. Zufällig trat bei irgendeinem unserer Verwandten diese genetische Änderung auf und katapultierte die Menschheit in die Spitzengruppe der intelligenten Lebewesen.9
Unbeschriebenes Blatt oder angeborenes Genie?
Eine Frage, die (manche) Leute bis heute streiten lässt, ist diejenige, ob der Mensch durch seine Gene (der nativistische Blick) oder die Umwelt (der empiristische Blick) geprägt ist.10 Sind wir unbeschriebene Blätter, die durch Erfahrung lernen, oder haben wir tief verwurzeltes Wissen, das uns durch die Evolution geschenkt ist? Auch wenn dies heute praktisch beantwortet ist und unentschieden ausging, ist es sinnvoll, sich mit dem Thema »Gen versus Umwelt« zu beschäftigen. Denn implizit steckt diese Frage in jeder Theorie des Lernens und somit in jeder Theorie der Erziehung: Weiß ein Baby etwas, wenn es erstmals das Licht der Welt erblickt? Auf welchen Dingen basieren die Erkenntnisgewinne der Babys? Wenn wir verstehen wollen, wie Babys und kleine Kinder lernen, müssen wir wissen, welche Fähigkeiten angeboren sind und wie die Umwelt die Lernerfahrung wiederum prägt.
Die Metapher des unbeschriebenen Blattes geht auf den englischen Philosophen John Locke zurück, der in seinem Essay Concerning Human Understanding11 im Jahre 1690 erstmals argumentierte, dass der Mensch ein »unbeschriebenes Blatt« sei, das nur durch eine Variable lerne: Erfahrung. Die Umwelt präge also den Menschen. Locke kritisierte hierbei die Aussage, dass gewisse Dinge wie ein Sinn für Gott, ewige Wahrheiten oder mathematische Ideale angeboren seien.12 Lockes Theorie war gleichzeitig eine Theorie der Psychologie (wie tickt der Mensch?) und der Epistemologie (wie können wir überhaupt etwas wissen?).13 Sie entstand zu einer Zeit, in der weltliche Privilegien durch angeborene (göttlich geprägte) Unterschiede legitimiert wurden. Ein absolutistischer Herrscher galt durch Geburt als etwas Besseres, Frauen galten als dem Mann unterstellt, Weiße erhoben sich über ihre Mitmenschen. Locke griff durch seine Argumentation, dass wir alle als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen, die Berechtigung dieser Diskriminierung an. Unterschiede sind nicht gottgegeben, sondern menschengemacht. Vielfach wird er daher als Gründer der Theorie des politischen Liberalismus bezeichnet.14 Auch heute gibt es immer noch die Ansicht, dass Menschen aufgrund angeborener Verschiedenheiten unterschiedlich zu bewerten seien. In Deutschland ist es noch nicht einmal 100 Jahre her, dass aufgrund von Theorien über naturgegebene Unterschiede Rassenpolitik und eugenetische Programme mit dem Ziel, den Anteil positiv bewerteter Erbanlagen innerhalb der Bevölkerung zu vergrößern, staatlich legitimiert wurden. In unserem Nachbarland der Schweiz besitzen Frauen erst seit wenigen Jahrzehnten das Recht zu wählen.
Dies stellt eine starke Instrumentalisierung und einen Missbrauch der Theorie von angeborenem Wissen und inhärenten Talenten dar. Gerade die Tatsache, dass wir alle über angeborene Prädispositionen verfügen, könnte ebenso eine Theorie der Gerechtigkeit motivieren: Niemand ist dafür verantwortlich, mit welchen Genen er auf die Welt kommt und welcher Umwelt er ausgesetzt ist. Daher eignen sich gerade diese Unterschiede, um gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Komplexe Wechselwirkungen zwischen Veranlagung und Umwelteinfluss könnten – sofern sich beide Variablen auch noch gegenseitig verstärken – den Kampf gegen Ungerechtigkeit noch viel mehr motivieren. Gerade in der Bildungspolitik wird stets an der Chancengerechtigkeit zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Kindern gezweifelt.
Wenn wir die Entwicklung von Babys untersuchen, schauen wir nicht in erster Linie nach genetisch bedingten Unterschieden, sondern vielmehr nach den angeborenen Universalien – nach dem, was uns allen gemeinsam ist. Wenn im Kontext dieses Buches von angeborenem Wissen gesprochen wird, ist damit etwas gemeint, das allen gesunden Menschen angeboren ist. Wir alle haben zwei Beine, zwei Arme, zwei Augen, zwei Nieren, ein Gehirn. Bei der Frage nach angeborenen kognitiven Prädispositionen geht es darum, was uns als Menschen eint, und nicht, was uns auseinandertreibt. Denn so unterschiedlich wir alle sein mögen, niemand von uns möchte ungerecht behandelt werden, niemand ist gerne eines anderen Sklave und niemand will hungern oder verdursten. Es gibt sehr viel mehr, was wir alle gemeinsam haben. Donald E. Brown publizierte im Jahre 1991 eine Liste der menschlichen Universalien, also all dessen, was allen Menschen zu eigen ist.15 Hierzu gehören Hunderte Dinge, unter anderem Schmerz, Freude, Poesie, die Fähigkeit zur Logik, abstrakte Sprache, die Handhabung von Spielzeug oder zeitliches Empfinden. Es geht um diese Grundfesten der menschlichen Existenz, wenn man fragt: Was ist unseren Babys angeboren und wie lernen sie darauf basierend die Welt zu verstehen?
Während die Metapher des unbeschriebenen Blattes John Locke zugesprochen wird, beschäftigt die Frage, was der Mensch weiß, wenn er das Licht der Welt erblickt, die Denker und Forscher schon so lange wir zurückschauen können. Auch wenn dies sicherlich nicht der Ursprung der Debatte ist, lassen wir diesen Streit im antiken Griechenland, dem Geburtsort der westlichen Philosophie, beginnen.16 Platon geht in seinem Werk Menon, einem Dialog zwischen seinem Lehrer Sokrates und Menon von Pharsalos, der Frage nach, ob Tugend erlernt oder angeboren sei. Platon argumentierte, dass alles Wissen bereits im Kopf vorhanden ist und lediglich aufgesammelt werden muss. Also müsste es seinem Lehrer Sokrates im Menon gelingen, durch gezieltes Fragen komplexe mathematische Regeln im Kopf eines Sklaven zu erschließen. Letztlich leitet der Sklave tatsächlich den Satz von Pythagoras her. Ergo: Sokrates erbringt den Beweis, dass bestimmte Arten von Wissen, wie ein Verständnis mathematisch-geometrischer Prinzipien, angeboren sind. Da ein Sklave im antiken Griechenland keinerlei Bildung erhielt, musste dieses Wissen angeboren sein, da er den Satz herleiten konnte.
Vor einem heutigen Gericht würde diese Beweisführung vermutlich nicht akzeptiert werden, da Sokrates dem Sklaven die Worte in den Mund legte. Seine fragende Anamnese ist kein Beweis für angeborenes Wissen. Nichtsdestotrotz kann man in Platon den Ur-Nativisten, also einen Befürworter angeborenen Wissens, erkennen. Die Rolle von Aristoteles als Ur-Empiriker ist etwas schwieriger zu erkennen17, aber klar scheint, dass er den Platonischen Nativismus nicht akzeptierte. Für Aristoteles ist das Verständnis der Natur durch Wahrnehmung getrieben, es kommt also von außen.
John Lockes Argumentation des unbeschriebenen Blattes als Fundament einer politischen Philosophie des Liberalismus basierte also auf einem sehr weit zurückreichenden, breiten philosophischen Fundament, das mindestens bis ins antike Griechenland reicht. Die Kritik an Lockes Position ließ jedoch nicht lange auf sich warten und kann sich ebenfalls auf die Antike berufen. Auch René Descartes bemerkte, dass es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem gab, was in die Sinne komme und dem, was die Sinne daraus machten. Stellen wir uns eine berühmte optische Täuschung vor: Das Bild einer sogenannten Rubinschen Vase, benannt nach dem dänischen Psychologen Edgar Rubin, lässt anhand der schwarz-weiß gehaltenen Flächen zwei gegenüberliegende helle Gesichter oder eine dunkle Vase erkennen. Man kann dabei nie beides gleichzeitig sehen, nur jeweils das eine oder andere. Wir können also beim Betrachten dieses Bildes in einem Moment eine Vase und im nächsten zwei Gesichterprofile wahrnehmen, ohne dass sich am Bild selbst etwas geändert hat. Descartes zufolge müssten wir ebenfalls eine abstrakte, non-sensorische Idee von physikalischen Objekten haben.18 Unser Verständnis von Objekten oder Kausalität müsse in diesen abstrakten Ideen stecken. Wir müssten also mit ebendiesen angeborenen Fähigkeiten in die Welt kommen. Photonen (»Lichtteilchen«), die auf unser Auge träfen, könnten unmöglich ausreichen, um Objekte zu erkennen, darüber Theorien der Schwerkraft zu bilden und diese mit Ingenieurskunst zu beeinflussen.
Neben Descartes wurde John Locke auch vom deutschen Denker Gottfried Wilhelm Leibniz kritisiert. Laut Leibniz sind unsere Sinne zwar notwendige Bedingung für all unser Wissen, aber keinesfalls hinreichend. Ebenso wenig wie Descartes war er der Meinung, dass die externe Welt und dessen Erleben die Ursache von allem menschlichen Wissen sein könne.
Auch in der Geschichte der Entwicklungspsychologie wollten einige bemerkenswerte, heute berühmtberüchtigte Studien der Frage auf den Grund gehen, wie stark der Mensch in seiner Entwicklung durch Gene oder die Umwelt geprägt sei. Ein sehr bekanntes Experiment nahm der amerikanische Psychologe Winthrop Kellogg vor, der vom Mythos des Wolfskindes fasziniert war. Schon seit dem späten Mittelalter gab es immer wieder Berichte über Wolfsjungen, die nicht bei Menschen aufwuchsen, sondern in einem Wolfsrudel. Rudyard Kiplings durch die Disney-Verfilmung weltberühmtes Dschungelbuch mit seiner bei Wölfen aufwachsenden Hauptfigur Mogli basiert auf solchen Legenden. Bis heute ist es wissenschaftlich debattiert, ob es solche Kinder tatsächlich gab.
Winthrop Kellogg wurde von diesen Geschichten nicht zu einer Romanfigur wie Mogli, sondern zu einer wissenschaftlichen Fragestellung inspiriert. Er interessierte sich dafür, ob ein in der Natur ausgesetzter Junge tatsächlich zum Wolf werden könnte beziehungsweise ob der Mensch tatsächlich in der Wildnis unter Wölfen leben könnte und deren Verhalten und Kommunikation übernähme. Letztlich ging es um die ewige Frage: Wie stark prägt die Umwelt den Menschen? Wie groß ist der Einfluss unserer genetischen Disposition?
Aus ethischen Gründen nahm Kellogg jedoch davon Abstand, Menschenkinder tatsächlich in die Isolation zu schicken. Stattdessen folgte er dem umgekehrten Ansatz: Wie prägt die menschliche Umwelt ein Tier, das bei den Menschen lebt? Wird das Tier zum Menschen? Ist der Einfluss der Umwelt stark genug, um die Natur eines Tieres auszuschalten? Zur Beantwortung dieser Frage adoptierte er gemeinsam mit seiner Frau ein Schimpansen-Baby, taufte es Gua und ließ es mit seiner Familie aufwachsen.19 Seine Frau und er forschten gemeinsam und analysierten, ob sich Gua ähnlich entwickle wie ihr leibliches Kind Donald.
Abbildung 2: Donald mit seiner Schimpansenschwester Gua. Beide wuchsen in den Monaten der Studie exakt gleich auf. Die Ähnlichkeit wurde konsequent durchgezogen, auch in Bezug auf die Kleidung.20
Zu Beginn der auf fünf Jahre angelegten Studie war Gua etwa sieben Monate alt und Donald zehn Monate. Beide schienen sich auf Anhieb zu verstehen. Gua zeigte fantastische Lernleistungen und begriff beispielsweise schneller als Donald, dass man einen Stuhl als Kletterhilfe nutzen kann, um an eine Banane zu gelangen. Zunächst schien es so, als lerne Gua tatsächlich mindestens genauso gut wie Donald. Dennoch entwickelte sie sich nicht wie ein Mensch, obwohl ihr alles gelehrt wurde, was auch Donald durch seine Eltern erfuhr. Nach neun Monaten brach Kellogg jedoch das Experiment ab und schickte Gua zurück in den Zoo, denn seiner Frau und ihm war aufgefallen, dass Donald nach 19 Monaten lediglich drei Worte beherrschte, sehr viel weniger als andere englischsprachige Kinder im vergleichbaren Alter. Stattdessen begann Donald Affenlaute zu imitieren. Er übernahm etwa Guas Futterlaut, wenn er hungrig war. Statt dass Gua sich an die Menschen anpasste, schien Donald sein Verhalten der Schimpansin anzugleichen. Sobald Gua aus der Familie fort war, entwickelte sich seine Sprache rapide. Er schien keine kognitive Beeinträchtigung davonzutragen und absolvierte schließlich sogar ein Medizinstudium an der weltberühmten Harvard University. Sein Leben endete dennoch tragisch, als er sich wenige Monate nach dem Tod der Eltern im Alter von ungefähr 40 Jahren das Leben nahm.
Kelloggs Experiment gab auf die Frage, inwieweit die Gene oder die Umwelt Organismen prägen, eine für die Wissenschaft typische Antwort, nämlich: es kommt darauf an. Man kann die Grenzen, an die Gua stieß, als starken Hinweis dafür interpretieren, dass die genetischen Anlagen einen starken Einfluss ausüben. Sie schienen Guas Lernfortschritt zu begrenzen. Die Tatsache, dass Donald anfing, mittels Schimpansenlauten zu kommunizieren, ist ein Hinweis darauf, wie flexibel jedoch der Mensch auf die Umwelt reagieren kann. Aber bedeutet dies, dass die Umwelt uns stärker prägt als die Gene? Das komplexe Zusammenspiel von Prädisposition und Umwelt ist eine bis heute existierende Fragestellung, die in der Entwicklung des Babys eine besondere Relevanz hat.
Wie aus der bereits dargestellten Debatte im antiken Griechenland geschlossen werden kann, haben wir uns lange über diese Frage gestritten und darüber sinniert, ob wir als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen und durch die Umwelt geprägt werden, oder ob der Mensch intrinsische, angeborene Fähigkeiten hat, die uns durch das Leben leiten. Heute dreht sich die Debatte weniger darum, diese philosophische Grundsatzfrage endgültig zu klären, sondern eher darum, welches Wissen uns eigentlich angeboren ist und welches Wissen durch die Umwelt geprägt wird. Wie sehen die komplexen Wechselwirkungen zwischen angeborenen Lernalgorithmen und dem auf Umweltreizen basierenden statistischen Lernen aus? Wie können wir so rapide lernen? Dies ist die Frage, welche die Entwicklungspsychologie heute intensiv beschäftigt.
Die aktuelle Genforschung zeigt, dass es oft komplexe Interaktionen von Genen und Umwelt sind, die uns prägen. Das gesamte Feld der Epigenetik erforscht etwa diese komplexen Wechselwirkungen im Bereich der Genexpression: Es ist oft eine Frage der Umwelt, ob ein bestimmtes Gen angeknipst wird. So kann beispielsweise Krebs bei einer Person ausbrechen und einer anderen nicht, auch wenn beide theoretisch die gleiche genetische Veranlagung für die Erkrankung haben. Möglicherweise hat die erkrankte Person einen ungesunden Lebensstil gepflegt (z. B. Tabakkonsum, Bewegungsmangel etc.), was wohl mit dazu geführt hat, dass sich der Krebs bei der gegebenen genetischen Disposition entwickeln konnte. Forscher erklären somit Krebs als ein Zusammenfallen von Genen und Umwelteinflüssen.
Wie beim Lesen der folgenden Kapitel klar werden wird, gehen wir heute davon aus, dass Babys bereits mit abstraktem, genetisch geprägtem Wissen auf die Welt kommen. Hierzu gehören die Fähigkeit zur Abstraktion, Wissen über Objekte und anderes. Basierend hierauf wird das gesamte zu erlernende Wissen aufgebaut. Dies ist eine Erkenntnis der letzten Dekaden. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die reinen Empiristen die Deutungshoheit in der Psychologie komplett für sich in Anspruch nahmen.
Behaviorismus: Verhalten als einziger Pfad zur Weisheit?
Die Psychologie als Wissenschaft – so vermittelt es nahezu jedes Standardlehrwerk – entstand aus den Gedanken des Aufklärers John Locke sowie denen seines intellektuellen Erbens John Stuart Mill.21 Insbesondere Mill attackierte kontinentale Philosophen und formulierte eine auf Locke zurückgehende Theorie des Lernens durch Assoziationen. Diese Ideen waren die Basis für eine der vielleicht einflussreichsten Theorien, welche die Psychologie bis heute kennt – den Behaviorismus.
Der Behaviorismus versuchte, innere Prozesse wie Gedanken und Gefühle beim Verständnis über menschliches Lernen komplett auszuklammern, da für den Forscher das einzig Beobachtbare das Verhalten sei. Alle Versuche, in die Gefühls- und Gedankenwelt von Menschen einzudringen, galten als unwissenschaftlich. Auf dem Behaviorismus basierende Lerntheorien argumentieren, dass Kinder lernen würden, bestimmte Handlungen mit bestimmten Konsequenzen zu verbinden (zu assoziieren) und sich dadurch adäquates Verhalten aneignen würden. Der Nachhall dieses theoretischen Ansatzes ist in der Pädagogik bis heute fühlbar. Noch immer wird versucht, durch positive und negative Verstärkung Kinder extern zu steuern und zu formen. Aber auch in anderen Gebieten wie in der klinischen Psychologie oder im Bereich der künstlichen Intelligenz werden Anwendungen wie Reinforcement Learning bis heute – mitunter sehr erfolgreich – aktiv genutzt.
Der Begründer des Behaviorismus war John Watson, der 1913 den Aufsatz Psychologie, wie der Behaviorist sie sieht schrieb. Einer der Kernaussagen ist heute derart berühmt-berüchtigt, dass man sie auf Wikipedia findet: »Die Psychologie ist aus der Sicht des Behavioristen ein rein objektiver experimenteller Zweig der Naturwissenschaften. Ihr theoretisches Ziel ist die Voraussage und Kontrolle des Verhaltens. Die Introspektion zählt nicht zu ihren Methoden, noch hängt der wissenschaftliche Wert ihrer Daten davon ab, wie leicht sie sich in den Begriffen des Bewusstseins interpretieren lassen.«22
Watson kokettierte sogar damit, dass man ihm ein beliebiges Dutzend gesunder Kinder geben solle und er sie so trainieren könne, dass jedes beliebige Kind entweder Arzt, Anwalt, Kaufmann oder gar Dieb werden könnte.23 Er allein könne durch sein Training entscheiden, was aus den Kindern werden würde.
Für Watson spielten weder Talente noch Neigungen der Kinder für ihre Entwicklung eine Rolle. Er war der Meinung, dass man tierisches und menschliches Verhalten schlicht durch Stimulus-Response-Modelle abbilden könne wie in den berühmten Studien von Pavlov und Skinner. Pavlov testete an seinem heute berühmten Hund, ob er diesen »konditionieren« könne. Dazu kombinierte er bekanntermaßen zunächst die Fütterung mit dem Läuten eines Glöckchens. Selbstverständlich lief dem Hund das Wasser im Mund zusammen, sobald er die Nahrung roch oder erblickte. Irgendwann reagierte der Hund allein auf das Läuten des Glöckchens mit Speichelfluss, selbst, wenn gar keine Nahrung bereitgestellt wurde. Pavlov konnte dadurch nachweisen, dass sein Hund mit einem vorhersagbaren Verhalten reagierte, sobald der externe Reiz (das Glöckchen) präsentiert wurde.
B. F. Skinner testete in theoretisch verwandten Experimenten das Gleiche an Tauben und Ratten. Allerdings übertrieb er seinen Erkenntnisgewinn wohl in seinem Buch Verbal Behavior, also Das Verhalten von Organismen