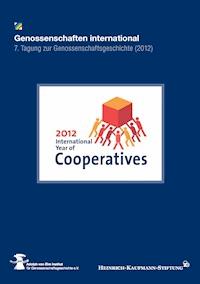
Genossenschaften international E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch enthält die Beiträge zur 7. Tagung zur Genossenschaftsgeschichte, die unter dem Titel "Genossenschaften international" 2007 in Hamburg statfand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
2012 Hamburg: Genossenschaften international
Vorwort
W
ILHELM
K
ALTENBORN
Von und über Ivano Barberini, Präsident des Internationalen Genossenschaftsbundes 2001 – 2009
G
ÜNTHER
R
INGLE
Ursprung und Entwicklung der modernen Genossenschaftsbewegung in Westeuropa
B
URCHARD
B
ÖSCHE
Zeitschrift über den Fronten. Das Bulletin des Internationalen Genossenschaftsbundes im Ersten Weltkrieg
P
HILIPP
D
EGENS
Die Geschichte der Genossenschaftsbewegung aus transnationaler Perspektive: Zur Rolle von Pionieren, Reisen und Kongressen im 19. Jahrhundert
A
NNE
S
ANTAMÄKI
Finnland, das Genossenschaftsland
F
EDERICO
A
GOSTINI
Die Genossenschaften im Trentino/Italien
A
LEXANDRA
S
EIFERT
Die Geschichte der „Kleinen Genossenschaft“ in Italien – Vom unliebsamen zum genossenschaftlichen Zukunftsmodell
F
LORIAN
J
AGTSCHITZ
, S
IEGFRIED
R
OM
, J
AN
W
IEDEY
KONSUM Österreich – Ein Blick zurück
T
ORSTEN
L
ORENZ
Das Genossenschaftswesen Mittel- und Osteuropas im Prozess der Nationenbildung 1850-1940
A
RMIN
P
ETER
Vom Entwicklungshilfeprojekt zum Großbetrieb - Die Katray coop-Molkerei in Poona/Indien
R
OSANE
Y
ARA
R
ODRGUES
G
UERRA
Genossenschaften in Brasilien - ein historischer Überblick
Kurzbiografien der Autorinnen und Autoren
Vorwort
Die Vereinten Nationen hatten das Jahr 2012 zum „Internationalen Jahr der Genossenschaften“ erklärt. Diese Initiative hat den Genossenschaften auch in Deutschland gut getan. Sie lenkte vor allem die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese alt bewährte aber im Schatten stehende Gesellschaftsform. Es lag nahe, den Schwerpunkt der genossenschaftshistorischen Jahrestagung auf die internationalen Aspekte zu legen. Und so reicht die Spannbreite der Themen von Italien über Finnland und Brasilien bis nach Indien. Die Internationalisierung der Diskussion ist fruchtbar. Sie durchbricht die Selbstbezogenheit des deutschen Genossenschaftsdiskurses. Man kann lernen, dass es auch anderswo mit ganz anderen rechtlichen Grundlagen ein reiches genossenschaftlichen Leben gibt, und das manchmal wirkungsvoller und umfassender als bei uns in Deutschland. Wir danken in besonderer Weise den Referenten, die von weit her angereist sind, um über ihre Erfahrungen zu berichten. Und für künftige Tagungen zur Genossenschaftsgeschichte können wir daraus den Schluss ziehen, dass der „Blick über den Tellerrand“ ein Prinzip der Forschungsarbeit sein muss. Insoweit hat das Jahr der Genossenschaften auch unsere Sichtweise verändert.
Dieser Tagungsband erscheint mit erheblicher Verzögerung. Nun kann man sagen: „Gut Ding will Weile haben.“ Dass es sich bei diesem Band um ein „gutes Ding“ handelt, wird der Leser bei der Lektüre bemerken. Als Herausgeber können wir nur um Verständnis bitten. Der Umzug der Heinrich-Kaufmann-Stiftung in eigene Räume im Hamburger Gewerkschaftshaus und die (Wieder-) Einrichtung des Hamburger Genossenschafts-Museums haben viel Arbeit gemacht, die im Wesentlichen, wie auch die Herausgabe des Tagungsbandes, ehrenamtlich geleistet worden ist.
Hamburg, August 2016
Heinrich-Kaufmann-Stiftung
Burchard Bösche, Mitglied des Vorstandes
WILHELM KALTENBORN
Von und über Ivano Barberini, Präsident des Internationalen Genossenschaftsbundes 2001 – 2009
Der Internationale Genossenschaftsbund geriet zu Beginn dieses Jahrhunderts in eine ernste finanzielle Krise. Der Grund: Die Strukturen des IGB waren zu kompliziert und zu ineffizient, um Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten. Die sechs Regionalorganisationen konnten über Ausgaben entscheiden, ohne zugleich für deren Finanzierung sorgen zu müssen. Hinzu kamen ein Unterschlagungsskandal in der nordamerikanischen Regionalorganisation und ein teures, weil abfindungsschweres Ausscheiden des Generalsekretärs.
In der Generalversammlung im Herbst 2001 in Seoul trat der bisherige IGB-Präsident, der Brasilianer Roberto Rodrigues, nicht mehr an. Neuer Präsident wurde Ivano Barberini. Er war 62 Jahre alt und hatte schon jahrzehntelang in der italienischen Genossenschaftsbewegung gearbeitet, und zwar in der Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, kurz Legacoop, der linken Organisation unter den italienischen Genossenschaftsverbänden. Achtzehn Jahre lang war er Präsident von deren konsumgenossenschaftlichen Teilorganisation, danach bis 2002 Präsident seiner Gesamtorganisation, eben von Legacoop; von 1990 bis 1996 war er zugleich Präsident von Eurocoop.
Den notwendigen Strukturreformen beim IGB stellte er sich mit erstaunlicher Energie, gepaart mit großer Überzeugungsstärke. Das Schlüsselwort der IGB-Reformen hieß: Dezentralisierung. Sie ist erfolgreich umgesetzt worden. Das war aber in einer Organisation, die Mitglieder aus aller Welt, also aus allen Kulturen dieser Erde, in sich vereint, extrem schwierig. Hinzu kommt die schiere Größe: Der IGB ist mit rund 800 Millionen Mitgliedern die weltweit größte, nichtstaatliche Organisation. Sie so zu leiten und zu lenken, dass sie sowohl ihrer potentiellen Bedeutung entsprechend wahrgenommen wird als auch optimale Strukturen aufweist, ist eine geradezu existentielle Herausforderung. Allzu heterogen ist der IGB. Um einen persönlichen Eindruck wiederzugeben: Nicht ohne Grund wirkte Barberini manchmal müde – wohlgemerkt: Nicht schläfrig. Ihn umgab vielmehr jene sowohl aus lebenslanger als auch aus aktueller Anstrengung resultierende Erschöpfung, die zugleich zu immenser Hellsichtigkeit führt. Gemessen an der gewaltigen Aufgabe, der er sich stellte und an den sie hemmenden Widrigkeiten, war Barberini ein sehr erfolgreicher IGB-Präsident. Nicht umsonst wurde er 2005 im kolumbianischen Cartagena wiedergewählt und er wäre wohl auch im Herbst 2009, wenn er denn gewollt hätte, in seinem Amt bestätigt worden. Aber, Anfang Mai 2009 starb er, kurz vor seinem siebzigsten Geburtstag.
Barberini war das, was in der italienischen Kultur heute noch mit dem bei uns nur historisch zu verstehenden Wort „Humanist“ bezeichnet wird. Er zeigte sich stets als das Gegenteil eines von organisatorischen Apparaten geprägten Mannes. Im IGB-Nachruf wird er – unübersetzbar – als „a gentleman and a scholar“ gekennzeichnet1. Der Präsident der asiatisch-pazifischen IGB-Regionalorganisation, der Chinese Li Chungsheng, nannte ihn „warmherzig, zugewandt, liebenswürdig“.2 Der italienische Staatspräsident, Napolitano, sagte in seiner Würdigung, Barberini „war ein leidenschaftlicher Kämpfer für den sozialen und gesellschaftlichen [civile] Fortschritt und für den Frieden“.3 Übrigens war Barberini bis zu seinem Tod auch Präsident eines privaten italienischen Friedensforschungsinstituts. Heute gibt es eine Stiftung, die seinen Namen trägt und die sich der Aufgabe verschrieben hat, die Bedeutung der Genossenschaften für die gegenwärtige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern.
Der Zufall – oder besser gesagt: das Schicksal - wollte es, dass unmittelbar vor Barberinis Tod ein Buch fertiggestellt war, in dem er auf die – aller Wahrscheinlichkeit nach abgesprochenen – Fragen einer renommierten italienischen Journalistin, Miriam Accardo, umfassende Antworten gibt4. Schon aufgrund des Zeitpunkts seiner Erscheinung kann dieser schmale Band als das genossenschaftspolitische Testament Barberinis gelten. Der Titel klingt etwas seltsam: Wie die Hornisse fliegt, „Come vola il calabrone“. Er erklärt den Titel so: Die Hornisse beweise, dass sie den physikalischen Gesetzen zum Trotz zu fliegen vermag. Eigentlich bestehe nämlich bei ihr ein dem entgegenstehendes Missverhältnis zwischen Körpergewicht und Flügelkraft. Vergleichbares sei bei den Genossenschaften der Fall. Es handele sich um den – allerdings nur vermeintlichen – Gegensatz zwischen dem Anspruch, Wirtschaftsunternehmen auf dem Markt zu sein und zugleich metaökonomisch sozialen Zielen zu dienen. Mit seinem Buch will Barberini beweisen, dass die Genossenschaften so gesehen sehr wohl fliegen können.
Dabei geht er weit über das hinaus, was das Selbstverständnis des deutschen Genossenschaftswesens ausmacht. Schon die Widmung des Buches sprengt alle Grenzen, in denen sich gängige deutsche Veröffentlichungen bewegen. Es ist den in Armut lebenden Kindern dieser Welt gewidmet, die hier Antworten auf ihre Frage nach der Zukunft finden würden. Das klingt vermessen.
Und schon mit der ersten Frage will Miriam Accardo denn auch wissen, wie Barberini seinen sechs- und siebenjährigen Enkeln wohl erklären würde, was das „Genossenschaftliche“ sei. Eine Zwischenbemerkung: Bei dem italienischen Wort „cooperazione“ haben wir es mit einem semantischen Problem zu tun, das in Wahrheit ein interkulturelles Problem ist. „La cooperazione“, über die Barberini also spricht, ist das Wort, das sich auch in der italienischen Verfassung findet und das in der offiziellen Übersetzung des italienischen Parlaments mit „Genossenschaftswesen“ widergegeben ist. Bei Barberini nun, und nicht nur bei ihm, sondern auch lexikalisch, hat dieses Wort zusätzlich eine umfassendere Bedeutung, die sich aus seinem Ursprung ergibt: Zusammenarbeit. „La cooperazione“ sollte also zutreffender, wenn auch unbestimmter mit „das Genossenschaftliche“ übersetzt werden.
Die Frage, wie den Enkeln erklären, was das Genossenschaftliche sei, beantwortet Barberini auf die schlichteste Art und Weise: Gemeinsam arbeiten (cooperare), sagt er, sei wie zusammen spielen.
Für Barberini ist das Genossenschaftliche dem Menschen tief eingepflanzt. Es finde sich in den DNA des Menschen, erklärt er. In den Erfahrungen eines jeden von uns habe das Genossenschaftliche seine Spuren hinterlassen. „Cooperazione“ trägt also für ihn anthropologische Züge, keinesfalls nur juristische und/oder ökonomische. So würden denn auch alle großen Weltreligionen genossenschaftliche Elemente enthalten.
Wieder eine Zwischenbemerkung: Nach der Überzeugung Hans Hofingers, dem Verbandsanwalt des Österreichischen Genossenschaftsverbandes, sind die Ordensregeln des Benedikt von Nursia (Hofinger gehörte früher selbst dem Benediktiner-Orden an) fast ein lupenreines Genossenschaftsstatut.5 Zurück zu Barberini: Die Genossenschaften seien einerseits spontan entstanden, als Frucht ihrer sozio-ökonomischen Umwelt und andererseits hätten Generationen von Denkern, Politikern, Gläubigen und genossenschaftlichen Praktikern die Idee des Genossenschaftlichen auf der Grundlage ihrer jeweiligen Überzeugungen und gesellschaftspolitischen Konzepte entwickelt. Die so formulierten Grundwerte seien Selbstbestimmung, personale Verantwortung, Demokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Den Genossenschaften sei eine Ethik eigen, die auf Ehrlichkeit, Transparenz, sozialer Verantwortlichkeit und Selbstlosigkeit gegründet sei. In den genossenschaftlichen Unternehmen sei das Kapital lediglich ein Instrument, das den Genossen zu Diensten sei. Deshalb werde noch heute der Konkurs einer Genossenschaft nicht etwa als ein natürliches Ereignis angesehen, das von den dynamischen Eigenschaften des Marktes diktiert sei, sondern geradezu als der Untergang einer Idee.
Die gegenwärtige Krise erfordere unabdingbar Veränderungen. Eine Möglichkeit sei eine Wirtschaft der wechselseitigen Unterstützung, einer gemischten Wirtschaft in vielerlei Formen. Mit Assoziationen, Genossenschaften, kleineren und mittleren privaten Unternehmen und auch staatlichen Unternehmen. Die globale Krise biete große Möglichkeiten für das Genossenschaftliche, sich als Unternehmensform zu behaupten. Um noch einmal den IGB-Nachruf zu erwähnen: Für Barberini sei die Krise keine Überraschung gewesen, sondern eine Chance – so heißt es darin. Barberini sagt aber auch ausdrücklich, dass der Kapitalismus durchaus positive Werte trage. Dazu gehörten die Bedeutung des Risikos und die Erfahrung, dass positive Energie frei werde, wenn man sich in das Getümmel des Marktes stürze.
Auch unabhängig von der aktuellen Krise gebe es globale Aufgaben: Den Kampf gegen die Armut, gegen Hunger, Analphabetismus, gegen die Umweltzerstörung, die Diskriminierung der Frau, die Kindersterblichkeit. Nun biete die genossenschaftliche Initiative den Menschen die Möglichkeit der Teilhabe, und zwar auf der Grundlage einer fruchtbaren Solidarität. Es handele sich dabei um eine Schule, die es den Menschen erlaube, auch ohne solche elementaren Kenntnisse wie Lesen und Schreiben, zu lernen und praktische Kenntnisse zu erwerben. Vielfach sei es am Ende eines solchen Prozesses sogar möglich, in die Leitung seiner Genossenschaft aufzusteigen.
Der Sinn für Frieden, für soziale Gerechtigkeit, für Freiheit und Solidarität sei konstitutiver Bestandteil des Genossenschaftlichen und stelle das Fundament dar für eine aktive und verantwortliche Teilhabe, die zu einer wirklich humanen Entwicklung beitrage. Angesichts des umfangreichen Feldes der Betätigungen, die Barberini den Genossenschaften zuschreibt, ist es nur konsequent, dass sie für ihn Teil des weltumspannenden Gefüges zivilgesellschaftlicher Organisationen sind.
Bei allem Enthusiasmus sieht Barberini manche Entwicklungen aber auch kritisch. So schwäche sich die Identität einer Genossenschaft ab, wenn sie eine reine Gemeinschaft von Interessen werde und dadurch die Logik des Marktes die genossenschaftlichen Prinzipien verdränge. Die genossenschaftlichen Formen neigten dazu, zu degenerieren, wenn der einzelne Genosse eine anonyme Figur werde. Für die Führung einer Genossenschaft sei es durchaus weniger stresshaft, die Mitwirkung der Mitglieder zu missachten. Das gehe aber zu Lasten der demokratischen Strukturen.
Aber gerade in der gegenwärtigen Krise seien die Prinzipien des Genossenschaftswesens gefragt. In der genossenschaftlichen Organisation gebe es schon immer das Gleichgewicht zwischen Gemeinschaftssinn und Ökonomie. Bei wahren Genossenschaften sei es wie bei einer Jazz-Darbietung, denn auch diese verbinde ein hohes Niveau demokratischer Überwachung mit der Kreativität der Gruppe und des Einzelnen. Und dies seien die Pfeiler des genossenschaftlichen Projektes: Freiheit und Sicherheit in der Gemeinschaft untrennbar verbunden mit Teilhabe und unternehmerischem Verhalten.
Barberini zeichnet die Grenzen des Genossenschaftlichen vielleicht zu weit. Fast gibt es bei ihm überhaupt keine Grenzen. Aber die Überzeugungsstärke, mit der er den Genossenschaften ureigene, umfassende Werte zuschreibt und sie nicht lediglich mit Paragraphen und Kennziffern ausstattet, berührt ungemein sympathisch. Das Genossenschaftliche als Bestandteil der condition humaine zu fassen, ist faszinierend.
Barberini zitiert in seinem Buch viele Autoren, beruft sich auf viele Autoritäten. Neben zeitgenössischen Philosophen, Soziologen, Schriftstellern, Ökonomen usw. haben auch viele historische Figuren bei Barberini eine große Bedeutung für das Genossenschaftliche. Zu ihnen gehören etwa Dickens, Keynes, Tolstoi, Hobbes, Aristoteles, Campanella, und von den historischen Vätern der modernen Genossenschaftsidee nennt er – als nichtdeutsche Figuren – Owen, Mazzini, Luzzatti, Louis Blanc, Fourier, Bouchez, William King.
Wie stellt sich nun die deutsche Genossenschaftsbewegung dar, welche Signale werden von ihr in die internationale Genossenschaftsbewegung gesendet? Ihr größter Teilverband, nämlich der Genossenschaftsverband e. V. beantwortet auf seiner Website nach vier Links die Frage: Was ist eine Genossenschaft6? Der erste Satz der Antwort lautet: „Die eingetragene Genossenschaft ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Unternehmern.“ Denn, so heißt es einige Zeilen weiter, „tragfähige Kooperationen zwischen Unternehmen sichern die Selbstständigkeit…“ Unter der Überschrift „Gründung“ heißt es,„schon drei Personen können eine eG gründen. Damit eignet sich die eG für die Zusammenarbeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen und Freiberuflern sowie die Unternehmensnachfolge im Mittelstand.“ Die drei Personen im Gesetz sollen offenbar nur juristische Personen sein. Im Zentrum stehen also Unternehmen, nicht Menschen. Als Stichworte, aber wirklich nur als Stichworte werden noch genannt: Mitgliederförderung, demokratische Willensbildung, Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstverantwortung. Insgesamt ergibt das Alles eine gute Seite Text. Auf den übrigen 95% der gesamten Website erhält man Informationen über den Verband selbst, über Gründungsvorschriften und vielerlei andere Formalien.
Zum Vergleich: Auf der Website7 des größten italienischen Verbandes, nämlich Legacoop mit seinen etwa acht Millionen Mitgliedern, finden sich recht umfassende Aussagen zur sozialen Verantwortung der genossenschaftlichen Unternehmen, zur genossenschaftlichen Solidarität, zur Verbesserung der Lebensqualität durch Genossenschaften, zu den genossenschaftlichen Sozialbilanzen, zur genossenschaftlichen Identität: „Ein genossenschaftliches Unternehmen ist ein Unternehmen, in dessen Zentrum die Menschen stehen…“, heißt es da ausdrücklich. Als Vision des Verbandes wird dargestellt: „Ein gesunder und vielfältiger Markt, im Einklang mit einer gerechten, gesitteten [pulita] Gesellschaft, voller Harmonie zwischen ihren Teilen“. Schließlich erscheint eine Charta der Werte, für die Legacoop steht, mit zehn definierten Stichworten, von der Freiheit bis zur Solidarität. Sie geben Antworten auf solche Fragen wie etwa: Welches sind die Mechanismen, die uns helfen, mit unseren Nächsten zusammenzuarbeiten oder im Wettstreit mit ihnen zu stehen? Welche Bedeutung haben die menschlichen Beziehungen? In den weiteren Links erst werden die Organisation und die Struktur von Legacoop dargestellt, Zahlen genannt und die angebotenen Dienstleistungen aufgezählt.
Antoine Saint-Exupery hat nicht nur den „Kleinen Prinzen“ geschrieben. Er hat auch gesagt: Wenn du ein Schiff bauen willst, so fange nicht damit an, Holz zu sammeln, Planken zu schneiden und die Arbeit einzuteilen, sondern erwecke in den Menschen die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.
Es ist sicher unbestreitbar, dass Planken geschnitten und die Arbeit eingeteilt werden muss, will man ein Schiff bauen. Dieser Aufgabe unterzieht man sich in Deutschland, durchaus zweckgerichtet. Die auf wirtschaftliche Interessen beschränkte Genossenschaft steht dabei im Fokus. Für die hungernden Kinder der Welt gibt es andere Zuständigkeiten.
Ivano Barberini dagegen, in der genossenschaftlichen Tradition und Kultur seiner italienischen Heimat wurzelnd, wollte mit seinem genossenschaftspolitischen Testament die Sehnsucht nach dem Meer wecken.
1 ICA Digest June/July 2009, S. 3
2 Li Chungsheng: ICA Asia Pacific Special Bulletin in the Memory of Late Mr. Ivano Barberini. New Delhi 2009.
3www.fondazionebarberini.it. 18. 06. 2009
4 Ivano Barberini: Come vola il calabrone. Cooperazione, etica e sviluppo. Intervista di Miriam Accardo. Milano 2009.
5 Vgl. Vgl. Hans Hofinger: Regula Benedicti. Eine Botschaft für Führungskräfte (Schulze-Delitzsch-Schriftenreihe Bd. 24). Wien 2003.
6www.genossenschaftsverband.de. 29. 10. 2012
7www.legacoop.it. 05. 11. 2012.
GÜNTHER RINGLE
Ursprung und Entwicklung der modernen Genossenschaftsbewegung in Westeuropa
1. Einleitung
2. Ursprung des Assoziationsgedankens in Westeuropa
3. Entstehung der grundlegenden Kooperationsideen
3.1 England
3.2 Frankreich
3.3 Deutschland
4. Geistesgeschichtliche Grundlagen
5. Zur Entwicklung des modernen Genossenschaftswesens
5.1 England
5.2 Frankreich
5.3 Deutschland
6. Weltweite Verbreitung und Bedeutung der Genossenschaften
1. Einleitung
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2012 zum „Internationalen Jahr der Genossenschaften“ erklärt. Darin kommt eine hohe Wertschätzung der Genossenschaftsidee zum Ausdruck, die weltweite Bedeutung der Genossenschaften für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung wird gewürdigt – und zugleich für die genossenschaftliche Wirtschaftsweise geworben.8
Genossenschaftliche Kooperationen erbringen in vielen Ländern eindrucksvolle Leistungen in den Bereichen Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Versorgung mit Wohnraum: für ihre Mitglieder, für die Wirtschaft und Gesellschaft. Doch obwohl die Genossenschaften heute eine Weltmacht darstellen, tritt der Genossenschaftssektor in der Öffentlichkeit nicht entsprechend in Erscheinung. Es schien daher an der Zeit, den Genossenschaften ein Jahr lang globale Aufmerksamkeit angedeihen zu lassen.
Die Auszeichnung durch die UNO legt es nahe, an die Herkunft der genossenschaftlichen Kooperation zu erinnern. Unter den zahlreichen Äußerungen aus Anlass des internationalen Genossenschaftsjahres befindet sich ein Artikel mit der Überschrift „Die Geburtsstunde der Genossenschaften.“9 Von der Einschränkung auf eine Geburtsstunde abrückend wird darin vermerkt: Die weltumspannende Genossenschaftsbewegung wurde in Westeuropa geboren. Ihre Wiege stand dort nacheinander in mehreren Ländern, in denen nachhaltig wirkende Pionierleistungen erbracht wurden, die sich zu einer Gesamtbewegung zusammenfügten.
Demnach kann keine Rede davon sein, wie die Headlines anderer einschlägiger Beiträge suggerieren wollen, dass der „genossenschaftliche Grundstein in Deutschland“10 gelegt wurde und „Deutschland als Ausgangspunkt der Genossenschaftsidee“11 zu gelten habe. Ebenso unbegründet ist die einen Alleinanspruch erhebende These, ausgehend von Deutschland habe das Genossenschaftswesen seinen weltweiten Siegeszug angetreten.12 Für die Entwicklung der modernen Genossenschaften grundlegende Ideen und Handlungsmuster einer Reihe von „Vorläufern“ werden dabei ausgeblendet.
2. Ursprung des Assoziationsgedankens in Westeuropa
In der Einleitung seines 1904 erschienenen Buches über das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Skandinavien, also fast 110 Jahre dem Ursprung näher als wir heute, machte Heinrich Pudor deutlich, dass es die eine und keine andere exakt datierte Geburtsstunde der Genossenschaften nicht gab. Man irre darin, die Genossenschaftsbewegung für eine aus dem englischen Volk heraus entstandene Bewegung zu halten. Diese Sicht stütze sich nicht allein darauf, dass in anderen Ländern bereits lange bevor die ersten Genossenschaften Englands gegründet wurden frühe genossenschaftliche oder genossenschaftsähnliche Gemeinschaften und Formen der Zusammenarbeit nachweisbar sind. Derartige Zusammenschlüsse habe es zu allen Zeiten der Menschheit und in allen Gesellschaften gegeben.13
Pudor räumt dann allerdings ein, der moderne Genossenschaftsgedanke sei zunächst in England zu größerer Entfaltung gelangt, weil dort der Industrialisierungsprozess, der einen wesentlichen Anreiz zur Entstehung der Genossenschaftsidee bot, zuerst und am konsequentesten einsetzte. Das theoretische Fundament des Genossenschaftswesens wurde jedoch nicht nur in England, sondern ebenso in Frankreich, Deutschland und selbst in Belgien und Dänemark gelegt.14
Ansätze einer neuzeitlichen Genossenschaftsbewegung sind im frühen 19. Jahrhundert zu finden. Etwa zur selben Zeit erwachte der Genossenschaftsgedanke in mehreren westeuropäischen Ländern, wenngleich in verschiedener Gestalt: in England mit Konsumvereinen und Bauvereinen, in Frankreich mit Arbeiterproduktivgenossenschaften und in Deutschland mit Vereinen als Vorgängern der Bezugs- und Absatzgenossenschaften für Handwerker (Tischler, Schuhmacher) und Landwirte sowie der Kreditgenossenschaften.
Wichtige Entstehungsgründe waren überall die im Zuge der Industrialisierung radikalen Veränderungen der technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse sowie gravierende Fehlentwicklungen des Marktes. Ungünstige Agrarstrukturen und die Entstehung großer Manufakturen lösten die Abwanderung von Landarbeitern und Bauern, aber auch kleiner Handwerker in die aufblühenden Industriestädte aus. Als Kehrseite des enormen wirtschaftlichen Aufschwungs kam es in diesen Bevölkerungsschichten zu sozialen Missständen, Verelendung und sittlichem Verfall.
Die natürliche Antwort auf die soziale Frage waren Versuche, durch Zusammenschluss die schwache Position der rasch wachsenden städtischen Arbeiterklasse zu stärken. So nahmen die Genossenschaften den Charakter einer zugleich wirtschaftlichen und sozialen Bewegung an. Die europäische Genossenschaftsbewegung wurde damit ein Teil nicht nur der Wirtschafts-, sondern gleichermaßen der Sozialgeschichte.
3. Entstehung der grundlegenden Kooperationsideen
Zu zeigen ist, dass die Anfänge der Genossenschaftsbewegung in England, Frankreich und Deutschland sehr unterschiedlich ausgeprägt waren15 und sich in diesen Ländern verschiedene Schwerpunkte genossenschaftlicher Betätigung herausbildeten.
3.1 England
Als Ausgangspunkt der Entstehung einer modernen Form der Genossenschaftsidee in England gilt besonders der Zusammenschluss zu Arbeiterkonsumvereinen. Der erste Konsumverein wurde 1794 in Mongewell durch den Bischof von Durham errichtet. Davor schon hatten Dockarbeiter in Woolwich und Chatham gemeinschaftlich Mühlen und Bäckereien betrieben (1760), und im schottischen Dorf Fenwick war durch Weber ein konsumvereinsartiger Zusammenschluss entstanden (1769).16
Robert Owen (1771-1858) setzte 1799 in seiner sehr erfolgreichen Baumwollspinnerei in New Lanark (Schottland) in einem Experiment für soziale Arbeitsbedingungen seine sozialen Ideen in die Tat um. Er verkürzte die Arbeitszeit, schränkte die damals übliche Kinderarbeit ein, entwickelte eine Kranken- und Invalidenversicherung, ließ Wohnungen für seine Arbeiter bauen und ermöglichte ihnen einen Konsumladen auf dem Fabrikgelände. Die Manufaktur wurde zum vielbeachteten Musterbetrieb und beispielhaft im damaligen Europa.
Die Schriften und sozialen Experimente Owens halfen, die Kooperationsbewegung in Gang zu bringen. Er vertrat eine neue Auffassung von der Gesellschaft. Um das soziale Elend zu überwinden, sollten sich nach seinen zugleich sozialistischen und genossenschaftsbezogenen Vorstellungen Gewerkschaften und Genossenschaften der Arbeiter zusammentun und das gesamte Wirtschaftsleben in die Hand nehmen.17 Eine wichtige Rolle war dabei Produktivassoziationen zugedacht. International bekannt wurde Owen für seine Experimente mit ländlichen Arbeits- und Lebensgemeinschaften, die sich jedoch nicht als lebensfähig erwiesen.18Robert Owen ging als der größte Kämpfer für die soziale Idee in die englische Sozialgeschichte ein und gilt als Begründer des britischen Sozialismus. Sein Wirken reicht aber weit über England hinaus. Er sah die Kooperation nicht allein als Mittel zur Erreichung eines individuellen ökonomischen Nutzens, sondern auch zur moralischen Hebung und Erziehung der Arbeiter zu wirtschaftlicher Selbständigkeit.
Als Förderer der Genossenschaftsbewegung traten dann im frühkapitalistischen England der Arzt Dr. William King (1786-1865) und William Thompson (1775-1833) auf. Sie waren zwar von Owens Wirken angeregt, propagierten jedoch kleine Gemeinschaften in der Form von Arbeiterkonsumvereinen. King gründete 1827 in seiner Heimatstadt Brighton einen Konsumverein, in dem erstmals die Idee eines unteilbaren Reservefonds (Rücklagen) verwirklicht wurde.19 Trotz des Misserfolgs des Vereins gab es viele Nachahmer in verschiedenen Teilen Großbritanniens. Die „Vereinsläden“ verbreiteten sich zwar in kurzer Zeit viel versprechend, fristeten aber ein kümmerliches Dasein und mussten schließlich aufgeben.20Kings größerer Plan war, Siedlungsgemeinschaften („Communities“) ins Leben zu rufen.
Alle frühen Ansätze zur Entwicklung einer Genossenschaftsbewegung verfolgten – wenn auch nicht ausschließlich – den Zweck, in einer bedrückenden sozialen Lage durch gemeinsamem Einkauf die Preise für Konsumgüter (Lebensmittel, Kleidung und andere Bedarfsartikel) zu senken und der Übervorteilung durch Händler bei Warenqualität und Gewicht Einhalt zu gebieten. Nachhaltigen Auftrieb erhielt die Genossenschaftsbewegung aber erst durch eine Gruppe von anfangs 28 Flanellwebern, die dieses Konzept 1844 in der Krötengasse zu Rochdale vorbildlich mit ihrem Konsumverein umsetzten, der für alle späteren Konsumgenossenschaften richtungweisend wurde.
Das Programm der Redlichen Pioniere von Rochdale bestand darin, die Mitglieder durch preisgünstige Abgabe der beschafften Waren zu unterstützen, eigene Verkaufsstellen zu unterhalten, später auch durch Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Güter Eigenproduktion zu betreiben und eine Gemeinschaftssiedlung zu gründen. Von diesem Plan umgesetzt wurde zunächst nur die Einrichtung eines Konsumladens. Die für dessen Führung entwickelten Grundsätze sowohl wirtschaftlicher als auch sozialreformerisch- erzieherischer Art gingen als „Rochdaler Prinzipien“21 in die Genossenschaftsgeschichte ein. Der erfolgreiche genossenschaftliche Betriebstyp fand in England und ganz Europa in der Gründerzeit starke Verbreitung und weltweit viele Nachahmer.
3.2 Frankreich
Ähnlich wie Robert Owen mit ländlichen Gemeinschaften verfolgten in Frankreich Charles Fourier (1772-1837) und seine Mitstreiter die Idee einer genossenschaftlichen Siedlung, in der die Mitglieder als Lebensgemeinschaft wohnen und in Eigenproduktion alle zum täglichen Leben notwendigen Güter erzeugen. Dieses „Phalanstères“ genannte Projekt war als Kombination von Produktiv- und Konsumgenossenschaft konzipiert. Es sollte eine neue Gesellschaftsordnung einleiten, gelangte aber nicht wirklich zur Umsetzung. Dagegen hatte sein Mitstreiter Jean-Baptiste Godin mit dem ähnlichen Projekt „Familistère“ großen Erfolg.22
Frankreich ist vor allem durch die Anstrengungen des Philippe Buchez (1796-1865), eines Vertreters des christlichen Sozialismus, zum Repräsentanten der Produktivgenossenschaft geworden. 1832 gründete er die erste Arbeiter-Assoziation. Den „utopischen Sozialisten“ kam es darauf an, der minderbemittelten Bevölkerung, vor allem den Handwerkern und Arbeitern Alternativen zu den als ausbeuterisch empfundenen Erwerbsund Lebensbedingungen zu bieten. Durch die Initiative von Buchez entstand 1834 in Paris eine Genossenschaft der Talmi-Juweliere, die sich gut entwickelte, vier Filialbetriebe unterhielt und bis 1873 erfolgreich arbeitete.23
Louis Blanc (1811-1882) führte die Ideen und Pläne von Buchez zur Gestaltung von Produktivgenossenschaften fort. In seinem Buch „Organisation du travail“ (1840) trat er dafür ein, der Arbeitslosigkeit durch Neugestaltung der Wirtschaft, die sich auf die politische Vorherrschaft der Arbeiterklasse stützt, entgegenzuwirken. Seine Reformvorschläge waren auf die Abschaffung der schrankenlosen Konkurrenz und Errichtung eines umspannenden Netzes von Produktivgenossenschaften gerichtet. Auf diesem Wege sollte die Vergenossenschaftlichung der Wirtschaft mit Unterstützung des Staates24 realisiert werden. Die praktische Umsetzung durch Unterhaltung industrieller Nationalwerkstätten zur Beschäftigung von Arbeitslosen und durch eine breit angelegte Gründung von Produktivgenossenschaften brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg.
Auch die weiteren zahlreichen praktischen Versuche, etwa die Gründung von Konsumvereinen bereits 1830 in Guebwiller (Elsass), dann 1848 in Lyon von Anhängern Fouriers und 1849 in Lille durch Arbeiter erwiesen sich aus unterschiedlichen Gründen schon nach kurzer Zeit als erfolglos.25 Dagegen blieben die Produktivgenossenschaften als Genossenschaftsart erhalten, vor allem, soweit es sich um handwerksmäßig produzierende Betriebe handelte. Der Produktivgenossenschaft galt weiterhin das Hauptinteresse der französischen Arbeiterschaft, die darin die einzige Antwort auf die soziale Frage sah.26
3.3 Deutschland
Auf der Suche nach gedanklichen und praktischen Ansätzen zur Herausbildung moderner Genossenschaften wird man in den Phasen der Gründung von Vereinen zur Besserung der Lebensumstände um die Mitte des 19. Jahrhunderts und der Verfolgung zunächst ethischer, sozialer und karitativer Bestrebungen fündig. Als Organisationen, die zu den späteren Genossenschaften hinführten, traten zuerst die Arbeiterbildungsvereine in Erscheinung, deren Ziele „die allgemeine Bildung sowie die sittliche Hebung der Mitglieder (waren – Einf.), denn beides ist unerläßlich zum zielbewußten Streben nach Verbesserung der Lebensverhältnisse.“27 Es existierten auch Sparvereine, die selbst kleinste Einlagen sammelten, um in der preisgünstigen Sommerzeit größere Mengen lebensnotwendiger Güter (Holz, Kartoffeln und Hülsenfrüchte) zu kaufen, die sie in der teueren Winterzeit günstig abgaben.28
Wie für England und Frankreich ist der weitere Weg zu modernen Genossenschaften eng mit den Namen international bekannt gewordener Persönlichkeiten verbunden, von denen Huber, Schulze und Raiffeisen den größten Einfluss ausübten. Bei aller Vielfalt der Vereinstypen traten als Schwerpunkt die Spar- und Kreditvereine hervor.
Der erste geistige Initiator der Genossenschaftsbewegung und ein „Bahnbrecher der Genossenschaftsidee“29 war Victor Aimé Huber





























