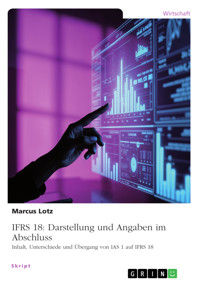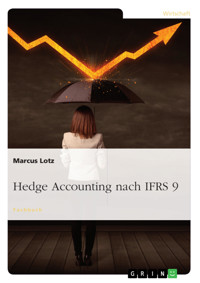Genussrechte und -scheine als Finanzierungsinstrument bei Genossenschaften und deren Bilanzierung E-Book
Marcus Lotz
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 1994 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Prüfungswesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Dieses Buch befasst sich mit Genussrechten als Finanzierunginstrument bei Genossenschaften. Es geht dabei zunächst auf deren Vereinbarkeit mit dem genossenschaftlichen Förderauftrag unter der Heranziehung genossenschaftlicher Grundsätze ein. Zudem werden die zahlreichen Ausgestaltungsmöglichkeiten beschrieben, aufgrund derer eine Qualifikation als Eigen- oder Fremdkapital erfolgt, von denen letzendes die empfehlenswerte Ausgestaltung dieser Rechte im Einzelfall abhängt. In einem abschliessenden Teil werden schliesslich die Bilanzierungsfragen je nach Ausgestaltung der Genussrechte dargestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus, Bachelor und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Zusammenfassung und Veranlassung der Diplomarbeit:
Anlass des vorliegenden Diplomarbeitsthemas ist die in den letzten Jahren erfolgte Wiederentdeckung der Genussrechte zur Finanzierung von Genossenschaften, mit der sich daher auch die Literatur eingehend beschäftigt hat. Die Bewältigung der derzeitigen wirtschaftlichen Situation sowie der durch § 1 GenG erschwerte Eigenkapitalaufbringung erfordern die Ausnutzung sämtlicher möglicher Finanzierungsformen. Die hier zu untersuchende Zulässigkeit von Genussrechten bzw. -scheinen für die eG ist vor allem an der Vereinbarkeit mit dem Förderungsauftrag (§ 1 GenG) zu messen, sowie an den zu dessen Auslegung heranzuziehenden genossenschaftlichen Grundsätzen. Dabei ist auch die Vielzahl der Ausgestaltungsmöglichkeiten der Genussrechtsverhältnisse zu berücksichtigen, die letztendes über ihre Zulässigkeit für die eG entscheiden. Bezüglich der genossenschaftlichen Grundsätze wird die Genussrechtsausgabe bei der eG durch den Selbstverwaltungsgrundsatz beschränkt, soweit über bloße Auskunftsrechte bzgl. grundlegender Entscheidungen der eG oder die Teilnahme der Genussberechtigten an der Generalversammlung ohne Stimm- und Rederecht hinausgegangen wird.
Eine Gewinnorientierung der Genussrechtsvergütung ist durchaus zulässig, da es sich hierbei allenfalls um eine Vorwegvergütung vor der Bilanzaufstellung handelt, nicht aber um zu verwendenden Bilanzgewinn. § 19 GenG steht dieser Vergütung nicht entgegen. Die Ausgestaltung der Genussrechtsverhältnisse entscheidet auch darüber, ob das entstehende Genussrechtskapital als Eigen- oder Fremdkapital in der Bilanz erscheint oder lediglich erfolgswirksam zu vereinnahmen ist. Soweit Genussrechte unentgeltlich begeben worden sind, erfolgt keine bilanzielle Erfassung. Wurden sie entgeltlich überlassen, stellt das Genussrechtskapital Eigenkapital dar, soweit es der eG entsprechend langfristig zur Verfügung steht, mit einer Nachrangabrede verbunden ist und die Vergütung ausschließlich gewinnorientiert ist, nicht aber aus dem Vermögen gezahlt wird. Fehlt eines dieser Kriterien, erfolgt die Bilanzierung unter dem Fremdkapital. Der Eigenkapitalcharakter endet weiterhin (wie bei Kreditinstituten) in den letzten beiden Geschäftsjahren ihres Bestehens oder bei Kündigung des Genussrechtsverhältnisses.
Abkürzungen:
Inhaltsverzeichnis:
Zusammenfassung und Veranlassung der Diplomarbeit:
Abkürzungen:
Inhaltsverzeichnis:
I. Grundsätzliches
1. Problemstellung und Vorgehensweise
2. Terminologie
2.1. Finanzierungsinstrumente/Unternehmensfinanzierung
2.2. Genussrechte und Genussscheine
2.3. Definition Genossenschaft, Gegenstand
II. Darstellung der Finanzierungsproblematik bei Genossenschaften
1. Gegenstand, Grundproblem
1.1. Gegenstand
1.2. Grundproblem
2. Motive/Zielsetzung und Ableitung von Anforderungen bzgl. der Ausgestaltung von Genussrechten bzw. -scheinen
2.1. Rentabilität
2.2. Liquidität bzw. Liquidierbarkeit
2.3. Sicherheit (Risiko)
2.4. Einfluss und Sonstiges
3. Die Eignung von Genussrechten bzw. -scheinen für die Finanzierung der eingetragenen Genossenschaft
4. Vereinbarkeit von Genussrechten bzw. -scheinen mit dem genossenschaftlichen Förderungsauftrag
5. Verein Selbsthilfegrundsatzbarkeit von Genussrechten bzw. -scheinen mit den genossenschaftlichen Grundsätzen
5.1. Vereinbarkeit von Genussrechten bzw. -scheinen mit dem Selbsthilfegrundsatz
5.2. Vereinbarkeit von Genussrechten bzw. -scheinen mit dem Selbstverwaltungsgrundsatz
5.3. Vereinbarkeit von Genussrechten bzw. -scheinen mit dem Selbstverantwortungsgrundsatz
5.4 Vereinbarkeit von Genussrechten bzw. -scheinen mit dem „Identitätsprinzip“
6. Vereinbarkeit von Genussrechten bzw. -scheinen mit den genossenschaftlichen Gewinn- und Verlustverteilungsregeln
6.1. Vereinbarkeit von Genussrechten bzw. -scheinen mit den genossenschaftlichen Gewinnverteilungsregeln
6.2. Vereinbarkeit von Genussrechten bzw. -scheinen mit den genossenschaftlichen Verlustverteilungsregeln
6.3. Vereinbarkeit einer Genussrechts- bzw. -scheinausgabe mit den Vorschriften der Liquidationserlösverteilung
III. Charakterisierung des Finanzierungsinstrumentes Genussrecht bzw. Genussschein
1. Ausgabe von Genussrechten bzw. -scheinen und deren gesellschaftsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen bei Genossenschaften
1.1. Aufnahme in das Statut
1.2. Gesellschaftsrechtliche Zuständigkeit
1.3. Die erforderlichen Mehrheiten
1.4. Anmeldung zum Genossenschaftsregister und die Eintragung
2. Mögliche Rechte und deren Ausgestaltung bzgl. Genussrechten und scheinen
2.1. Monetäre Rechte
2.2. Gestaltungsrechte
2.3. Einwirkungs- und Informationsrechte
2.4. Steuerliche Bestimmungsfaktoren für die Ausgestaltung von Genussrechtsverhältnissen (als Eigenkapital/Fremdkapital) bei Genossenschaften
3. Bezugsrecht für Genossen
4. Beeinträchtigung und Schutz der Rechtsstellung des Genussrecht- bzw. Genussscheininhabers
4.1. Mögliche Beeinträchtigungen
4.2.Ausmass möglicher Beeinträchtigungen
4.3. Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen
5. Beendigung von Genussrechtsverhältnissen
IV. Bilanzierung von Genussrechten bei Genossenschaften
1. Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital
2. Bilanzierung bei den Genossenschaften
2.1.1. Erfolgsneutrale Passivierung
2.2. Vergütung und Verlustbeteiligung
V. Zusammenfassung: Optimale Gestaltung des Finanzierungsinstrumentes Genussrechte bzw. -scheine bei Genossenschaften.
Anlage 1: Spezielle Formen von Genussscheinen
Literaturverzeichnis
I. Grundsätzliches
1. Problemstellung und Vorgehensweise
Die Finanzierungswahl des Unternehmens gehört zu den grundlegenden unternehmerischen Entscheidungen. Durch die neuerlichen Unsicherheiten am Kapitalmarkt[1], sowie die Herausforderungen der deutschen Einheit, der Öffnung des Ostens, dem europäischen Binnenmarkt und den verstärkten Umweltschutzmaßnahmen müssen Unternehmen sowohl zur Bewältigung dieser Herausforderungen als auch zur Nutzung der hieraus folgenden Expansionsmöglichkeiten bei der Eigenkapitalbeschaffung sämtliche Möglichkeiten ausnutzen[2]. Dieses trifft insbesondere auf Genossenschaften zu, als diese verpflichtet sind, ihre Genossen herbei zu unterstützen (§ 1 GenG).
Das Problem der Eigenfinanzierung bei Genossenschaften liegt aufgrund der durch den Förderauftrag beschränkten Mitgliederzahl in ihrer begrenzten Möglichkeit der Eigenkapitalbeschaffung am Kapitalmarkt (vgl. Abschnitt II.). In der Vergabe von Genussrechten bzw. -scheinen kann nun eine Möglichkeit gegeben sein, der eG auch von Nichtgenossen Kapital zuzuführen, wobei insbesondere die Vergabe dieser Gläubigerrechte an Nichtgenossen nicht mit der Vergabe von Mitgliederrechten einhergeht. Soll dieses Genussrechtskapital nun dennoch Eigenkapitalcharakter besitzen, besteht die Gefahr, dass dieses entweder zum Genossenschaftszweck (Förderung der Mitglieder) in Widerspruch gerät oder die eG zum erwerbswirtschaftlichen Unternehmen wird. Es ist seitens der eG daher vor der Genussrechtsausgabe zu prüfen, ob eine Ausgabe von Genussrechten bzw. -scheinen für die eG überhaupt möglich ist und – wenn ja – welche Ausgestaltungsformen dabei zulässig sind, um mit dem genossenschaftlichen Förderungszweck nicht in Konflikt zu geraten. Maßstäbe hierfür sind der § 1 GenG, die zu seiner Auslegung vorhandenen genossenschaftlichen Grundsätze sowie die genossenschaftlichen Gewinn- und Verlustbeteiligungsregeln. Weiterhin wird hier auf genossenschaftliche Probleme bezüglich der Genussrechtsausgabe eingegangen, insbesondere auf die hierzu notwendigen Zulässigkeitsvoraussetzungen und die möglichen Beeinträchtigungen des Genussrechtsinhabers.
In Abschnitt IV. wird erläutert, unter welchen Kriterien die Genussrechte Eigenkapitalcharakter erlangen. Weiterhin werden die Bilanzierungsprobleme behandelt, die mit dem richtigen Ansatz von Genussrechtsverhältnissen in der Bilanz je nach ihrer Ausgestaltungsform entstehen. Maßgebend hierfür sind die einschlägigen Rechnungslegungsvorschriften des HGB. Von der Ausgestaltung hängt ab, ob eine Passivierung unter dem Eigen- oder Fremdkapital zu erfolgen hat oder ob das Genussrechtskapital ohne Bilanzierung schlichtweg erfolgswirksam vereinnahmt wird.
2. Terminologie
2.1. Finanzierungsinstrumente/Unternehmensfinanzierung
Unter Finanzierung i.e.S. versteht man die Deckung eines gegebenen Kapitalbedarfs. I.w.S. fallen sämtliche Finanzdispositionen unter den Finanzierungsbegriff, „d.h. Kapitalbeschaffung und -disposition bzw. -anlage (Investition und Kapitaltilgung)“[3]. Nachdem hier heutzutage eindeutig das (Geld-)Kapitalbeschaffungsmotiv im Vordergrund steht[4], kann der in diesem Zusammenhang stehende Begriff „Finanzierungsinstrumente“ in seiner Bedeutung als Instrument[5] gesehen werden.
2.2. Genussrechte und Genussscheine
Genussrechte und -scheine können nun als Durchführungsinstrumente für ein solches Finanzinstrument angesehen werden. Genussrechte bzw. -scheine haben den allgemeinen Vorteil mit keinen Mitgliedschaftsrechten verbunden zu sein[6] und verbriefen i.d.R. schuldrechtliche Ansprüche des Berechtigten auf typische Vermögenswerte wie Anteile am Reingewinn, am Liquidationserlös oder auf Bezug neuer Genussscheine[7]. Während der Gewinnanteil heute das zentrale Gestaltungsmoment ist, sind Bezugsrechte heutzutage bei Genussrechten seltener zu finden[8], wohingegen – wegen der damit verbundenen steuerlichen Nachteile – Liquidationsanteile verpönt sind[9].
Auch wenn die Begriffe Genussrecht und -schein häufig synonym verwendet werden, ist eine strikte Trennung gegeben, weil sie eben nicht das gleiche darstellen[10]:
Zum einen bezeichnet man mit Genussrecht das einzelne begründete Recht selbst, zum anderen – als Oberbegriff – die Gesamtheit der eingeräumten Rechte. Im Gegensatz hierzu stehen Genussscheine als urkundlich verbriefte Genussrechte. Unter dem Begriff Genussrechtsverhältnisse soll fortan der Oberbegriff für Genussrechte und Genussscheine verstanden werden[11].
Abb. 1: Genussrechtsverhältnisse
Als Kapitalform können sie – pauschal gesehen – weder eindeutig dem Eigen- noch dem Fremdkapital zugeordnet werden (vgl. Abschnitt IV.2.)[12]. Ihre Emission ist vorteilhaft im Vergleich zur Aufnahme neuer Genossen, weil sich die Genossenstruktur dadurch nicht verschiebt. Im Vergleich zu Anleihen besteht der Vorteil, dass keine festen Zins- und Tilgungsvorschriften bestehen[13].
2.2.1. Abgrenzung zur stillen Gesellschaft
Die stille Gesellschaft wird durch einen Vertrag i.S.d. § 705 BGB begründet. Die hier – nicht aber bei der Begründung von Genussverhältnissen – entstehende Zweckgemeinschaft ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass der stille Gesellschafter nach § 233 HGB bestimmte Kontrollrechte hat[14]. Hinzu kommt beim stillen Gesellschafter noch ein Kündigungsrecht gemäß § 234 HGB, welches sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 132, 134, 135 HGB für die OHG richtet. Das Bestreben des Genussrechtsinhabers liegt allein in der Erzielung einer hohen Rendite[15]. Dem Genussrecht fehlt daher jegliches Kontrollrecht und i.d.R. das vorzeitige Kündigungsrecht.
2.2.2. Abgrenzung zum partiarischen Darlehen
Die Gewinnbeteiligung ist bei einem partiarischen Darlehen notwendige Voraussetzung, während Genussrechte bzw. -scheine auch unentgeltlich gewährt werden können, ohne dass ihre Rechtsnatur hiervon berührt wird. Des Weiteren müssen (im Gegensatz zum partiarischen Darlehen) Genussrechte bzw. -scheine nicht auf den Gewinnanteil beschränkt bleiben, sondern sie können weitere Vermögensrechte beinhalten, wie z.B. einen Anspruch auf Liquidationserlös, die Beinhaltung von Wandlungs- und Optionsrechten oder die Vereinbarung einer Verlustbeteiligung an der eG[16].
2.2.3. Abgrenzung zur Gewinnobligation
Die Gewinnobligation unterscheidet sich insofern nicht von Genussrechten, als dass auch sie einen schuldrechtlichen Anspruch beinhaltet. Anders als bei Genussrechtsverhältnissen muss sich die Verzinsung von Gewinnschuldverschreibungen nicht ausschließlich am Unternehmensgewinn orientieren. Bei einer Gewinnschuldverschreibung reicht die Vereinbarung einer erfolgsunabhängigen Mindestverzinsung aus, die mit einer erfolgsabhängigen Ausschüttung kombiniert werden kann. Nach einer Untersuchung des Bundesjustizministeriums (ca. 1984) ist für die Abgrenzung von Gewinnschuldverschreibungen zu Genussrechten wesentlich, ob die „garantierte Mindestverzinsung“ gewinnunabhängiger „Zinsaufwand“ oder Gewinnverteilung darstellt[17]. Eine Abgrenzung – falls diese überhaupt erforderlich ist – kann letztenendes nur anhand der konkreten Vereinbarungen erfolgen[18].
2.3. Definition Genossenschaft, Gegenstand
Genossenschaften sind Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Gesellschaftszweck in der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichem Geschäftsbetriebes liegt (§ 1 I GenG). Unter genossenschaftlicher Förderung versteht man die auf Gesellschaftsabschluss basierende Vermittlung wirtschaftlicher Leistungen zwischen Mitgliedern und eG.
Wie bei anderen Unternehmen gilt es auch bei der eG zwischen Gesellschaftszweck und Unternehmensgegenstand zu unterscheiden[19]. Der Unternehmensgegenstand umfasst den Bereich, in dem der Gesellschaftszweck verwirklicht werden soll. Im vereinsrechtlichen Sinne gehört damit der Unternehmensgegenstand zum Gesellschaftszweck[20]. Während der Gesellschaftszweck (§ 1 I GenG) die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes umfasst, auch ohne dass dieses im Statut ausdrücklich geregelt werden müsste[21], beinhaltet der Unternehmensgegenstand den satzungsmäßig zwingenden Regelungsinhalt (§ 6 Nr. 2 GenG), wie dieser Förderzweck konkret erreicht werden soll. Die Satzung muss dazu bestimmen, „von welcher Art die zu fördernden Mitgliederwirtschaften sein müssen und auf welche Weise diese gefördert werden sollen“[22].
Die eG ist juristische Person und Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuches (§ 17 GenG). Ihre Entstehung erfolgt durch Eintragung in das Genossenschaftsregister (§§ 3, 13 GenG). Sie hat kein festes Grundkapital wie Kapitalgesellschaften, sondern das Grundkapital schwankt mit der Mitgliederzahl. Sämtliche Mitglieder sind gleichberechtigt ohne Rücksicht auf die Höhe der Kapitalbeteiligung. Jeder Genosse zeichnet einen obligatorischen Geschäftsanteil (bzw. mehrere obligatorische Geschäftsanteile, soweit dieses das Statut gemäß § 7a II GenG vorsieht) und muss eine Einzahlung von mindestens 10 % leisten (§ 7 Nr. 1 GenG)[23]. Das Geschäftsguthaben des Genossen ergibt sich gemäß § 19 GenG aus der Höhe der Einzahlungen auf den Geschäftsanteil einschließlich der zugeschriebenen Gewinne und abzüglich realisierter Verluste. Für die Verrechnung der anteiligen jährlichen Gewinne bzw. Verluste sowie für die Abfindung bei Austritt eines Genossen bildet dieses Geschäftsguthaben die Basis.
Aus dem genossenschaftlichen Förderungsbegriff resultiert ein Konflikt zur bloßen Beteiligung: es kann nur derjenige gefördert werden, der die „naturale Förderleistung“ der eG verwerten kann[24]. Damit wird der Förderbegriff zur entscheidenden Größe der Unternehmensfinanzierung. Die Finanzierung ist von den in Frage kommenden Kapitalgebern abhängig. Eine Finanzierung durch zur Zeichnung von Genossenschaftsanteilen Berechtigten kommt aber nur für Förderungswürdige in Frage. Während Aschermann für Beteiligungen von Nichtgenossen an Genossenschaften i.R.d. § 2 Nr. I lit. g) 5. VermBG i.V.m § 19a III Nr. 7 EStG insbesondere Arbeitnehmer nur für bestimmte Genossenschaftsarten für möglich hält, dürfte die Genossenschaftsart dennoch für Genussrechtsverhältnisse unproblematisch sein, da die Genussrechte keine Mitgliedschaftsrechte verbriefen.
II. Darstellung der Finanzierungsproblematik bei Genossenschaften
1. Gegenstand, Grundproblem
1.1. Gegenstand
Die für den Begriff Finanzierung entscheidenden Phänomene sind Informationsunterschiede zwischen Kapitalgebern und -nehmern sowie Anreizprobleme zur Kapitalüberlassung, wobei letztere Informationsunterschiede voraussetzen. Die eG hat gegenüber den Kapitalgebern i.d.R. einen Informationsvorsprung bzgl. „ihres Willens und ihrer Fähigkeit, Rückflüsse in der vereinbarten oder vom Kapitalgeber erhofften Höhe zu tätigen“[25]. Dieser Informationsunterschied wird als asymmetrische Information zwischen eG und Kapitalgebern bezeichnet[26]. Aus dieser asymmetrischen Information heraus entsteht nun das Anreizproblem, denn wenn beide Seiten gleichermaßen informiert wären, könnte nicht die eine Seite über das Geld der anderen Seite Entscheidungen treffen, die sie begünstigt und somit zwangsweise die andere Seite benachteiligt. Das Verhältnis zwischen Kapitalgeber und eG ist also durch Informationsunterschiede gekennzeichnet, welche die eG befähigt, die Finanzierung im eigenen Interesse zu beeinflussen, der rationale Kapitalgeber dieses aber weiß. Somit lässt sich das Grundproblem mit der Fragestellung umschreiben: Wie können Genossenschaften in einer Welt mit unsicheren Erwartungen zu Recht skeptische und misstrauische Kapitalgeber dazu veranlassen, dass sie ihnen ihr Geld überlassen und wie kann die Partnerschaft mit möglichst geringen Kosten zustande kommen[27]?
1.2. Grundproblem