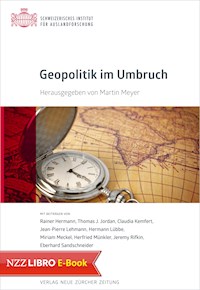
Geopolitik im Umbruch E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sozialwissenschaftliche Studien des Instituts für Auslandsforschung
- Sprache: Englisch
Zurzeit erleben wir grössere Verschiebungen im globalen Kräftespiel. Die USA sehen sich vor Herausforderungen, die sowohl durch den Aufstieg Chinas wie auch durch veränderte Konstellationen im Nahen und Mittleren Osten gebildet werden. Asien ist, über China hinaus, zu einem Global Player geworden, der ökonomische und kulturelle Prozesse neu definiert. Europa präsentiert sich gegenwärtig als Kontinent vielfacher Verunsicherung. Hinzu treten im Echoraum des sogenannten «arabischen Frühlings» überraschende und als revolutionär zu bezeichnende Manifestationen öffentlicher Proteste. Was dies in Zukunft für die Welt insgesamt und die Verteilung von Macht und Einfluss bedeuten könnte, ist noch schwer abzuschätzen. Insbesondere auch der rasant gesteigerte Fluss von Daten und Informationen über «klassische» Grenzen hinaus wird zum Faktor geopolitischer Veränderungen. Grund genug, darüber nachzudenken – wie immer aus kompetent-berufenen Quellen. Ergänzt wird das Leitthema «Geopolitik im Umbruch» um Fragen nach dem starken Franken, der künftigen Energieversorgung und dem Wandel im Medienzeitalter. Mit Beiträgen von Rainer Hermann, Thomas J. Jordan, Claudia Kemfert, Jean-Pierre Lehmann, Hermann Lübbe, Miriam Meckel, Herfried Münkler, Jeremy Rifkin, Eberhard Sandschneider.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE STUDIENDES SCHWEIZERISCHEN INSTITUTS FÜRAUSLANDFORSCHUNGBAND 40 (NEUE FOLGE)
Begründet vonProf. Dr. Dr. h.c. Friedrich A. Lutz (†)
www.siaf.ch
Geopolitik im Umbruch
Herausgegeben von Martin Meyer
Beiträge von: Rainer Hermann,Thomas J. Jordan, Claudia Kemfert,Jean-Pierre Lehmann, Hermann Lübbe,Herfried Münkler, Jeremy Rifkin,Eberhard Sandschneider
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgrupppe AG
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2014
(ISBN 978-3-03823-884-3)
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-465-0
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG
Inhalt
Vorwort
THOMAS J. JORDANStarker Franken und hoher Ertragsbilanzüberschuss – ein Widerspruch?
JEREMY RIFKINLeading the Way Toward a Third Industrial Revolution
HERMANN LÜBBEDie Welt, in der wir leben – drei prominente Prognosen und was stattdessen der Fall ist
CLAUDIA KEMFERTEnergiekrise, Finanzkrise, Klimakrise – wie wir drei Krisen mit einer Klappe schlagen können
HERFRIED MÜNKLERRaum im 21. Jahrhundert – über geopolitische Umbrüche und Verwerfungen
RAINER HERMANNKein Frühling in Arabien – mehr Islam und mehr Freiheit
JEAN-PIERRE LEHMANNGeopolitics of the Future – Asia 2014 – Lessons from Europe?
EBERHARD SANDSCHNEIDEREuropas erfolgreicher Abstieg in geopolitischer Perspektive
Autoren und Herausgeber
Vorwort
Unser Jahrbuch für die Aktivitäten des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung im Jahr 2013 folgt dem Titel «Geopolitik im Umbruch», der damit zugleich als thematische Klammer die Vorträge des Herbstsemesters 2013 an der Universität Zürich umspannte. Geopolitik: Das meint nichts anderes, als dass Mächte und Räume wieder Geltung beanspruchen, wie dies zur Zeit des Kalten Kriegs nicht der Fall war, als das bipolare, ideologisch, politisch, wirtschaftlich und militärisch klar definierte System zwischen der Sowjetunion und ihren Satelliten einerseits, den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Verbündeten andererseits zu übersichtlichen, wenn auch immer wieder gefährlichen und explosiven Strukturen führte.
Anders gesagt, die Welt von heute ist wesentlich unübersichtlicher geworden. Neue Grossakteure wie etwa China haben die Bühne mit Macht und Selbstbewusstsein betreten, alte wie Russland – oder mutatis mutandis die Türkei – präsentieren sich teils schleichend, teils plötzlich in bisher ungewohnter Perspektive. Generell darf behauptet werden, dass sich die global ausgelegten Hoffnungen von 1989 auf eine Entwicklung hin zu Frieden, Wohlstand und gegenseitiger Verständigung nicht bestätigt haben. Als jüngstes hoffnungsfrohes Zeichen des Aufbruchs in eine Moderne schwindender Vorurteile und Erstarrungen ist auch der «Arabische Frühling», der 2011/12 wie ein Lauffeuer die autoritären Regimes des Mittelmeerraums aufzusprengen versuchte, bisher kläglich gescheitert. Denn auch hier manifestieren sich hinter der Bewegung handfeste Interessen von Machthabern und Machtgruppen gegen die Forderungen nach Freiheit und Selbstbestimmung, sowohl innenpolitisch wie mit dem Blick auf einen regionalen Grossraum divergierender Identitäten, wozu auch gehört, dass sich die Parteiungen im Zeichen eines zunehmend radikalisierten Islam erbitterte Kämpfe liefern.
Aber auch das Grossprojekt einer Pax Americana mit dem Versprechen, die Welt insgesamt nach und nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der im Westen herrschenden Verhältnisse entgegenzubringen, ist nicht vorangekommen. Im Gegenteil hat sich der Mittlere Osten in eine überaus aggressive Krisenregion zurückentwickelt, die wiederum – auch aus geopolitischen Gründen – diverse Drahtzieher vor und hinter den Kulissen mobilisiert. Das alteuropäische Diktum «Cuius regio, eius religio» gewinnt unter solchen Vorzeichen eine überraschende Renaissance: Einflusszonen und Grenzziehungen richten sich für die Arabische Welt auch nach der herrschenden Religion aus, die für den Islam immer die konkreten politischen und sozialen Lebenswelten miteinschliesst und bestimmt. Die 2005 von dem Publizisten und Kolumnisten Thomas Friedman geprägte Formel «The world is flat» hat damit eine kräftige Korrektur erfahren. Freihandel und global erweiterte Marktchancen reiben sich teilweise heftig an gegenläufigen Realitäten von Protektionismus, nationaler Agenda und strategischem Zweckdenken von Staaten, Herrschaftskreisen und ideologischer Voreingenommenheit.
Sämtliche Referate des Herbstsemesters fokussierten ihre spezifischen Perspektiven vor diesem Gesamtbild. Der Philosoph Herfried Münkler entwickelte ein Szenario, in welchem das klassische Denken in eigenen und fremden Räumen seine Wiederkunft findet, auch wenn die globalen Netzwerke von Kommunikation, Einflussnahme auf die Meinungsbildung und militärtechnologischer Präsenz zugleich die Grenzen traditioneller Machtpolitik nachweisen. Eberhard Sandschneider zeigte auf, welche Chancen sich für Europa wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell eröffnet haben, seit der Kontinent sich von den Gelüsten verabschieden musste, geopolitisch an der Front der Ereignisse mitzumarschieren. Allerdings kann damit auch vermeintliche «Schwäche» oder jedenfalls Schwächung von Mächten ausgenutzt werden, die von der Peripherie her plötzlich etablierte Ordnungen stören und selbst vor Annexionen nicht zurückschrecken, wie dieser Monate die Ereignisse rund um die Ukraine und um Putins Powerplay manifestieren.
Rainer Hermann, seit langer Zeit als Korrespondent bestens vertraut mit den arabischen Verhältnissen, analysierte die Folgen, die als vorläufige Bilanz aus dem Arabischen Frühling zu ziehen sind. Man muss kein notorischer Pessimist sein, um zu sehen, dass im Nahen und Mittleren Osten der Autoritarismus weiterhin die Wirklichkeit definiert, auch wenn das Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung immerhin unter jüngeren Leuten des gebildeten Mittelstands an Triebkraft gewinnt und nach allem, was geschehen ist, nicht einfach mehr ausradiert werden kann. Jean-Pierre Lehmann endlich wandte sich aus intimer Kennerschaft des pazifischen Raums der asiatischen Welt zu, wo Geopolitik ebenfalls Bruchlinien und Gräben aufwirft: am deutlichsten in den schwelenden Grenz- und Raumkonflikten zwischen China und Indien sowie zwischen China und Japan.
Die Vorträge des Frühjahrssemesters waren wie immer thematisch frei gehalten, sodass eine spannende Kür zwischen Ökonomie, Ökologie, Innovationspolitik und Philosophie durchlaufen werden konnte, die auch vom Gewicht der Sprechenden profitierte. Während sich Thomas Jordan, der Chef der Schweizerischen Nationalbank, mit aktuellen Fragen und Forderungen zur Geldpolitik beschäftigte, gab Hermann Lübbe, ein Altmeister zeitdiagnostischer Kompetenz, einen eindrücklichen Überblick über das, was die Menschen sowohl zurzeit wie darüber hinaus auch grundsätzlich als freie und aufgeklärte Wesen umtreibt.
Einmal mehr erfüllte somit das Schweizerische Institut für Auslandforschung seinen Auftrag, kompetent, informiert und analytisch ausgreifend zu erläutern, was in der Welt wie im eigenen Lande vor sich geht. Sämtliche Veranstaltungen waren sehr gut besucht und fanden positives Echo. Das Thema «Geopolitik im Umbruch» soll im Herbst 2014 um das Folgethema «Zukunft der Demokratie» erweitert werden. – Abschliessend sei einmal mehr den Partnern des Instituts für ihr wertvolles Engagement gedankt.
Dr. Martin Meyer, Präsident des Vorstands
Zürich, im April 2014
Starker Franken und hoher Ertragsbilanzüberschuss – ein Widerspruch?
THOMAS J. JORDANVortrag vom 19. Februar 2013
Seit nunmehr bald 18 Monaten setzt die Nationalbank den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro mit aller Konsequenz durch. Im Sommer 2011 hatte die Aufwertung des Frankens ein solches Ausmass angenommen, dass wir handeln mussten, um unseren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Die Nationalbank hat bekanntlich die Preisstabilität zu gewährleisten und dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung zu tragen. In einem historisch beispiellosen Umfang weiteten wir zunächst die Liquidität am Geldmarkt aus. Weil diese Massnahme am Devisenmarkt nicht die gewünschte nachhaltige Stabilisierung erzielte, legten wir am 6. September 2011 schliesslich den Mindestkurs fest. Damit trat die Nationalbank einer für die Schweizer Wirtschaft bedrohlichen Verschärfung der monetären Bedingungen aufgrund der massiven Frankenstärke entgegen. Die internationalen Entwicklungen verunsicherten die Finanzmärkte und liessen den Franken zum sicheren Hafen werden. Bei Zinsen von null gaben wir mit der Einführung des Mindestkurses dem Devisenmarkt eine klare Leitplanke in einer Situation, in der die Möglichkeiten der konventionellen Geldpolitik ausgeschöpft waren. Ähnlich wie andere Zentralbanken bewegt sich die Nationalbank damit im Gebiet der unkonventionellen Geldpolitik.
Die Notwendigkeit des Mindestkurses wird im In- und Ausland weitgehend anerkannt. Namentlich verstehen die anderen Zentralbanken und der Internationale Währungsfonds (IWF) die spezielle Lage, in der sich die Schweiz befindet. Sie anerkennen, dass angesichts der aussergewöhnlichen Umstände der Mindestkurs erforderlich ist. Dieses Verständnis ist nicht zuletzt deshalb vorhanden, weil wir von Beginn an unsere Beweggründe für die Einführung des Mindestkurses klar dargelegt und erläutert haben. Ausserdem haben wir den Mindestkurs auf einem Niveau festgelegt, bei dem der Franken weiterhin hoch bewertet ist.
Die beträchtlichen Wechselkursbewegungen einiger Währungen haben in letzter Zeit verschiedentlich zu Diskussionen Anlass gegeben. So wurde die Beeinflussung der Wechselkurse durch die Zentralbanken kritisiert, sei es direkt über Devisenkäufe oder indirekt über zusätzliche geldpolitische Lockerungsmassnahmen wie beispielsweise Wertschriftenkäufe. Letztlich – so machen die Kritiker geltend – würden die betreffenden Zentralbanken eine «Beggar-thy-neighbour»-Politik betreiben: Es ginge ihnen nur darum, die eigene Wirtschaft mittels einer Schwächung der Währung auf Kosten der anderen Länder zu unterstützen. Befürchtet wird zuweilen auch, dass sich daraus ein Abwertungswettlauf zwischen den einzelnen Ländern entwickeln könnte. Erwähnt werden in diesem Zusammenhang vor allem Japan, Grossbritannien und die USA, vereinzelt aber auch die Schweiz. Diskussionen um die Zulässigkeit oder Notwendigkeit einer Beeinflussung der eigenen Währung finden auch einen Nährboden in den nach der Jahrtausendwende deutlich gewachsenen globalen Ungleichgewichten. Die Defizite in der Ertragsbilanz zahlreicher Länder nahmen deutlich zu. Im Gegenzug stiegen bei anderen Ländern die Überschüsse.
Diese globalen Ungleichgewichte können zu Instabilitäten führen und somit das weltwirtschaftliche Wachstum gefährden. Angesichts dieser Entwicklung wird intensiv debattiert, inwiefern Überschussländer für diese Ungleichgewichte mitverantwortlich sind, nicht zuletzt aufgrund einer potenziell zu schwachen Währung. Als Überschussländer stehen dabei vor allem China, Japan und Deutschland im Brennpunkt dieser Diskussion. Im aktuellen Kontext wird zuweilen aber auch auf den Überschuss in der Ertragsbilanz der Schweiz verwiesen. 2011 betrug der Ertragsbilanzüberschuss 8,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Dieser hohe Überschuss, so lautet die Argumentation, sei ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Franken nicht stark, sondern zu schwach sei. Die Nationalbank solle deshalb den Mindestkurs aufheben und eine weitere Aufwertung des Frankens zulassen. Dadurch würde sich der Überschuss in der Ertragsbilanz zurückbilden. Dies wäre ein Beitrag zum Abbau der globalen Ungleichgewichte.
Diese Argumentation basiert auf Unkenntnis der Situation der Schweiz und führt daher auch zu einer mitunter fehlgeleiteten Diskussion über unsere Geldpolitik. Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden aufzeigen, dass die Nationalbank keine «Beggar-thy-neighbour»-Politik betreibt und dass zwischen dem hoch bewerteten Franken und dem beachtlichen Ertragsbilanzüberschuss der Schweiz kein Widerspruch besteht. Dazu werde ich als Erstes die Hauptkomponenten einer Ertragsbilanz in Erinnerung rufen. Danach werde ich der Frage nachgehen, was ein Überschuss und ein Defizit in der Ertragsbilanz bedeuten und unter welchen Umständen dies aus globaler Sicht tatsächlich als problematisch betrachtet werden kann. Den Grossteil meiner Ausführungen widme ich dann den speziellen Ursachen des hohen Ertragsbilanzüberschusses der Schweiz. Diese werden kaum vom Wechselkurs beeinflusst, sondern von der internationalen Entwicklung. Entsprechend ist es auch nicht zielführend, über eine Aufwertung des Frankens den Schweizer Überschuss und die globalen Ungleichgewichte reduzieren zu wollen. Als kleine, offene Volkswirtschaft mit umfangreichen Direktinvestitionen im Ausland leistet unser Land aber durchaus einen ansehnlichen Beitrag zu einem ausgeglichenen globalen Wirtschaftswachstum. Zum Schluss werde ich darlegen, dass die Geldpolitik der Nationalbank nicht auf die Ertragsbilanz ausgerichtet ist. Vielmehr war es die Sorge um die Preisstabilität und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die uns bewog, im Sommer 2011 gegen die massive Überbewertung des Frankens einzuschreiten.
Bedeutung eines Ertragsbilanzüberschusses beziehungsweise -defizits
Ich möchte beginnen mit einigen allgemeinen Bemerkungen zur Ertragsbilanz. Was ist die Ertragsbilanz überhaupt? Die Ertragsbilanz erfasst zunächst die Exporte und Importe von Waren eines Landes. Wenn wir unsere Betrachtungen bereits hier stoppen würden, hätten wir es mit der Handelsbilanz zu tun. Die Ertragsbilanz umfasst aber noch vier weitere Hauptkomponenten. Sie berücksichtigt auch die Exporte und Importe von Dienstleistungen. Ferner bilanziert sie die Erträge durch Investitionen von Inländern im Ausland bzw. Ausländern im Inland, die sogenannten Kapitaleinkommen. Eine weitere Position der Ertragsbilanz sind die Arbeitseinkommen von Inländern im Ausland beziehungsweise von Ausländern im Inland. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Einkommen der Grenzgänger. Schliesslich erfasst sie die laufenden Übertragungen, d. h. Zahlungen vom Inland ans Ausland oder umgekehrt, für die keine direkte Gegenleistung besteht. Darunter fallen beispielsweise die Entwicklungshilfe oder die Überweisungen der ausländischen Arbeitskräfte in der Schweiz an ihre Familien im Heimatland. Weist die Ertragsbilanz einen Überschuss aus, bedeutet dies Folgendes: Die Einnahmen aus dem Waren- und Dienstleistungsexport plus die Kapital- und Arbeitseinkommen aus dem Ausland zuzüglich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland sind addiert höher als die entsprechenden Ausgaben. Ein Ertragsbilanzüberschuss heisst für ein Land nichts anderes, als dass es im Verkehr mit dem Ausland mehr einnimmt, als es ausgibt. Ein Teil der Einkommen dieses Landes wird nicht für Konsum und Investitionen im Inland ausgegeben. Der Sparüberschuss wird im Ausland angelegt, weshalb die Guthaben des Landes im Ausland ansteigen. Ist die Tatsache, dass es Länder mit Ertragsbilanzüberschüssen und solche mit Ertragsbilanzdefiziten gibt, überhaupt ein grundsätzliches Problem? An und für sich spricht nichts dagegen, wenn ein Land lieber mehr spart und diesen Sparüberschuss im Ausland anlegt, also Kapital exportiert, und ein anderes Land mehr konsumiert und investiert, als es selber spart, und damit Kapital importiert. Es gibt keinen – aus der ökonomischen Theorie hergeleiteten – optimalen Ertragsbilanzsaldo. Im Grunde ist jeder Saldo der Ertragsbilanz optimal, solange er ohne verzerrende Einschränkungen des Güter- und Kapitalverkehrs zustande kommt. Der Saldo der Ertragsbilanz reflektiert letztlich die privaten Spar- und Investitionsentscheidungen sowie die Haushaltspolitik des Staates.
Wie ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt, sind grosse Ertragsbilanzdefizite allerdings oft ein vorlaufender Indikator für Finanzkrisen. Dies liegt daran, dass derartige Defizite finanziert werden müssen. Diese Finanzierung kann mitunter abrupt versiegen. Schwierigkeiten können sich insbesondere dann ergeben, wenn ein Defizitland das importierte Kapital konsumiert oder in unrentable Projekte investiert. Die Problematik verschärft sich, wenn nicht nur wenige, sondern mehrere Länder zunehmend hohe Defizite aufweisen. Solche globalen Ungleichgewichte stellen keine Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum der Weltwirtschaft dar. Vor diesem Hintergrund werden die Defizitländer üblicherweise ermahnt, ihren Fehlbetrag nicht ausufern zu lassen beziehungsweise zu reduzieren. Die Kapitalgeber könnten ansonsten das Vertrauen verlieren und nicht mehr bereit sein, mit ihren Sparüberschüssen die Ausgaben der Defizitländer zu finanzieren. Wie ich eingangs erwähnt habe, gerieten angesichts der wachsenden globalen Ungleichgewichte aber auch Überschussländer teilweise in die Kritik. So ist der IWF der Frage nachgegangen, inwiefern auch in Überschussländern Fehlentwicklungen vorliegen, die im Interesse eines Abbaus globaler Ungleichgewichte angegangen werden sollten.
Wenn Fehlentwicklungen in Überschussländern diagnostiziert werden, stehen grob gesprochen zwei Ansätze im Vordergrund, um einen Überschuss in der Ertragsbilanz zu reduzieren. Der erste Ansatz geht davon aus, dass die inländische Nachfrage durch hausgemachte Hindernisse gehemmt werde und deswegen zu schwach sei. Deshalb sollten Massnahmen umgesetzt werden, welche die inländische Nachfrage stärken. Dies entspricht dem sogenannten Absorptionsansatz, der darauf zielt, die Ausgaben für Konsum und Investitionen im Inland zu steigern. Als Hindernis für eine höhere Absorption werden in vielen Fällen Strukturprobleme diagnostiziert. Als Beispiel für ein solches strukturelles Problem wird oft das Sozialversicherungssystem Chinas genannt. Wenn China dieses System verbessere, so lautet die Überlegung, würden die chinesischen Haushalte weniger sparen und mehr konsumieren. Dadurch nähmen die Importe zu, und der Überschuss in der Ertragsbilanz fiele geringer aus. Der zweite Ansatz knüpft dagegen beim Wechselkurs an. Gemäss dieser Argumentationslinie besteht die Fehlentwicklung darin, dass die Währung eines Überschusslandes künstlich schwach gehalten werde. Die Währung müsste sich aufwerten. Denn dies würde die ausländischen Güter billiger machen und damit die Kaufkraft im Inland steigern. Gleichzeitig würden sich die inländisch produzierten Waren verteuern. Gemäss dieser Lesart wird das Land mit einer stärker werdenden Währung mehr importieren und weniger exportieren. Der Ertragsbilanzüberschuss bildet sich zurück, und spiegelbildlich reduzieren sich die Fehlbeträge bei den Defizitländern.
Die Ertragsbilanz der Schweiz
Die Schweiz steht zwar nicht im Zentrum dieser internationalen Diskussion über einen Anpassungsbedarf von Überschussländern. Vereinzelt wird aber auch gegenüber unserem Land angeregt, der Franken solle – trotz der bereits massiven Aufwertung über die letzten Jahre – weiter aufgewertet werden, damit sich der Ertragsbilanzüberschuss zurückbilde. Dies wäre ein Beitrag der Schweiz zum Abbau der globalen Ungleichgewichte. Ich möchte nun darlegen, weshalb diese Argumentation der Situation unseres Landes nicht gerecht wird.
Betrachten wir dazu die Abbildung 1, die den Ertragsbilanzüber-schuss und den realen handelsgewichteten Wechselkurs des Frankens zeigt, den realen Wechselkurs also, der die Wertentwicklung des Frankens zu den Währungen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz misst. Wie zu sehen ist, geht der Überschuss der Ertragsbilanz im Falle einer realen Aufwertung des Frankens nicht automatisch zurück. Genauso wenig nimmt der Überschuss ohne Weiteres zu, wenn der Franken abgewertet wird. Die Theorie, wonach ein stärkerer realer Franken automatisch zu einem geringeren Ertragsbilanzüberschuss führt, trifft daher empirisch für die Schweiz nicht zu. Woran liegt das? Die Erklärung dafür lässt sich mit der Abbildung 2 veranschaulichen, welche die Handelsbilanz- und Ertragsbilanzsaldi verschiedener Länder abbildet. Vor allem wenn die Handelsbilanz – also der Saldo aus dem Warenverkehr – den Ertragsbilanzüberschuss bestimmt, wäre zu erwarten, dass eine Aufwertung über geringere Exporte und höhere Importe von Waren zu einem kleineren Überschuss führen würde. Diese Ausgangslage ist im Fall der Schweiz nicht gegeben. Im Unterschied zu den meisten anderen Volkswirtschaften macht der Saldo im Schweizer Warenhandel nur einen Bruchteil des hohen Ertragsbilanzüberschusses aus. Dies kontrastiert klar mit anderen Ländern, zum Beispiel China. Dort erklärt der Warenhandel mehr als 80 Prozent des Ertragsbilanzüberschusses. Wenn im Fall der Schweiz nicht die Handelsbilanz die Ertragsbilanz bestimmt, was sind dann die Faktoren, die diesen Überschuss verursachen? Abbildung 3 illustriert, dass der hohe Überschuss der Ertragsbilanz vor allem auf zwei Komponenten zurückzuführen ist: die Kapitaleinkommen und die Dienstleistungen oder kurz Dienste.
Dargestellt sind jeweils die Saldi oder Nettoerträge dieser Komponenten. In anderen Worten: Von den Einkommen, die vom Ausland in die Schweiz fliessen – im konkreten Fall für investiertes Kapital und erbrachte Dienstleistungen –, sind die Einkommen, die ins Ausland fliessen, abgezogen worden. Ein positiver Saldo bedeutet, dass die Einnahmen höher sind als die Ausgaben. Ich werde später im Detail ausführen, dass die Saldi dieser beiden Komponenten kaum vom Wechselkurs beeinflusst werden. Die Kapitaleinkommen der Schweiz und die Überschüsse in der Ertragsbilanz hängen traditionell eng zusammen. Überschüsse sind für die Schweiz historisch betrachtet ein typisches Phänomen. Unsere Ertragsbilanz, ab 1947 offiziell berechnet, weist seit Mitte der 1960er-Jahre praktisch ununterbrochen einen Überschuss aus. Weiter zurückreichende offizielle Zeitreihen gibt es zwar nicht. Doch zeigen inoffizielle Schätzungen der Ertragsbilanz, dass die Bevölkerung in der Schweiz bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr sparte, als sie im Inland investierte. Schon damals wurde also ein Sparüberschuss im Ausland investiert und dadurch der Grundstein zum heute im internationalen Vergleich hohen Auslandsvermögen gesetzt. Diese Sparüberschüsse sind hauptsächlich in Wertpapieren – also Portfolioinvestitionen – und in Produktionsstätten im Ausland, das heisst Direktinvestitionen, angelegt. Somit hat die Schweiz über die Jahre ein hohes Nettovermögen im Ausland aufgebaut, das hauptsächlich von multinationalen Firmen und Pensionskassen gehalten wird.
Wie aus Abbildung 4 ersichtlich wird, sind die Nettoerträge aus Portfolioinvestitionen im Verhältnis zum BIP Jahr für Jahr relativ konstant. Die Veränderung des Nettokapitaleinkommens und damit des Ertragsbilanzüberschusses ist denn auch hauptsächlich auf die Erträge aus Direktinvestitionen zurückzuführen. Diese Komponente hat in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre deutlich zugenommen und zum Anstieg des Ertragsbilanzüberschusses in jener Zeit massgeblich beigetragen. Der Einfluss dieser Kapitalerträge auf den Ertragsbilanzsaldo ist deutlich in Abbildung 5 erkennbar.
Diese jüngere Entwicklung ist nicht zuletzt ein Effekt der Globalisierung. Im Verlauf der 1990er-Jahre haben viele Schweizer Firmen – dazu gehörten praktisch alle hiesigen international tätigen Grossunternehmen – ihre direkten Auslandinvestitionen ausgebaut. Ein solcher Ausbau erfolgt dabei oft dadurch, dass Gewinne der Tochtergesellschaften im Ausland wieder im Ausland reinvestiert werden. Zudem haben auch einige ausländische multinationale Firmen ihren Sitz in die Schweiz verlegt und tätigen ihre Auslandinvestitionen nun von hier aus. Natürlich nehmen umgekehrt auch Ausländer beziehungsweise ausländische Firmen in der Schweiz Direktinvestitionen vor. Diese erreichen aber nicht das Volumen der Schweizer Direktinvestitionen im Ausland. Die Nettoerträge auf Direktinvestitionen bilden daher eine gewichtige Komponente des Ertragsbilanzsaldos.
Wenden wir uns nun den Einnahmen aus Diensten zu. Dort gibt es zwei «Treiber» des Ertragsbilanzüberschusses: erstens die grenzüberschreitenden Finanzdienste und zweitens den Transithandel. Zu den Einnahmen aus grenzüberschreitenden Finanzdiensten muss ich nicht viel ausführen. Die grosse Bedeutung des Finanzsektors für unser Land ist bekannt. Die Einnahmen, die Banken und Versicherungen aus der Schweiz im Geschäft mit ausländischen Kunden erzielen, fliessen in die Ertragsbilanz ein. Bei diesem grenzüberschreitenden Verkehr fallen vor allem die Finanzdienste der Banken ins Gewicht. Wie anhand der Abbildung 6 zu erkennen ist, nehmen diese Nettoerträge seit einem Hoch im Jahr 2007 tendenziell etwas ab. Im Gegenzug sind die Erträge aus dem Transithandel in den letzten zehn Jahren markant angestiegen und liegen seit 2010 höher als diejenigen aus den Finanzdiensten der Banken. Über die letzten fünf Jahre machen sie knapp ein Drittel des Ertragsbilanzüberschusses aus.
Was ist unter Transithandel zu verstehen? Ein Unternehmen im Inland kauft und verkauft Waren im Ausland, ohne die Ware zu verändern. Diese gehandelten Produkte überschreiten dabei nie die Grenze des Landes, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Ein Beispiel: Ein Handelsunternehmen mit Sitz in der Schweiz kauft in Sambia Kupfer und verkauft es nach China. Das Kupfer wird direkt nach China verschifft. Die Waren werden nie Schweizer Boden berühren und werden nicht in der Handelsbilanz erfasst.
Stattdessen wird unter der Position «Transithandel» die Marge aus der Transaktion als Einnahme in der Ertragsbilanz bilanziert. Da die Marge in der Regel positiv ist, resultiert daraus für die Schweiz ein Ertragsbilanzüberschuss. Die Hauptakteure auf diesem Gebiet sind Rohstoffhändler sowie Chemie- und Pharmaunternehmen. Gemessen am Verkaufserlös wird in der Schweiz der grösste Teil des Transithandels mit Rohstoffen betrieben. Daher werden Transithandel und Rohstoffhandel oft als Synonyme verwendet. Der Rohstoffhandel findet traditionell in US-Dollar statt, der Franken spielt keine Rolle. In der Schweiz ist der Transithandel an sich ein traditioneller Zweig des Handels. Seine Ursprünge reichen weit zurück, wie die Geschichte der bekannten schweizerischen Handelshäuser zeigt. Er hat jedoch vor allem seit der Jahrtausendwende einen beträchtlichen Aufschwung erlebt.
Wie ist dieser rasante Anstieg der Einnahmen in den vergangenen Jahren zu erklären? Dazu haben vor allem zwei Faktoren beigetragen: So nahm die Nachfrage nach Rohstoffen in den letzten Jahren massiv zu, was sich in einem entsprechenden Preisanstieg niedergeschlagen hat. Eine expandierende Nachfrage liess auch die Verkaufserlöse aus dem Transithandel ansteigen. Gleichzeitig haben neu zugezogene Unternehmen und die Verlagerung von Transithandelsgeschäften in die Schweiz diese Entwicklung noch verstärkt.
Zum hohen Ertragsbilanzüberschuss tragen also wesentlich die Kapitaleinnahmen sowie die Einnahmen aus grenzüberschreitenden Finanzdiensten der Banken und aus dem Transithandel bei. Es gibt aber noch ein weiteres Element, das von der Grössenordnung her leider nicht zu vernachlässigen ist, nämlich statistische Verzerrungen. Der Schweizer Ertragsbilanzüberschuss wird statistisch überschätzt.
Statistische Verzerrungen
Diese Verzerrungen hängen mit der international üblichen Berechnungsmethode der Erträge aus Direktinvestitionen einerseits und der Erträge auf Portfolioinvestitionen andererseits zusammen. Bei den Erträgen aus Direktinvestitionen werden die gesamten Gewinne der Tochtergesellschaften erfasst – also nicht nur die ausgeschütteten Dividenden. Bei den Portfolioinvestitionen in Aktien werden dagegen nur die ausgeschütteten Dividenden berücksichtigt. Diese Verbuchungsmethode führt in der Schweiz zu einer Überschätzung. Warum ist dies so? Das Auslandvermögen der Schweiz wird zu einem grossen Teil in Form von Direktinvestitionen gehalten. Weil diese Direktinvestitionen hoch sind, fallen darauf auch hohe Gewinne an, die in der Ertragsbilanz als Einnahmen bilanziert werden. Bei den Direktinvestitionen handelt es sich überwiegend um ausländische Tochtergesellschaften von bekannten multinationalen Unternehmen, die an der Schweizer Börse kotiert sind. Die Aktien dieser Firmen befinden sich jedoch zu 60 Prozent in ausländischem Besitz. Im Prinzip müssten deshalb 60 Prozent der Erträge dieser Unternehmen wieder als Ausgabe in der Ertragsbilanz verbucht werden. Dies ist jedoch nur zum Teil der Fall. Dieser ausländische Aktienbesitz gilt nämlich nicht als Direkt-, sondern als Portfolioinvestition, weil er sich im Streubesitz befindet. Bei den Portfolioinvestitionen wird nur der Teil der Kapitaleinnahmen als Ausgabe in der Ertragsbilanz erfasst, der als Dividende tatsächlich vom Unternehmen ausgeschüttet wird. Da üblicherweise nur ein Teil der Gewinne der Unternehmen an die Aktionäre verteilt wird, wirkt sich die unterschiedliche Berechnung auf den Saldo der Ertragsbilanz aus. Aufgrund der besonderen Konstellation der Schweiz – hoher Bestand an Direktinvestitionen im Ausland einerseits, hoher Anteil der ausländischen Aktionäre an inländischen Unternehmen andererseits – ist diese Verzerrung nach oben in keinem anderen Land in diesem Umfang zu finden. In den vergangenen zehn Jahren betrug die Überschätzung im Mittel ein Fünftel des Ertragsbilanzüberschusses. Neben dieser buchhalterischen Problematik ist es ausserdem möglich, dass der Einkaufstourismus in den letzten Jahren nicht vollständig in der Ertragsbilanz erfasst wurde.
Der Schweizer Überschuss und die globalen Ungleichgewichte
Die Kritik an der Schweiz in Bezug auf den Ertragsbilanzüberschuss ist also nicht gerechtfertigt. Der hohe Schweizer Ertragsbilanzüberschuss wird durch spezifische Faktoren verursacht, nämlich das hohe Nettoauslandsvermögen, die besondere Rolle unseres Landes als internationales Finanzzentrum sowie das Transithandelsgeschäft. Zudem wird der Überschuss statistisch überschätzt. Der ausgewiesene Ertragsbilanzüberschuss der Schweiz beruht somit nicht auf einer Fehlentwicklung, die aktiv korrigiert werden müsste. Insbesondere ist der Ertragsbilanzsaldo nicht auf einen zu schwachen Franken zurückzuführen. Denn bei diesen Faktoren, die für den hohen Ertragsbilanzüberschuss der Schweiz verantwortlich sind, spielt der reale handelsgewichtete Wechselkurs des Frankens keine bestimmende Rolle. Der Grund hierfür liegt darin, dass das Kapitaleinkommen auf das Auslandvermögen direkt von der Entwicklung im Ausland bestimmt wird, im Wesentlichen durch die Erträge aus Direktinvestitionen im Ausland. Gleiches gilt für den Transithandel. Die Einnahmen aus dem Transithandel werden von der Nachfrage im Ausland und damit verbunden den Rohstoffpreisen – die in US-Dollar denominiert sind – beeinflusst. Schliesslich hängen auch die Einnahmen der Banken aus grenzüberschreitenden Diensten in hohem Masse von der Entwicklung der – überwiegend in Fremdwährung denominierten – verwalteten Vermögen ab, und damit von den internationalen Finanzmärkten. Der Wechselkurs des Frankens wirkt sich erst bei der Umrechnung der erzielten Einnahmen in Fremdwährungen aus. Bei einer Aufwertung wären die Einnahmen aus Kapitalanlagen, aus dem Transithandel und aus den grenzüberschreitenden Finanzdiensten lediglich nach der Umrechnung in Franken kleiner. Die Einnahmen in Fremdwährung würden aber nicht zurückgehen und der Überschuss der Ertragsbilanz nicht verschwinden.
Der hohe Überschuss in der Ertragsbilanz der Schweiz ist also nicht auf einen schwachen oder zu schwachen Franken zurückzuführen. Eine Wechselkursaufwertung führt in der Schweiz – wie dies die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat – denn auch nicht zwangsläufig zu einer Verringerung der Überschüsse, nicht einmal in der Handelsbilanz. Treiben wir doch die Logik, eine «richtige» Aufwertung bringe den Überschuss zum Verschwinden, auf die Spitze und gehen einmal davon aus, dass sich der Franken extrem aufwerten würde: Ein solcher für die Schweizer Wirtschaft ruinös starker Wechselkurs würde die inländische Produktion massiv beeinträchtigen und die Preisstabilität akut gefährden. Dieser Schock liesse aber auch die Importnachfrage nach ausländischen Konsum-, Investitions- und Vorleistungsgütern einbrechen. Dies hätte auch für das Ausland mehrheitlich negative Auswirkungen.
Ich möchte daher an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es grundsätzlich keine triftige ökonomische Begründung für eine ausgeglichene Ertragsbilanz gibt. Diese Erkenntnis gilt in besonderem Masse auch für die Schweiz: Der hohe Überschuss unseres Landes beruht nicht auf Fehlentwicklungen, sondern auf Faktoren, die durch den Wechselkurs nicht beeinflusst werden können.
Betrachten wir den Ertragsbilanzüberschuss aus der Spar- und Investitionsperspektive, so bedeutet er nichts anderes, als dass ein Land mehr spart, als es investiert. Der Sparüberschuss wird im Ausland angelegt. Angesichts einer alternden Bevölkerung ist es ökonomisch vernünftig, mehr zu sparen, als im Inland investiert wird. Aus dem Blickwinkel der Demografie ist denn auch zu erwarten, dass mit fortschreitender Alterung der Gesellschaft der Sparüberschuss allmählich wieder abnehmen wird. Der hohe Ertragsbilanzüberschuss ist kein geeignetes Mass, den Beitrag der Schweiz zu den globalen Ungleichgewichten zu beurteilen. Vielmehr ist er ein Indikator für die Auslandentwicklung. Dies kann man auch an folgendem Zusammenhang veranschaulichen.





























