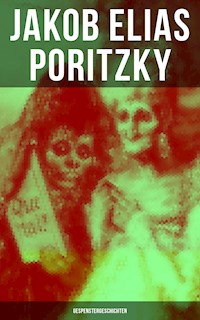Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jakob Elias Poritzky, eigentlich: Isaak Porycki war ein deutscher Schriftsteller und Theater-Regisseur russischer Herkunft. Dieser Band beinhaltet seine Werke "Imago Mundi" und "Geist und Schicksal."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Schriften
Jakob Elias Poritzky
Inhalt:
Jakob Elias Poritzky – Biografie und Bibliografie
Imago Mundi
Vorwort.
I. Die Harmonie der Sphären.
II. Der Begriff der Zivilisation.
III. Der Kreis der Kultur.
IV. Die Notwendigkeit des Luxus.
V. Die Symphonie der Zeit.
VI. Die Vergeistigung des Materialismus.
VII. Die Analyse des Gewissens.
VIII. Die Psychologie des Abenteurers.
IX. Der Zauber der Ferne.
X. Der Wert des Missgeschicks.
XI. Der Dämon der Melancholie.
XII. Das Mysterium der Liebe.
XIII. Die Imponderabilien der Ehe.
XIV. Die Phasen der Moral.
XV. Die Moral der Götter.
Geist und Schicksal
I - Franzosen
Montaigne
Pascal
Jaques Vaucanson
Die französischen Erotiker des achtzehnten Jahrhunderts
Lamettrie
Der Stern Napoleons
Balzac
Sar Péladan
II - Engländer
Ben Johnson
Shaftesbury
Robert Burns
George Meredith
H. G. Wells
III - Niederländer
Hemsterhuis
Hermann Heijermans
IV - Vlamen
Georges Rodenbach
Emile Verhaeren
Felix Timmermans
V - Schicksale
Columbus
Das Volk des Ghetto
I Verbreitung und Zusammensetzung
II. Die Sprache und Literatur der Ghetto Juden
Ein imaginäres Buch
VI - Ausklang
Rechenschaft
Gesammelte Schriften, J. E. Poritzky
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849633318
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Jakob Elias Poritzky – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Regisseur, geboren am 13. Januar 1876 in Łomża (Russland), verstorben am 1. Februar 1935 in Berlin. Sohn eines jüdischen Händlers. Wuchs in Karlsruhe auf, wo er nach der Realschule eine Ausbildung zum Kaufmann begann. Allerdings ist dies nicht sein eigentlicher Lebenstraum. Er reißt immer wieder aus, um Schauspieler zu werden. 1894 Jahren zieht P. nach Berlin, wo er 7 Jahre später auch die Schriftstellerin Helene Orzolkowski heiratete. In den Jahren 1911 bis 1926 arbeitet P. für verschiedene Theater in Berlin, Karlsruhe und wieder Berlin als Regisseur. Dann zieht es ihn als Sprecher zum Radio, wo er von 1926 bis 1932 Kunst- und literaturkritische Sendungen moderierte. Er stirbt an einer Lungenkrankheit.
Wichtige Werke:
Abseits vom Leben. Skizzen aus der Anatomie, 1896.Peter Brohs Geständnis, 1907.Liebesgeschichten, 1912.Gespenstergeschichten, 1913.Über Nacht, 1925.Die unsichtbare Kraft, 1925.Melancholie, 1927.Imago Mundi
Von der Liebe, vom Luxus und von anderen Leidenschaften
Vorwort.
Dieses Buch ist in den Jahren 1910 bis 1912 geschrieben worden. Im Sommer 1914 wurde mit dem Druck begonnen, der durch den Krieg eine jähe Unterbrechung erfuhr, die fast drei Jahre dauerte. Als mir nun die inzwischen vergilbten Korrekturfahnen vorgelegt wurden und ich in das Werk, das längst hinter mir lag und dem ich jetzt kühl wie einem fremden gegenüberstand, mich noch einmal einleben musste, hatte ich die seltsamsten Empfindungen. Mitten in einem vor drei Jahren unvollendet gebliebenen Satz, mitten im Gedankengang musste die Arbeit wieder aufgenommen werden. Das war schon deshalb nicht so einfach, weil auch einzelne Manuskriptteile verloren gegangen waren, die nun aus dem Gedächtnis ergänzt werden mussten.
In der Zwischenzeit von 1914 bis 1917 hat sich meine Anschauung von den Dingen, die ich in dem Buche behandle, nicht geändert. Der Krieg, ein so grosser Augenblicksumwerter er auch ist, hat die Allgemeingültigkeit meiner Darlegungen nicht entkräftet, denn sie gehen von höheren Gesichtspunkten aus, um nicht zu sagen von »ewigen«. Ich bekenne mich zu der Auffassung, dass die Menschen zu allen Zeiten sich gleich bleiben. Deshalb schien es mir nicht notwendig, auch nur eine Silbe zurückzunehmen oder nachträglich etwas zu ändern, wenngleich auch manche Einzelheit durch die raschen Umwälzungen, die der Krieg brachte, sich verändert hat. Denn andererseits fand ich Vieles, was ich in diesem einige Jahre vor dem Kriege entstandenen Buche sage, jetzt erst recht bestätigt.
Was sich geändert hat, ist lediglich mein künstlerisches Verhältnis zu dem Buche. Denn in formaler Hinsicht sind meine Ansprüche inzwischen noch strenger geworden. Die Distanz von 1914 bis 1917 ist auch zu gross und gerade diese drei Jahre waren an Erlebnissen und Erfahrungen von zu einschneidender Bedeutung, als dass ich in Bezug auf meine künstlerischen Anforderungen ohne Wandlung aus diesem katastrophalen Chaos hervorgegangen wäre.
So oft ich noch ein Buch habe erscheinen lassen, ist mir hinterher immer klar geworden, dass ich alles hätte besser und schöner sagen können. Denn je älter man wird, desto anspruchsvoller wird man in Bezug auf die Reife der Früchte, die man seinem Geiste abringt; zugleich wird man je älter, desto bescheidener.
Pfingsten 1917.
J. E. P.
I. Die Harmonie der Sphären.
Nach den Sternen sehnt sich alles.Mohammed
Wenn mich grosse Not bedrängt oder düstere Verzweiflung mich anpackt, wenn eine entsetzliche Verzagtheit meine Denkkraft lähmt oder dumpfer Kleinmut mein ganzes Wesen zu Boden drückt, rettet mich immer der Gedanke an die Unendlichkeit. Ich flüchte dann zu den Sternen. Dorthin, wo die Harmonie des Universums nicht mehr von irdischem Geschehen gestört werden kann, wo der mächtige Akkord der Natur das menschliche Herz beruhigt durch seine überwältigende Erhabenheit, wo das Schauen Gottes uns still zurückführt zu unseren kleinen, ach, so kleinen menschlichen Maassen. Es ist dann wundervoll, an der eigenen Seele zu erfahren, dass Demut dem Menschen so heilsam ist und dass Frömmigkeit ihm so gut ansteht. Es ist keine Andacht, die in die Kirche treibt, oder eine Frömmigkeit, die sich an einen schreckhaften Popanz wendet. Es ist vielmehr, als ob die höchste Instanz unserer Empfindung uns plötzlich in die Knie zwänge und als ob zugleich irgend etwas in uns sanft zu klingen begönne. Und dieses Klingen kann so stark werden, kann so sehr unsere ganze Wesenheit erfüllen, dass es einer göttlichen Kraft gleichkommt, die uns emporträgt zu jenen reinen Sphären, wo das tönende Licht geboren wird und wo man gleichsam die Musik des Weltalls vernimmt.
Und plötzlich fühlt man – und die astronomische Wissenschaft bestärkt uns in diesem Gefühl –, dass unser staubgeborener Körper, in dem die Seele gefangen ist, aus dem gleichen Stoffe ist wie die Sonne, dass er, wie sie, Wärme erzeugt und ausstrahlt, dass das ganze Leben ein unausgesetzter Verbrennungsprozess ist und dass es lächerlich war von den Priestern, uns den Körper verächtlich zu machen. Weil wir aus unbekannter Dunkelheit einen Augenblick zur Sonne emporsteigen, um uns blicken, uns freuen und leiden, die Art unseres Wesens auf andere Wesen übertragen und wieder in unbekannte Dunkelheit zurücksinken, hat man geglaubt, uns in den Rachen der Vergänglichkeit werfen zu können oder gar in das Nichts, das es nicht gibt und nie gegeben hat. Wie unser Geist zur Sonne drängt, weil er sonnenhaft ist und lichtverwandt, ist unser Körper ursprünglich nichts anderes gewesen als kosmischer Staub, der von den Gestirnen zur Erde fiel. Vom Himmel kommen wir und zum Himmel kehren wir zurück.
Im Erforschen des Lichts und im Anschauen der Himmelsräume findet man alle Wesen und Körper, irdische wie himmlische im eigenen Selbst, und indem man sich gleichsam im All verliert, entweicht das schmerzhafte Irren und alles Leiden schwindet. Aller Wünsche, aller Hoffnungen Vergessen strömt aus der Ewigkeit der Gestirne herab. Dem Wissenden wird die Erlösung schon in dieser Welt zuteil, verheissen die Veden; für ihn gibt es keine Welt, keinen Leib, keine Schmerzen, keine Gesetze mehr. Er ist beruhigt, bezähmt, entsagend und gesammelt. Ihn überwindet das Böse nicht, aber er überwindet das Böse. Frei von Leidenschaften und Zweifeln geht er ein in Brahma.
Nicht umsonst hat sich der menschliche Geist schon in den Urzeiten der Erforschung des Lichtes zugewendet, wohl ahnend, dass er durch das Licht zuallererst seine Verwandtschaft mit den Sternen werde erweisen können. Und es wundert uns gar nicht mehr, wenn die Astronomen uns sagen, dass das Licht, das in den entferntesten Regionen des Universums erzeugt wird, dem Lichte nah verwandt ist, dessen Ursachen und Wirkungen wir auf Erden genau studieren können, und dass das Licht, das die Sterne ausstrahlen, dieselben Eigenschaften hat, wie das Licht der Sonne. Es hat eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit, die sich der Mensch unmöglich vorstellen kann. Und wenn man diese Geschwindigkeit zahlenmässig ausdrückt und sagt, dass das Licht in einer Sekunde einen Weg von etwa zweiundvierzigtausend geographischen Meilen zurücklegt, so geschieht das nur, um auf dieser Basis einen Begriff von den ewigen Weiten geben zu können, mit denen wir hier rechnen müssen. Alle diese astronomischen Versuche, mit Hilfe der Mathematik Gott erfassen zu können, haben jedoch etwas Spielerisches und sind gewissermassen nur dazu da, um unserem leicht verwirrbaren Begriffsvermögen kleine Ruhepunkte zu geben. Denn wenn die Astronomie vielleicht auch nicht die einzige Wissenschaft ist, in welcher der menschliche Verstand sich in seiner ganzen Grösse offenbart, sicherlich ist es diejenige Wissenschaft, die den Menschen am besten lehren kann, wie klein er ist. Wenn er in ausgestirnter Nacht seinen Blick dem unendlichen Himmel droben zuwendet, sieht er zahllose ungeheure Welten im Ozean des Raumes schweben und er verliert sich in diesem unvorstellbaren Universum wie ein Infusorium in einem Wassertropfen des Meeres. Sein Denken scheint vollkommen gelähmt und nur das Gefühl vermittelt ihm die Erkenntnis der eigenen Nichtigkeit und Ohnmacht. Die Vorstellung einer Geschwindigkeit von zweiundvierzigtausend Meilen in der Sekunde geht ebensowenig in unseren Verstand ein, wie die zehntausendmal kleinere von vier Meilen in der Sekunde, mit welcher Geschwindigkeit sich zum Beispiel die Erde in ihrem jährlichen Lauf um die Sonne fortbewegt. Aber so unwirklich diese Zahlen auch scheinen, sie sind dennoch Wirklichkeit und besser als jede Sonntagspredigt lehren sie Demut. Allein hier sind wir erst am Anfang dessen, was unserer Fassungskraft zugemutet wird. Halten wir fest, dass das Licht in der Sekunde zweiundvierzigtausend Meilen zurücklegt und gedenken wir nun der Tatsache, dass es Sterne gibt, deren Licht trotz seiner unbegreiflichen Geschwindigkeit Jahrzehnte, Jahrhunderte und selbst Jahrtausende gebraucht, um zu uns herabzugelangen. Es sind nur Wahrscheinlichkeitsschlüsse, die es vermuten lassen, dass zum Beispiel das Licht der Milchstrasse, die ja aus einer unzählbaren Menge kleiner, dicht aneinandergedrängter Sterne zusammengesetzt ist, etwa zweitausend Jahre braucht, um zu uns zu gelangen. Begreift man nun, welch ein unfassbares Wunder das Auge ist, das ohne Instrument noch den Stern zu sehen vermag, dessen Licht einen Weg von vielen Billionen Meilen zurücklegen muss? Denn selbst die Entfernungen der allernächsten Fixsterne betragen schon Billionen von Meilen. Es gibt aber nur etwa zwanzig Sterne, bei denen durch direkte Messung eine so »geringe« Entfernung festgestellt werden konnte; alle übrigen Sterne spotteten unserer feinsten Messwerkzeuge.
Bei dieser Art zu rechnen, würden wir selbstverständlich zu ganz monströsen Zahlungeheuern kommen; die Astronomen rechnen deshalb nach Lichtjahren, worunter sie die Entfernung verstehen, die der Strahl in einem Jahr durchläuft. Das sind, wenn wir uns noch einmal daran erinnern, dass das Licht in einer Sekunde zweiundvierzigtausend Meilen zurücklegt, in einem Jahre 1 1/3 Billionen Meilen. So gerechnet, hat unser Sonnenlicht 8½ Minuten nötig, um bis zu uns zu gelangen; die Sterne erster Grösse brauchen bereits 15½ Lichtjahre, die Sterne zweiter Grösse 28 Lichtjahre. Der Strahl der Sterne sechster Grösse wandert bereits 120 Lichtjahre, bis er zu uns herabkommt. Die Sterne neunter Grösse sind 500 Lichtjahre von uns entfernt, und die letzten Sterne, die die Astronomen gesehen haben, über 3500 Lichtjahre. Alle diese geometrischen Messungen sind selbstverständlich an gesichteten Sternen vorgenommen worden. »Stellen wir uns ein Wesen vor,« – sagt Wilhelm Meyer, der an diesen Zahlen zum Dichter wird – »das sich mit der Schnelligkeit des Gedankens von einem Stern zum anderen schwingen kann und mit vollkommenem Sehvermögen begabt ist. Begibt sich dieses vollkommene Wesen auf einen Stern der ersten Grössenklasse und schaut zu unserer kleinen Erde dort unten in den Tiefen des Weltgebäudes herab, so kommt eben der Lichtstrahl zu ihm empor, welcher die grossen Ereignisse des Kriegsjahres von 1870 dem Weltall verkündete. Napoleon und Bismarck begegnen sich auf der Landstrasse vor Sedan, und alle Einzelheiten der Begegnung sind ihm gegenwärtig, als geschähen sie eben jetzt. Weiter hinschwebend sieht dieses göttliche Wesen auf einem Stern siebenter bis achter Grösse die Schlachten des Dreissigjährigen Krieges gegenwärtig; auf einem Stern neunter Grösse sieht er Gutenberg seine ersten Lettern setzen oder Kolumbus auf San Domingo landen. Von den Sternen der Milchstrasse her sieht er unseren Heiland unter den Menschen wandeln, und auf den letzten Sternen, die wir kennen, erscheinen ihm die Anfänge der ersten menschlichen Kultur in den Kolonien der Pfahlbauer. Alles ist ihm gegenwärtig, die ganze Vergangenheit liegt entschleiert vor ihm, welche das strahlende Licht für alle Ewigkeiten unverlöschbar in die Annalen der Geschichte der Weltsysteme einschreibt.«
Wir können hier haltmachen, ohne dass jedoch die Astronomie hier haltmacht. Denn das Fernrohr des Astronomen vermag den erstaunten Blick in Regionen des Weltalls zu tragen, von denen das Licht eine halbe Million Jahre wandert, um bis zur Erde herabzukommen. Aber hier macht endlich auch die Astronomie halt. Und gesetzt selbst, sie dringt dereinst bis zu Sternen vor, deren Licht eine Million oder mehr Jahre brauchte, um seinen schwachen Schimmer bis zur Erde zu senden, – eines Tages gelangt sie doch einmal an die unübersteigbare Grenze des Messbaren und Berechenbaren. Allein, jenseits dieser Grenze geht es weiter von Unendlichkeit zu Unendlichkeit, immer weiter, ohne Ende weiter; andere Sterne füllen den Raum aus, der ohne Anfang und ohne Ende ist, ewig abgründig wie die Zeit.
Hier bleiben wir stumm und voller Staunen stehen, wie die Kinder, Furcht und Demut im Herzen und zugleich Freude darüber, dass wir eine Sekunde lang durch die Tore blicken durften, die zur Unendlichkeit des Weltalls führen.
Man hat unser Sonnensystem mit allen seinen Planeten und Millionen Kometen, soweit sie durch das Fernrohr sichtbar und zählbar sind, mit den zerstäubten Atomen eines Wassertropfens verglichen – denn nur durch verkleinernde, dem menschlichen Geist angepasste Vergleiche können wir es wagen, von dem mysterium cosmographicum zu sprechen – Atome, die in unbekannten Kreisen einem unbekannten Zentrum im Raume entgegenstürzen, wo ungezählte Millionen von Sonnen zusammenwirkend wieder nur einen Tropfen bilden, in welchem sich die ungeheuren Sonnenatome bewegen müssen. Denn was ist ein ganzes Milchstrassensystem anders, als eine Gruppe von Millionen Sonnen und Sternen! Und auch dieses wiederum bildet nur einen kleinen Teil eines noch höherstehenden Systems, von dem wir Sterblichen keinerlei Zeichen mehr erhalten. Und Abertausende solcher Milchstrassensysteme sind wie ein Tropfen im All. Soweit kann man nur noch theoretisch folgen, denn hier bewegen wir uns bereits im unendlichen Raume und in der unendlichen Zeit.
In diese beiden unvorstellbaren Begriffe vom unendlichen Raume und von der unendlichen Zeit – ich hätte gern einen funkelnagelneuen, bildhafteren Ausdruck für »unendlich« geprägt, einen eindringlicheren und weit tieferen; denn der menschliche Geist empfindet bei diesem abgebrauchten Worte nicht mehr jene mystischen Schauer, die es einst in dem Menschen erwecken musste, der seine göttliche Riesenhaftigkeit zum ersten Male schaute – ich sage: in diese beiden ewigen Begriffe von Raum und Zeit ist Gottes Allmacht eingeschlossen. Und wollen wir eine schwache Ahnung bekommen von den unfassbaren Attributen Gottes, so müssen wir in die Endlichkeit zurückflüchten, in ein kleines Teilchen des beschreibbaren Raumes und der ausdrückbaren Zeit.
Und hier werden wir finden, dass alle diese unfassbar grossen und unfassbar zahlreichen Welten von den gleichen Gesetzen regiert und bewegt werden, wie das geringste Staubatom. Ein und derselbe grosse Gedanke beherrscht das Universum von einer Unendlichkeit zur anderen. Dies ist der erhabene Gedanke, den uns die Forscher geschenkt haben: dass alles sich zu einem Kreise zusammenschliesst und dass Kristalle und Pflanzen und Menschen von demselben einfachen Zahlengesetz beherrscht werden, von demselben Gesetz, dem auch die Sterne unterliegen.
Dass das Licht der Sterne sich genau so fortbewegt wie das künstlich erzeugte Licht auf der Erde, haben alle Untersuchungen der Sterne ergeben. Denn das ist eines der grössten Wunder, dass der Mensch – diese Milbe vor dem Angesichte Gottes – der nicht einmal die Zahlen begreift, die von der Grösse des Universums Kunde geben, es doch verstanden hat, die Sterne zu untersuchen, als hätte er sie in der Hand und von ihnen auszusagen, welche Stoffe sich auf ihnen befinden, welchen Weg sie beschreiben und welche Gesetze ihnen vorgeschrieben sind. Mehr wissen wir freilich nicht. Wir wissen nicht, welche Arbeit die Sterne verrichten, wozu sie diese Arbeit verrichten, und ob das Ganze einen beabsichtigten Zweck hat und welchen. Wir sehen nicht das Innere des Daseins. Genug, dass wir ahnen, aus welchen Elementen die Oberfläche der Sterne zusammengesetzt ist.
Es ist das Spektroskop, das uns verrät, wie die Sterne beschaffen sind. Dank diesem wunderbaren Instrument, diesem unfehlbaren Analytiker des Lichtes, zerlegen wir die Strahlen der Sonne, des Mondes und der fernsten Sterne, wie das Licht der Kerze, die vor uns auf dem Tische steht, in die elementaren Farbennüancen, aus denen sich jeder Strahl zusammensetzt, und erfahren so, welche Substanzen in diesem oder jenem Lichte verbrennen und welche Substanzen dem Lichte fehlen. Denn jede Substanz strahlt in ihrem Verbrennungszustande ein jeweils anders gefärbtes Licht aus. Kupfer brennt grün, Zink brennt blau – ein anderes, leuchtenderes Blau als das des Spiritus –, Eisen brennt weiss usw. Aber die weisse Flamme des Eisens offenbart im Spektrum bereits eine Zusammensetzung von mehreren tausend Farbennüancen, während das Natrium oder Thallium zum Beispiel im Spektrum nur eine Farbe zeigt (Gelb, beziehungsweise Grün). Der Stoff des Lithium spaltet sich im Spektroskop in orangefarbenes und rotes Licht, glühender Wasserstoff in grünblaues, blaues und rotes Licht. Und so weiter. Auf diese Weise hat uns das Spektrum mit unbedingter Sicherheit gezeigt, dass im Umkreis der Sonne mehr als fünfundzwanzig Substanzen verbrennen, die uns als irdische Elemente bekannt sind (Natrium, Eisen, Kalzium, Nickel, Zink, Wasserstoff, Kupfer usw.). Und da die meisten dieser Stoffe erst bei einer ungemein grossen Hitze in Gasform übergehen, schliessen wir daraus, dass jene Substanzen, von denen uns das Sonnenspektrum Kunde gibt, unter dem Einfluss einer unermesslichen Glut beständig in Dampfform erhalten werden. Diese glühenden Metalldämpfe umhüllen in dichten Wolken die Oberfläche der Sonne und bilden ihre Atmosphäre. Dass die Sonne selbst aber die Mutter der Erde und der Planeten ist, wird eben durch diesen chemischen Nachweis, dass Sonne wie Erde aus den gleichen Stoffen bestehen, zur Gewissheit. Aber selbst die fernsten Weltkörper, deren Lichtstrahlen einen jahrhundertelangen Weg bis zur Erde zurücklegen müssen, verraten uns, sobald sie im Spektroskop eingefangen sind, dass ihre Lichtquellen von ganz denselben Stoffen gespeist werden, wie der Strahl der Sonne.
Es gibt allerdings auch Sterne, auf deren Oberfläche Stoffe nachgewiesen wurden, die im Sonnenspektrum fehlen (zum Beispiel beim rötlich strahlenden Aldebaran, auf dem Antimon, Tellur, Quecksilber und Wismut vorkommen, vier schwere Stoffe, schwerer als der schwerste, bis jetzt auf der Sonne wahrgenommene Stoff).
Aber nicht nur das Spektroskop lehrt uns, dass das ganze Universum aus den gleichen chemischen Stoffen aufgebaut ist; die von der Sternenwelt in unseren Erdkreis fallenden kosmischen Stoffe geben uns gewissermassen den handgreiflichen Beweis für die durch das Spektrum beobachtete Tatsache. Denn was sind die Meteoriden anderes als Reste erschaffener und wieder zerstörter Welten? Und diese Meteorsteine, die manchmal schon in Blöcken bis zu fünfundzwanzigtausend Kilogramm Schwere »vom Himmel gefallen« sind, enthalten keinen einzigen Stoff, der unseren Chemikern nicht schon längst bekannt wäre. Reines Eisen, das auf der Erde in ungebundenem Zustande gar nicht vorkommt, ist der hauptsächlichste Stoff, der als reines Element vom Himmel fällt. Es fällt aber nicht nur in Blöcken, sondern auch als Staub herab, oxydiert und färbt die Erde rot. Zuweilen kommt dieser Eisenstaub auch in Hagelkörnern eingeschlossen vom Himmel hernieder oder im Regen; das ist dann der »Blutregen«, von dem die mittelalterlichen Astronomen sprechen, und der so viel abergläubische Vorstellungen hervorgerufen hat. Aber man hat auch schon oft Chrom, Kobalt, Nickel, Chlornatrium und viele andere Stoffe beobachtet, die als kosmischer Staub von den Sternen fielen.
Man muss einmal eine solche Abhandlung wie die über »Die geologische Bedeutung des Herabfallens kosmischer Stoffe auf die Erde« von Nordenskjöld lesen, um von diesen unzähligen beobachteten Fällen zu erfahren, dass die Erde im regsten Wechselverkehr mit den übrigen Gestirnen steht, und dass ein und derselbe schöpferische Gedanke das All beherrscht. Ebenso wie das organische Leben unserer Erde sich nach gleichen Gesetzen aufbaut und entwickelt, ebenso wie Grashalm und Zeder, Milbe und Wal von den gleichen physiologischen Prinzipien beherrscht werden, sind auch alle Welten vermöge dieser chemischen gleichen Beschaffenheit miteinander verwandt.
Dies bedingt weiter eine gleiche Tätigkeit der chemischen Moleküle. Und wenn es nun gewiss ist, dass die chemischen Elemente der Gestirne mit den chemischen Elementen der Erde übereinstimmen, ist es ebenso gewiss, dass auch in den fernsten Sternen ähnliche Reaktionen und Kraftentfaltungen unter den Stoffen stattfinden, wie die, welche wir auf unserer Erde beobachten. Die weitere logische Folgerung drängt die Ueberzeugung auf, dass die im ganzen Universum wirksamen molekularen Kräfte auch auf den Sternen Wesen hervorgebracht haben, die sich nicht erheblich von den irdischen Schöpfungen unterscheiden können.
Die zweite Eigenschaft der Sterne, die man mittels der thermo-elektrischen Säulen positiv festgestellt hat, ist die, dass und wieviel Wärme uns von den Sternen zustrahlt, ein für den Aufbau der Weltwirtschaft höchst wesentlicher Faktor.
Die dritte grösste Naturkraft, die das Universum regiert, ist die Schwerkraft, die jedem Kinde die Frage aufdrängt, warum die Sterne nicht auf die Erde fallen, wenn sie von der Erde angezogen werden, ein Rätsel, das durch die Gegenkraft gelöst wird, die auf die Gestirne einwirkt: die Fliehkraft.
Ein Stein, der zu Boden fällt, beschreibt in seinem Fall eine senkrechte, gerade Linie; aber ein horizontal geschleuderter Stein, oder eine abgeschossene Gewehrkugel etwa, fällt in einem weiten Bogen zur Erde. Dieser Bogen, den die Kugel beschreibt, ist um so horizontaler, je grösser die Kraft war, mit der die Kugel fortgeschleudert wurde. Könnte man diese Schleuderkraft ins Unendliche vergrössern, so würde die über die Erde hingeschleuderte Kugel selbstverständlich niemals zur Erde fallen. Der Bogen, den die geschleuderte Kugel beschriebe, liefe dann mit dem Bogen der kugelförmigen Erdoberfläche parallel, das heisst die Kugel liefe fortwährend um die Erde herum.
Dank diesen genau ergründeten Schwer- und Fliehkraftgesetzen, die eine unbekannte Macht »an allem Anfang« wirksam werden liess, war es möglich, die Bewegungen der Planeten so unfehlbar genau zu bestimmen und auf Jahrhunderte vorauszusagen, dass wir in dieser Beziehung eine vollkommene Gewissheit erlangt haben.
Licht, Wärme und Schwerkraft sind die durch alle Himmelsräume mächtig wirkenden Gesetze, die alle Welten miteinander verbinden. Welchen Stern wir auch beobachten mögen, er ist aus denselben Urstoffen wie die Erde, erzeugt und verliert aus denselben Gründen seine Wärme, bewegt sich nach denselben Prinzipien und ist den gleichen Entwicklungsprozessen, demselben Werden und Vergehen unterworfen, wie die Erde. Ist es dann so phantastisch, anzunehmen, dass auch auf anderen Sternen denkende Wesen ihren Geist bewundernd durch das Weltall schweifen lassen, dass auch dort forschende Blicke das tiefe Geheimnis der Welt zu enträtseln suchen und nicht fassen können, dass die Seele, die in einen erdgebundenen Körper verhaftet ist, und sich bis zu den fernsten Gestirnen aufzuschwingen vermag, vergehen soll, wie der Tau in der Sonne?
Die Erde, fünfviertelmillionenmal kleiner als die Sonne, die uns leuchtet, bedeutet im Universum weniger als ein Sandkorn in der Wüste. Und nur Wenige kennen die Oberfläche dieses Sandkorns. Und diese wenigen Auserwählten kennen diese Oberfläche sehr schlecht. »Auf dem Himmel mögt Ihr ganz gut Bescheid wissen, Herr; hier auf Erden aber seid Ihr ein Narr,« sagte der Kutscher zu Tycho de Brahe. Auf diesem Sandkorn hat der Mensch sich zum Herrn ausgerufen und hat sich Götter und Religionen gebildet, hat die Zivilisation geschaffen, aus der sich die Kultur entwickelte, die wiederum innere und äussere Gesetze und Bedürfnisse zur Folge hatte, Liebe und Luxus, Gewissen und Moral, Glück und Unglück, Freude und Schmerz, – kurz die ganze Stufenfolge der seelischen und geistigen Werte, die den Menschen zuweilen empfinden lassen, dass er ein Teilchen jener göttlichen Kraft ist, die »die unbegreiflich hohen Werke« im ewigen Gange hält.
Verweilen wir einen Augenblick bei diesen menschlichen Eigenschaften und Errungenschaften!
»Untersuchen wir!« pflegte der alte Sokrates zu sagen, wenn die Schüler schon glaubten, hinter die Lösung der letzten Rätsel gekommen zu sein. Ihr Meister liess sie beständig erkennen, dass hinter tausend gelösten Schwierigkeiten sich abertausend neue auftaten, und dass es mit dem menschlichen Geist genau so beschaffen ist, wie mit dem Sternenhimmel, wo hinter Millionen bekannten Sternen noch Abermillionen ihrer Entschleierung harren.
II. Der Begriff der Zivilisation.
Was ist absurder als der Fortschritt, da doch der Mensch, wie die täglichen Tatsachen beweisen, dem Menschen gegenüber sich stets gleich bleibt, d. h. immer im wilden Zustande!Baudelaire
Während ich am Tisch bei der freundlichen Lampe sitze und der Wind draussen vor meinen Fenstern steht, und seine leidvollen Lieder singt, sehe ich im Geiste die moderne Stadt vor mir, die brüllt und tobt wie ein aufgewühltes Meer. Die Strassen gleichen tosenden Schluchten; Bergketten, die aus Häusern bestehen. Auf jeder Seite türmen sich endlose Fassaden auf, architektonische Felsen, fast jeder eine halbe Million wert und mehr, oder gläserne Paläste, von ragenden Steinpfeilern durchbrochen. Darüber erblickt man ein helles, breites Lineal, das den Himmel vorstellt, durchkreuzt von den Linien der Telegraphendrähte und der elektrischen Bahn. Man kann mondelang zwischen diesen beängstigenden Schluchten umherwandern und wird in immer neue Strassentäler gelangen. Wenn ich meinen Freund besuchen will, der in derselben Stadt wohnt, was höchstens einmal im Monat sein kann, da es zuviel Zeit in Anspruch nimmt, trete ich eine richtige Reise an, fahre von Bezirk zu Bezirk und komme durch Stadtteile mit grundverschiedenen Physiognomien, als reiste ich durch zehn fremde Städte. Eng berühren sich hier Vergangenheit und Zukunft. Da gibt es Gegenden, einsam wie Mönchsklöster, wahre Trauminseln; abgeschlossene Provinzen; lachende Gärten, in denen Schwäne wie weisse Gondeln sanft hinziehen; Gassen voller Melancholie und Kraftlosigkeit; dem Untergang geweihte Stätten des Zerfalls und des ewigen Schlafs, und Viertel, in denen man die fiebernden Nerven des modernen Lebens zucken sieht. Antäus, der durch die Berührung mit der Erde neue Kräfte gewann, würde hier rasch besiegt werden, denn nirgends tritt der Fuss unmittelbar auf die Erde, sondern auf Asphalt, Zement, Holz oder Steinblöcke. Würde man diese steinernen Pfade aufreissen, so würde man wieder eine neue, unterirdische Welt erblicken: ein System von Leitungen und Röhren für Wasser, Beleuchtung, Dampf, Kanalisation, Elektrizität, Telephon, Telegraph, Eisenbahn. Darüber hinweg braust ein dröhnender Lärm. Das Getrappel der Hufe, das Gepolter der Räder, das Geknatter der Automobile, der Donner der Bahnen hallt ununterbrochen fort. Nur der Assimilierte findet sich in diesem Chaos zurecht; der Neuling erschrickt, als wäre er in eine Panik geraten.
Und doch wird alles beherrscht und regiert durch die Ordnung. Jahrhunderte haben dieses System der verblüffenden Ordnung errichten helfen, und nun läuft das Ganze von allein, als ob es eine einzige eiserne Hand durch das Chaos lenkte. All das Ungeheure hat den Charakter der Härte und Unerbittlichkeit. Es ist die gigantische, mathematische Kraft, umgesetzt in Nützlichkeitswerte. Diese kolossalen Anhäufungen von Bankpalästen, Warenhäusern, Geschäften, Mietkasernen sind nicht schön, sondern angsterregend. Es spricht daraus eine mitleidslose Kraft, die unheimlich wirkt. Obwohl diese Berge ineinandergewachsen sind, die Menschen, die darin wohnen, sind es nicht. Kein Gemeingefühl verbindet diese Nachbarn. Sie begegnen sich mit Kälte und Interesselosigkeit ...
Wenn es dunkel wird und die hunderttausend Laternen und Lampen der Strassen und Geschäfte in allen Lichtnüancen erstrahlen; wenn an den Dachgiebeln und an den Häuserfronten der grellen Hauptstrassen die elektrischen Glühlampen der Reklame zu funkeln beginnen und zu tanzen; glitzernde Buchstaben die Fassaden auf- und niederstürzen, die im Nu blenden und im Nu wieder im Nichts verschwinden; die das Auge locken und täuschen; wenn das Leben gesättigt ist von gespannter Lebenslust und ein jeder bereit ist, einen Teil seiner Nervenkraft zu opfern, dann erst sieht man die moderne Grosstadt; diese Stadt, die einem Tiere gleicht, das daliegt und Menschen frisst; die voll Glanz ist und voll Finsternis, voller Laster und Verbrechen; eine Stadt der Arbeit und des Vergnügens, des Ehrgeizes und des wahnsinnigen Kampfes um Existenz, Namen, Ruhm und Glück.
Der Menschenstrom wälzt sich durch die Strassen ... Kontoristinnen, Verkäuferinnen, Modistinnen, Kaufleute aus aller Welt, Nichtstuer, Kokotten, bald elegant, bald bescheiden gekleidete Vergnügungssüchtige, kokette Frauen mit ungewöhnlich starken Parfüms begossen, hübsche Mädchen mit Blumen an der Brust. Die Männer verfolgen die Frauen, Blicke fliegen herüber und hinüber, mehr oder minder freche Augen sieht man, zudringliche und zurückhaltende, gemeine und gelangweilte, genusssüchtige und blasierte Gesichter. Bekanntschaften werden geschlossen, die nur ein paar Stunden dauern. Das Leben sieht aus, als sei es leicht, graziös, licht und lustig. Alle wollen Glück und Freude, und viele ernten Schmerz und Tränen. Was macht's? Das Leben ist düster und langweilig, die Arbeit ermüdend, – schaffen wir uns Lustspiele, und weichen wir den Dramen aus und den Tränen der Tragödie.
Die Strassen leben ... Alles lächelt, lärmt, trällert, eilt, triumphiert. Die hellerleuchteten Cafés sind weit geöffnet. Man hört sentimentale Geigen schmelzend tönen. Sie locken. Die kleinen Marmortische sind besetzt. Zwischen den Tischen irren mit müden, oft reizenden Gesichtern blasse Mädchen hin und her, mit sonderbaren Hüten auf dem Kopf. Tausend verschiedene Laute fliessen in einen Akkord zusammen. In den Theatern, in der Operette, in den Tanzsälen und in den Bars spielt sich wieder ein anderes, eigenes Leben ab; dort herrscht offen das schöne, elegante Laster; dort regieren fürstliche Hetären mit reizenden Frisuren, eleganten Füssen und Toiletten, die ein Vermögen kosten.
Aber schwatzende, zechende, singende Männer, tanzende, girrende Weiber, wilddurchwogte Strassen, Automobile, galoppierende Pferde, Restaurants, Theater, Bars – das alles ist nicht das Leben; es ist nur der Lärm des Lebens.
In diesem Chaos von Macht und Glück, von Elend und Laster, das man Zivilisation nennt, in diesen Häusern, die bald von prunkender Pracht strotzen und bald von monumentaler Schäbigkeit, in dieser Luft, die erfüllt ist von den ausserordentlichsten Kontrasten der Not und der Lust, lernt der einzelne seine Unbedeutenheit und Entbehrlichkeit doppelt stark erkennen. Jeder fühlt, je nach dem Grade seiner Isoliertheit oder Brauchbarkeit, dass das grausame und jubelnde Leben, das unbarmherzige und öde, das qualvolle und liebegebärende Leben, dass das sieghafte Leben vorwärts will, und hinwegschreitet über alles Schwache und Hilflose.
Wer dies Leben kennt, begreift die vage Unruhe des Vereinsamten, unbeachtet zu sein inmitten von einigen Millionen hastender Menschen; nicht gehört zu werden in dem betäubenden Getöse des Verkehrs; elend zu bleiben, angesichts der überwältigenden Anhäufungen von Reichtümern, die Kopf und Hand zwingen, ihr Arbeitsvermögen bis zur äussersten Grenze auszunützen.
Wer dies Leben kennt, weiss aber auch, dass die Gefahren der Wildnis und des Meeres nichts bedeuten, neben den täglichen Choks und Konflikten der Zivilisation, die nur wie ein dünner Firnis über unserer Bösartigkeit liegt.
Diese Zivilisation hat uns die drahtlose Telegraphie gegeben, die synthetische Chemie, das Radium, die Antitoxine, den Panamakanal, das Telephon und das Luftschiff; sie hat den Himmel erforscht und die Sterne, hat das Sonnenlicht in seine Teile zerlegt, hat Raum und Zeit überwunden, hat die Vergangenheit belebt, hat die Naturkräfte und die Menschen gebändigt, hat der Erde alle Geheimnisse abgerungen, hat alles entschleiert, alles sichtbar gemacht, alles geordnet und es sich untergeordnet, hat so viel Wissensgebiete systematisiert, als Welten und Himmel sind, hat Gesetze gegeben, unsere Gefühle aufgedeckt und ihre erstaunliche Mannigfaltigkeit gezeigt, die so reich ist, wie der Sand am Meeresufer. Diese Zivilisation hat den edelsten Menschentyp entwickelt und den abstossendsten; hat die sublimsten Empfindungen in uns geweckt und die zartesten Sympathien, wie sie keine andere Zeit hatte.
Aber der Gesellschaftsorganismus ist durch diesen ratlosen Fortschritt so kompliziert geworden, dass – und dies ist ein Gesetz! – seine Verwundbarkeit immer grösser geworden ist. Der Energieverbrauch ist ein rascherer, und im gleichen Verhältnis sind Sensibilität und Nervosität gewachsen. Wenn in China die Pest ausbricht, oder in Russland eine Hungersnot, so kann diese momentane Unterbindung der Handelsadern in den fernsten Ländern Stauungen herbeiführen, die alle Teile des ganzen menschlichen Erdgefüges in Mitleidenschaft ziehen. Wenn in Texas Regenwetter ist, werden die Hemden des deutschen Arbeiters kostspieliger, denn vom Wetter hängt die Baumwollernte ab, und Dürre und Nässe diktieren die Preise des Marktes. Wenn einige auf ihren Vorteil bedachte Leute es Amerika verbieten, uns Fleisch zu liefern, müssen mehrere Millionen Menschen ihre Lebensweise ändern und einschränken. Hand in Hand mit dem Steigen der Brot- und Fleischpreise wächst selbstverständlich die Zahl der Verbrechen. Kurz, die Vernichtung des kleinsten Vorratszentrums, die Erschöpfung einer Mine, der leiseste Druck auf einen industriellen Nerv zeigen erst, wie fein das Rädergetriebe der menschlichen Gesellschaft ineinandergreift.
Wenn hinten weit in der Türkei Die Völker aufeinanderschlagen,
so kann der moderne Mensch nicht mehr von gesegneten Fried- und Friedenszeiten sprechen; selbst der Krieg des fernsten Landes hat Folgen für jedes Individuum. Denn die ganze Menschheit ist ein einziger Organismus, und die geringste Stockung wirft alles aus dem gewohnten Gang. Wie ein Riesendynamo, das durch einen kleinen Hebel in und ausser Betrieb gesetzt werden kann und eine wunderbare Gefügigkeit zeigt, so ist die ganze Menschheit durch einen kleinen Druck zum Stillstand zu bringen.
Dies alles schliesst nicht aus, dass unsere Zivilisation zugleich das Individuum mehr und mehr entwickelt hat; aber diese Entwicklung des Einzelnen hat etwas Ueberhitztes, Falsches; als hätte nicht die Sonne, sondern künstliche Wärme ihn wachsen lassen; als sei seine Ernährung keine natürliche, sondern eine chemische gewesen.
Denn im gleichen Verhältnis zum Wachstum der Zivilisation vertieft sich der Schmerz über das, wessen der Mensch verlustig geht.
Als die Zivilisation unsere Sitten noch nicht verfeinert, und unsere Leidenschaften noch nicht gelehrt hatte, eine gekünstelte Sprache zu reden, waren wir, wenn auch nicht besser, so doch natürlicher und sicherer; man verbarg sich nicht hinter konventionellen Masken, die das Antlitz einer trügerischen Einförmigkeit, Niedrigkeit und Leere bedecken. Der zivilisierte Mensch hat auf Kosten der Aufrichtigkeit die Gebote der Höflichkeit, Schicklichkeit und Konvention zu befolgen, aber die Gebote der eigenen Natur ist er gezwungen zu unterdrücken. Er darf nicht wagen zu scheinen, was er ist. Er sei, was er will, nur nicht er selbst. Daher wird er auch nie wissen, mit wem er es eigentlich zu tun hat, denn Argwohn, Misstrauen, Kälte, Hass, Verrat und Verachtung werden ihm immer nur im Kleide der Höflichkeit begegnen. Man wird ihn mit Feinheit verleumden und mit einem beredten Augenzwinkern töten. Wenn er gestohlen hat, wird man ihn, ist er arm, als Dieb bestrafen; ist er reich, oft als Kleptomanen glanzvoll freisprechen. Er muss den Grossen den Hof machen, die er hasst; muss die Reichen hofieren, die er verachtet. Er wird alles tun, um ihnen zu dienen; er wird sich hochmütig seiner Niedrigkeit rühmen und ihrer Protektion, und stolz auf seinen Servilismus, wird er mit Verachtung von denen sprechen, die nicht die Ehre haben, ihn zu teilen.
Der Umfang unserer inneren Verlogenheit und Verderbtheit entspricht im umgekehrten Verhältnis genau der Vervollkommnung der Wissenschaften und Künste. Jedes Zeitungsblatt, das man durchfliegt, enthält dicht nebeneinander Grossprechereien von Rechtschaffenheit, Güte, Nächstenliebe und Versicherungen bezüglich der Zivilisation und zugleich Meldungen von Kriegen, Diebstählen, und Morden, Schamlosigkeiten, Martern, Verbrechen der Fürsten, der Nationen und der Einzelnen.
Der Mensch bleibt sich ewig gleich; bleibt ewig ein Raubtier, das auf Beute ausgeht, und das spioniert, Fallen legt, überlistet und Qual zufügt – mit dem Unterschiede, dass das Raubtier aufrichtiger ist. Die Wilden kennen die Lüge nicht, sie kennen nur die List. Und wenn ein König sich einmal ruhig die Wahrheit sagen liess, war es sicher ein Barbar (Thoas in »Iphigenie«).
Die Zivilisation ist freilich etwas Wunderbares; aber ihre medusenhafte Kehrseite hat keiner in ihrer ganzen Grausenhaftigkeit besser gesehen, als Rousseau. Ich sage nicht mit Rousseau, dass wir, um zu gesunden, wieder in die Wälder flüchten sollen, oder wie Tolstoi, dass wir zum Pfluge und zur Axt greifen müssen. Aber wenn man sieht, dass Pluto der höchste Gott ist, und dass dieser satanische Gott des Goldes alle ideellen Bestrebungen unterdrückt, dass er alles zermalmt und der Lächerlichkeit preisgibt, was ihn nicht anbetet, so weiss ich nicht mehr, was das Leben lebenswert macht. Denn nur um mich und die Meinen zu kleiden und zu füttern, um mit fünfzig Jahren einen Schmerbauch zur Schau zu tragen, würde ich das Leben nicht einen Tag zu leben vermögen. Dann wäre die Welt nichts als ein Riesenviehstall, nichts als ein kolossales Arbeitshaus mit ungeheuren Kochherden und Esstischen, und dann bedurfte es wahrlich keines Gottes, der uns die Portionen zuteilte. Dann sollte man wenigstens konsequent sein und von Gesetzes wegen alle diejenigen aufhängen, die weder ein Vermögen zu erben haben, noch sich auf Gelderwerb verstehen.
Einige Philosophen haben auch ohne Scheu die Ueberzeugung ausgesprochen, dass wir noch Thor und Odin anbeten, nur mit dem Unterschiede, dass Odin ein Mathematiker geworden ist, und dass jetzt der Hammer Thors mit Dampf und Elektrizität arbeitet. Und darum lebt in manchen, die auf dem Gipfel der Zivilisation stehen, der Wunsch, und in vielen lauert die fortwährende Angst, durch ein nicht vorauszusehendes soziales Erdbeben könne der ganze Bau der Zivilisation frühzeitig zerstört werden. Denn darüber herrscht ja wohl kein Zweifel: dass der Mensch, der Bildner und Schöpfer Gottes, der Mensch, dieses vollkommene Wesen, der Beherrscher der Natur, der Bändiger der Elemente, in seinen Wünschen so grenzenlos, so mächtig durch sein Denken, so energisch durch seinen Willen, nur wenige Augenblicke lebt und von den plumpesten Zufällen abhängig ist; dass er der Erde nur gezeigt wird, deren Herr und Gebieter er sich dünkt, um einen Augenblick ihren Staub zu betreten und im nächsten Moment den seinigen mit ihm zu vermischen; es herrscht kein Zweifel darüber – sage ich –, dass dieser Bau der Zivilisation zusammenstürzen wird. Einen so fiebrigen, in jeder Beziehung ungesunden und übertriebenen Zustand hält der gesellschaftliche Körper nicht auf die Dauer aus.
Ich spreche nicht von den Resultaten der Arbeit. Diese werden wahrscheinlich erst dann zunichte werden, wenn der Mensch seine unbedeutende Rolle auf diesem Planeten ausgespielt haben wird. Und das mag immerhin noch eine Weile dauern.
Was die Zivilisation zu etwas ganz Schändlichem macht, das ist die durch sie heraufgerufene Amerikanisierung des Gehirns und die vollständige Entwürdigung der Seele. Denn man kann Zivilisation haben, ohne Kultur zu haben. Man verzichtet wohl darauf, dass ich Beispiele anführe. Es scheint, als ob die Welt zu dem einzigen Zweck da wäre, damit wir eine materielle Existenz führen können. Aber der Mensch ist keineswegs um des Wohllebens willen geboren, sondern um mit seinen geistigen und seelischen Kräften der Menschheit zu dienen. Man hat mich schon oft gefragt, was ich mir eigentlich unter der »Menschheit« denke. Ich verstehe darunter: das Zusammenwirken aller Individuen zu einer Leistungsfähigkeit, die der Einzelne schwerlich erreicht, und die Allen zugute kommt.
Und unter Zivilisation verstehe ich die Tendenz im Menschen, sich hinauf zu entwickeln. Wenn ein Volk Kleidung, Eisen, Bücher, Ehe, Kunst und Handel hat, so ist es noch lange nicht zivilisiert. Der Begriff umfasst vielmehr die bewusste Ausbeutung und Aneignung der gesamten fortschrittlichen Leistungen, die der menschliche Geist auf allen Gebieten zu verzeichnen hat. Wenn es zum Beispiel ein Land gäbe, wo Wissen nicht verbreitet werden könnte, ohne dass es ein Minister billigte; wo es Gesetze gäbe, die für die verschiedenen Gesellschaftsklassen verschieden ausgelegt würden; wo das Wort nicht frei wäre; wo die Verfassung täglich gebrochen oder umgangen würde; wo die Freiheit in der ursprünglichen Einrichtung des gesellschaftlichen Lebens angegriffen würde; wo die Stellung der Frau beeinträchtigt würde; wo die Künste von der Laune der Zensoren und Amtsanwälte abhingen; wo der Arbeiter um das Erträgnis seiner Hände betrogen werden könnte; wo das Stimmrecht nicht frei oder nicht gleich wäre; wo man dem Menschen, der im Affekt getötet hat, im Namen des Königs den Kopf abhacken würde – wenn es ein solches Land gäbe, wäre es in allen diesen Hinsichten nicht zivilisiert, sondern barbarisch, und es hätte, um Kultur zu besitzen, noch einen recht weiten Weg.
III. Der Kreis der Kultur.
Mit der sogenannten Kultur sieht es recht elend aus.Multatuli
Weil der Begriff der Zivilisation die weitesten graduellen Unterschiede zulässt, weil etwa ein wilder Volksstamm, der keine Menschen mehr frisst und der bereits das Gewehr zu handhaben weiss, schon »zivilisiert« ist im Vergleich mit anthropophagischen Stämmen, die nur den Giftpfeil kennen, so muss man sich nicht besonders viel darauf zugute tun, wenn man nur Zivilisation besitzt. Selbst den höchsten Grad von Zivilisation haben, heisst noch nicht Kultur haben.
Dass wir mit Messer und Gabel essen, danken wir der Zivilisation; aber erst wenn wir manierlich essen, haben wir Kultur. Dass man Takt haben müsse, kann man wohl lehren; aber dass man dann auch taktvoll sei, steht noch dahin. Kultur ist also ein Empfindungszustand, etwas weder Erlernbares noch Lehrbares; es ist ein veredelter, gepflegter Instinkt, der einen mit derselben Kraft abhält etwas Hässliches oder Unschönes zu begehen, mit der das Tier abgehalten wird, seiner Art untreu zu werden. Kultur ist nicht die »segensreiche«, deren »Fahne« von einer bestimmten Menschengruppe bei festlichen Gelegenheiten immer »hochgehalten« wird. Sie – die Kultur – ist auch nicht daran erkennbar, dass sie in allen Büchern und offiziellen Reden hochgepriesen und zu Hause und inoffiziell missachtet und ignoriert wird. Sie ist auch nicht jene, die anwendbar ist auf seelische Zustände, auf staatliche und bürgerliche Einrichtungen, auf Kunst ebensowohl wie auf Kartoffeln, Bazillen und so weiter.
Kultur ist etwas, wovon eigentlich niemand kurz und bestimmt sagen kann, was es ist. Der bloss Zivilisierte hat seine Zivilisation, aber keine Kultur. Der Snob, der Kulturträger zu sein glaubt, hat nur seinen Snobismus. Der Gelehrte kann ein grosses Wissen haben und kann von Kultur sehr weit entfernt sein. Der Künstler kann ein Genie und dabei ein Flegel sein. Ich glaube auch nicht, dass Goethe die verheirateten Philister im Auge hatte, als er sagte, die Ehe sei der Gipfel aller Kultur.
Andere sind geneigt, unter Kultur eine Verfeinerung der Sitten und Gebräuche, Anschauungen und Gewohnheiten zu verstehen. Wieder andere definieren sie als das Alter einer Nation – darum spricht man immer nur von der Zivilisation der Amerikaner, aber von der Kultur der Griechen –; andere verstehen unter Kultur eine hohe Stufe der Selbsterziehung; andere: Selbstbeherrschung in jeder Situation, und noch andere – Oskar Wilde etwa – geben nur dem Volke Kultur, das die Lüge zur höchsten Entwicklung gebracht hat.
Aber es ist leicht nachzuweisen, dass alle diese Erklärungen unzulänglich sind.
Wenn beispielsweise die Lüge ein Gradmesser der Kultur wäre, stünden wir zweifellos auf einer sehr hohen Kulturstufe. Denn wir leben in einer Verlogenheit und in einer Ideenverwirrung, die kaum noch einer Steigerung fähig ist und die ungeheuerlich wäre, wenn überhaupt die Möglichkeit bestünde, ein Leben in Wahrheit und Ideenklarheit führen zu können.
Sich auszubreiten und zu vermehren, wird immer das erste Gebot der Rassen und Individuen bleiben; die Bibel hat sogar ein göttliches Gebot daraus gemacht und der Staat würde sich selber entkräften, wenn er nicht ebenfalls auf dessen Erfüllung beharrte; andrerseits untergräbt er aber durch systematische Verteuerung der Lebenshaltung den zeugungslustigen und zeugungsfähigen Individuen die Möglichkeit hierzu und nimmt ihnen durch einen unerträglichen Steuerdruck die Lust dazu. Man predigt humane Ideen und entwickelt gleichzeitig den Völkerhass und den Krieg. Man propagiert den Weltfrieden, preist den Altruismus, die Gleichheit und Freiheit und kann das alles nur erreichen, indem man fortgesetzt seine Nachbarn bedroht und tieferstehende Völkerschaften beraubt und ausbeutet. Man hat die Sklaverei verpönt, aber man schämt sich nicht, die Naturvölker zu unterwerfen, zu vertreiben, auszurotten oder im besten Falle sie für sich frönen zu lassen. Der Ertrag der eigenen Felder reicht nicht mehr hin, die europäischen Menschen und Haustiere zu ernähren; wir nehmen also schwächeren Völkern einfach ihre Erträgnisse an Kaffee, Tee, Kakao, Tabak, Zucker, Reis, Mais, Baumwolle, Getreide usw. fort. Europa beherrscht den Weltmarkt nicht mit Mitteln der Kultur, sondern mit zivilisatorischen; nämlich mit Kanonen, Dynamit, Maschinen und Panzerschiffen. Wir protestieren öfters im Namen der Völkerrechte und der Nächstenliebe und verstehen darunter die Liebe zu uns selbst. Parasitenhaft vermehren wir uns auf Kosten anderer Rassen.
Wenn die Statistik herausgefunden hat, dass wir am Schluss eines Jahrhunderts doppelt soviel Menschen wie am Anfang beherbergen und ernähren, dass wir Städte gebaut haben, Flotten und Eisenbahnen, so fragen wir nicht, ob es auf ehrliche Weise möglich war, sondern freuen uns, dass es so ist. Aber wir wissen, dass wir uns bei gleicher wachsender Bevölkerungsziffer gegenseitig ermordet hätten, wenn wir uns vom eigenen Boden und aus eigenen Mitteln hätten ernähren müssen; wissen, dass wir nur kraft des Goldes schwächerer Rassen und dank der Nahrungsmittel, die fremde Erdteile hervorgebracht, emporgewachsen sind, und dass wir immer Steine für Brot gegeben haben.
Zugleich treten wir als Beschützer der tieferstehenden Völker auf, ähnlich wie wir das Getier des Waldes schützen, damit es Zeit habe, sich von unseren Morden zu erholen, sich aufs neue fortzupflanzen, um von neuem gemordet werden zu können. Denn die völlige Ausrottung der schwächeren Völker und jagdbaren Tiere hätte ökonomische Verluste für uns im Gefolge. Wir nehmen den Naturvölkern ihre Güter und ihre Freiheit, ihre Arbeit und ihr Leben, ihre Sitten und ihre Götter und geben ihnen dafür Schnaps, Ketten und das Christentum, dem in Europa kein Mensch mehr nachlebt. Man predigt in einem Atem Selbstbeherrschung und Rücksichtslosigkeit, Selbstbegrenzung und Expansionsgier, Pflichtgefühl und Tyrannei, Vaterlandsliebe und Feindschaft, Mut und Unterdrückung, Männlichkeit und Unehrlichkeit.
Selbst jetzt noch glauben Millionen gedankenloser Menschen des Abendlandes an irgendeinen göttlichen Zusammenhang zwischen der Militärmacht und dem christlichen Glauben, und selbst von den Kanzeln wird göttliche Rechtfertigung für politische Raubzüge verkündet und Erfindungen von Explosivgeschossen werden auf göttliche Inspiration zurückgeführt. In vielen Ländern ist der Aberglaube nicht auszurotten, dass die Rassen, die sich zum Christentum bekennen, von der Vorsehung ausersehen worden seien, andersgläubige Rassen zu berauben und zu vernichten.
Und trotz des scheinbaren Reichtums und Fortschritts gibt es das eine nirgends, das allein für all die tausend Verbrechen, die man im Namen der Kultur begeht, eine Entschuldigung sein könnte: Lebensfreude. Trotz der glänzenden ökonomischen Systeme erweisen sich alle geraubten Werte als Truggold. Die Reichtümer werden scheinbar in einem Danaidenfass gesammelt, denn je mehr die »segensreiche Kultur« fortschreitet, desto hoffnungsloser und freudloser wird der Mensch, und desto unfruchtbarer wird das Symbol des Geldes.
Was mich betrifft, ich habe Kultur niemals dort gefunden, wo man so viel von ihr sprach. Ich neige überhaupt zu der Annahme, dass die breite Masse niemals Kultur haben wird, ohne behaupten zu wollen, dass dies ein grosses Uebel sei. Jedenfalls, das, was ich unter Kultur verstehe, habe ich in der Geschichte und in der Gegenwart immer nur selten und nur bei Einzelnen gefunden, dort, wo ich es weder erwartete, noch wo man wusste, dass man Kultur habe.
Die Geschichte lehrt, erstens: dass alle Kultur stets ihren Niedergang findet, sobald der kleine Kreis, auf den die Kultur naturgemäss immer beschränkt ist, nach einer gewissen Zeit in seiner Abgeschlossenheit gestört wird und endlich in grösseren Kreisen, die einer weit niederen Kulturstufe angehören, aufgehen muss. Die Gemeinschaft, mit deren Interessen der Einzelne verwächst, schliesst sich nach aussen mit allen egoistischen Mitteln ab und fördert ihren Sturz durch das gleiche Absonderungsprinzip derjenigen Kreise, denen sie die höhere Kultur verdankt.
Sodann: die Unterschiede, die sich innerhalb der fortschreitenden Gesellschaft entwickeln, werden allmählich immer grösser, die Berührungspunkte geringer und die wichtigste Quelle der verbindenden Sympathie versiegt. Innerhalb der Masse, die ursprünglich von gleicher Art war, bilden sich alsbald bevorzugte Klassen aus, die keinen rechten Zusammenhang unter sich finden. Die Anhäufung von Reichtümern führt zu neuen Genüssen und es entsteht ein Egoismus von hoher Raffiniertheit. Die Bevölkerung mehrt sich, folglich entsteht Mangel an Boden – wie zum Beispiel im alten Rom zur Zeit der Latifundien, wo die Parkanlagen der Reichen den Ackerbau des Volkes verdrängten und halbe Provinzen im Besitz einzelner Begüterter waren, – die Bodenrente steigt, der Arbeitslohn sinkt. Die Unterschiede zwischen Besitzer und Pächter, Pächter und Arbeiter werden immer grösser. Die Industrie blüht auf und bietet dem Arbeiter höheren Lohn. Bald herrscht auch hier Ueberfüllung und der Arbeitslohn sinkt wieder. Die entstehende Not hemmt die weitere Vermehrung der Bevölkerung und man sucht Rettung vor dem Elend in Arbeiten, die man um jeden Preis annimmt. Die Folge ist steigender Reichtum des Unternehmers, der dem Arbeiter gerade so viel gibt, dass er sein Dasein kümmerlich hinfristen kann. Das Elend des Proletariats erweckt wohl Teilnahme, aber wie soll der Reiche nun zurückfinden zu der alten Einfachheit? Denn inzwischen hat er sich an eine verfeinerte Lebenshaltung gewöhnt. Kunst und Wissenschaft haben sich entfaltet. Die Sklavenarbeit der Proletarier hat vielen Köpfen Musse und Mittel zu Forschungen, Erfindungen und künstlerischen Schöpfungen verschafft. Es gilt, diese höchsten Güter der Menschheit zu wahren und man tröstet sich, dass sie im unbestimmten »Einst« Gemeingut Aller sein werden. Inzwischen geniessen viele, deren Gemüt roh und unempfänglich ist, dank ihres Reichtums die Vorteile der Kunst und Wissenschaft; andere arten in moralischer Beziehung aus und bekunden für nichts Interesse, was ausserhalb ihres Genusskreises liegt. Starke Sympathien mit den Leidenden schwinden durch das gleichförmige Wohlleben der Begüterten. Diese halten sich bald für besondere Wesen, betrachten ihre Diener als Maschinen und die Elenden als eine dekorative Staffage, die Gott eigens zu dem Zwecke gemacht hat, um den Begüterten den Besitz des Reichtums erst recht wertvoll erscheinen zu lassen. Das sittliche Band, das alle Menschen verknüpft, ist zerrissen; die Scham, die früher von allzu grosser Ueppigkeit zurückhielt, stirbt; der Geist erstickt im Wohlleben; das Proletariat allein bleibt roh, aber empfänglich und geistesfrisch.
Bekannte moderne Zustände?
Nein. So war die antike Welt, als das Christentum ihrer Herrlichkeit ein Ende machte.
Was die Menschen der Gegenwart betrifft, so leiden sie nicht mehr an der Genusssucht, sondern an der Arbeitssucht. Der Zweck des Lebens, ja, der Sinn des Daseins ist vollständig in sein Gegenteil verkehrt. Die durch den wahnwitzigsten Erwerb zusammengerafften Mittel werden nicht für den Genuss des Lebens verwendet, sondern um den Erwerb selbst noch umfangreicher, noch hetzender zu gestalten. Die Menschen treiben längst keine Geschäfte mehr, sondern längst treiben die Geschäfte die Menschen. Die antiken Religionen bezweckten wenigstens eine glückliche Entwicklung der physischen Lust; wir aber haben angeblich die Seele und die Hoffnung entwickelt. Heute haben die Ueberfüllung des menschlichen Kopfes, die Menge und der Widerspruch der Lehren, die Uebertriebenheit des Gehirnlebens, die sesshaften Gewohnheiten, die künstliche Verfassung und fiebrige Ueberreiztheit der Grosstädte die Nervenmaschine überanstrengt, das Bedürfnis nach starken und neuen Erregungen übertrieben und dumpfe Traurigkeiten, unbestimmtes Trachten und Sehnen und unbegrenzte Gelüste entfaltet. Der Mensch ist nicht mehr, was er war und was er vielleicht immer hätte bleiben sollen: ein Tier hoher Art, zufrieden damit auf dieser Erde, die ihn ernährt und unter dieser Sonne, die ihn bescheint, zu handeln und zu denken. Er ist ein wunderbares Gehirn geworden, eine unendliche Seele, für den die Glieder nur Anhängsel und die Sinne nur Diener sind, unersättlich in seiner Wissbegierde und in seinem Ehrgeiz, immer auf der Suche und eroberungsdurstig, ergriffen von Schaudern und Ausbrüchen, die seinen tierischen Bau erschüttern und seine körperliche Stütze zerstören, mit allen Sinnen herumirrend bis an die Grenzen der wirklichen und bis in die Tiefen der eingebildeten Welt, bald berauscht und bald niedergedrückt von der Unermesslichkeit seiner Errungenschaften und seines Werkes, auf das Unmögliche versessen oder in den Beruf eingesperrt, in tiefe, schmerzliche und grossartige Träume hinausgeschleudert, oder eingezwängt durch den Druck seiner sozialen Kammer und ganz nach einer Seite verkrümmt durch Besonderheiten und Monomanien.
Die Lust am Spektakel und die Freude an lauten oder sinnlosen Vergnügungen ist nichts als eine Folge dieser übermässigen, aufreibenden und abstumpfenden Arbeit. Denn gleichwie ein abgespannter Körper durch immer grössere und unerhörte neue Reize aufgepeitscht werden muss, wenn er genussfähig sein soll, büsst am Ende auch der Geist durch das beständige Hetzen und Jagen im Dienste des Erwerbs die Fähigkeit ein für einen reinen, edlen und ruhig gestalteten Genuss. Die Erholung des Geistes bekommt unwillkürlich ein ebenso fieberhaftes Gepräge, wie das Gewerbe, und sie wird genau so wie die Erwerbsarbeit in den dazu bestimmten Tagen und Stunden pflichtmässig absolviert.
Das ist die eine Seite.
Andererseits ist nicht zu verkennen, dass eben durch dieses Gehetze ungeheure Leistungen vollbracht werden, die – vielleicht – für eine spätere Zeit die Früchte einer höheren Kultur reifen lassen werden. Würden die Besitzer eines mässigen Vermögens sich aus dem Erwerbsleben zurückziehen und bei ruhigem Lebensgenuss, in welchem Maass und Würde ist, fortan ihre Musse dem Allgemeinwohl, er Kunst und Literatur zuwenden, so würden sie ein schönes Dasein führen und eine edle Kultur besitzen, die sie solchermaassen dauernd erhalten könnten. Und dadurch allein würde unsere Periode einen Gehalt gewinnen, der den Kulturgehalt des klassischen Altertums bei weitem überwiegen würde.
Wenn die bereits ins Unermessliche gewachsene Kraft unserer Dynamos und die durch Arbeitsteilung bis in das Feinste vervollkommneten Leistungen des Menschen darauf verwendet würden, um Jedem das zu geben, was notwendig ist, um das Leben erträglich zu machen und dem Geist die Musse und die Mittel zu seiner höheren Entfaltung zu bieten, so wäre vielleicht schon jetzt die Möglichkeit vorhanden, ohne Beeinträchtigung des Fortschritts und der geistigen Aufgaben der Menschheit, die Segnungen der Kultur über alle Berufe und Klassen zu verbreiten.
Allein dadurch, dass alsdann dem Geschäftsleben wahrscheinlich grosse Kapitalien entzogen werden würden, ist dafür gesorgt, dass dies eine Utopie bleiben wird, der Traum von einem Reich, in das nur Wenige gelangen können.
IV. Die Notwendigkeit des Luxus.
Die Königin Elisabeth war hocherfreut und überrascht, als sie 1560 das erste Paar seidener Strümpfe als Neujahrsgeschenk erhielt: heutzutage hat jeder Handlungsdiener dergleichen. Vor fünfzig Jahren trugen die Damen eben solche kattunene Kleider, wie heutzutage die Mägde.Schopenhauer
Kurt und Alfred hatten ein Gespräch über Zivilisation und Kultur geführt und ihre Plauderei drohte schliesslich in einen hitzigen Wortstreit auszuarten. Kurt lenkte ab und kam auf den Luxus zu sprechen, den er nur als eine Begleiterscheinung der Kultur gelten lassen wollte, deren man ohne Einbusse entraten konnte. »Nach meiner Meinung hat der Kulturmensch dem Luxus eine übertrieben hohe Bedeutung beigelegt,« sagte er. »Nein, eine viel zu geringe,« widersprach Alfred, »denn die verschiedenartige Entfaltung des sogenannten Luxus ist ein guter Gradmesser für den jeweiligen Kulturzustand. Und streng genommen, gibt es überhaupt gar keinen Luxus.«
Kurt: Das sind Meinungen, und Meinungen sind ein Tauschhandel mit Worten, bei dem im seltensten Falle ein positiver Gewinn erzielt wird.
Alfred: Wenn du sagst, der Luxus sei überflüssig, so ist das ein Verkennen des Wesens dessen, was man unter Luxus versteht. Denn Luxus treiben heisst: sich nach Maassgabe der Mittel, über die man jeweils verfügt, alle Annehmlichkeiten verschaffen, die die Zivilisation uns bereitet hat. »Ueberflüssigen« Luxus kann sich niemand gestatten, denn was dem Armen in der Lebensführung des Reichen als »überflüssig« erscheint, ist für den Reichen Lebensbedingung. Luxus und Ueberfluss gibt es nur im Hinblick auf Dinge, die ich mir selber nicht gestatten kann. Alles, was ich nicht besitze, erscheint mir bei dem, der es sein Eigen nennt, Luxus. Weil ich arm bin, erscheint mir die Lebensführung meines Freundes L ... luxuriös; aber L ... wird dir beweisen, dass er im Verhältnis zu seinem Freunde Th ... sehr bescheiden lebt, der seine Autos und seine Pferde, seine Kokotten und seine Lakaien, seine Villen und seine Weinkeller, seine Launen und seine Freunde hat – denn auch Freunde kosten Geld und sind ein Luxus.
Kurt: Wenn das eine Anspielung sein soll –
Alfred: Beileibe nicht! Ich führe nur Tatsachen an und zeige dir, wie dehnbar der Begriff des Luxus ist. Du möchtest dich an die einfachsten Beispiele halten und etwa sagen: Fünfzig Schlösser zu besitzen, sei Luxus; die Hälfte wäre genug; schon der zehnte Teil wäre genug.
Kurt: Ich halte es sogar für Luxus, fünf Schlösser zu besitzen.
Alfred: Nein und ja. Es kommt natürlich –
Kurt: – auf die Verhältnisse an?
Alfred: Nein, auf das Verhältnis, das man zur Welt hat. Die Frau eines Bourgeois kommt beispielsweise mit sechs Kleidern im Jahre aus; eine Dame von Welt kaum mit dreissig; nicht weil sie sie wirklich nötig hat, sondern weil ihre Stellung sie dazu zwingt; weil die Welt es von ihr fordert. Kein König wird zu einer Mahlzeit mehr als drei Pfund Fleisch verzehren, aber er muss zwanzig Pfund auftragen lassen. Wenn ein Sultan sich einen Harem von tausend Frauen hält, heisst das nicht, dass er alle tausend Frauen besitzt.
Kurt: Ich verstehe. –
Alfred: Und was ist denn überhaupt überflüssig? Kunst? Jeder Schmock wird dich eines Besseren belehren. Theater? Sophokles, Aristophanes, Shakespeare, Molière und noch ein paar ausserordentliche Genies, die die Menschheit besitzt, haben ihr Leben dem Theater gewidmet. Selbst die Bälle sind nicht überflüssig. Sie schaffen eine sexuelle Spannung; diese Spannung führt zu Ehen oder sie regen doch mindestens den Fortpflanzungstrieb an. Badereisen etwa? Ich mache eine Karlsbader Kur durch, nehme zwanzig Pfund ab, die ich den Winter darauf wieder zunehme und den folgenden Sommer wieder abnehme. Das scheint überflüssig.
Kurt: Dieser Kreislauf lässt sich leicht begründen.
Alfred: Begründen lässt sich alles; es dreht sich hier um die Frage, was überflüssig ist, da wir das Ueberflüssige als das eigentliche Wesen des Luxus erkannt haben. Viele emanzipierte Blaustrümpfe wollen zum Beispiel keine Kinder kriegen; folglich ist der Eierstock, den ihnen die Natur mitgegeben hat, für sie überflüssig. Nach der Meinung der meisten Aerzte, deren Wissen ich nicht unbedingt für allumfassend halte, ist der Blinddarm ebenfalls überflüssig. Wenn ich weiss, dass mich absolut gar nichts vor dem Tode retten kann, ist schliesslich das ganze Leben überflüssig; aber ich zeuge Kinder, die wiederum gar nichts vor dem Tode retten kann.
Kurt: Das ist ein Naturgesetz.
Alfred: Selbstverständlich; aber ein »überflüssiges«. Oder kennst du den Grund, warum es so ist?
Kurt: So betrachtet, wäre das ganze Universum überflüssig.
Alfred: Tatsächlich ist es so. Am Anfang schuf Gott zwar Himmel und Erde, aber es wird nicht gesagt, wozu er sie schuf. Langweilte er sich allein und wollte er ein Spielzeug haben? Es gibt Philosophen, die zu dieser Annahme neigen. Andere meinen, er wollte Macht haben und dazu brauchte er notwendig Kreaturen, die ihn anbeteten. Aber sind das Gründe, um derentwillen Gott eine Welt macht? Kein klardenkender Kopf vermag für die Schöpfung einen plausiblen Grund anzugeben. Jedenfalls wird nichts davon gesagt, dass Gott die Schöpfung für notwendig hielt. Kein Naturforscher wird finden, dass das Universum notwendig war. Im Gegenteil, wenn du zu den letzten Fragen hinabsteigst, wirst du finden, dass die ganze Welt höchst überflüssig ist, denn eines Tages wird sie, so gewiss wie da droben der tote Mond schwimmt, ebenfalls als ein leuchtender Riesensarkophag im All kreisen. Das ist der Standpunkt der Yoghi und der buddhistischen Priester, denen im Nabelbeschauen die ganze Welt versinkt. Wenn der Moses des Michelangelo, Beethovens Symphonien und Goethes »Faust« nach zehntausend Jahren tot und vergessen sind, wenn die gesamte Wissenschaft von heute durch die neuen Resultate von morgen abgetan ist, kurz, wenn die ganze Weltgeschichte eines Tages ihre Rolle ausgespielt hat, ist es dann nicht sehr gleichgültig, ob ich mich während meines Lebens mit »höheren Dingen« beschäftigt habe, oder mit Kegelschieben? Gott – wenn er existiert – kümmert sich wenig um unser Tun; es kann für ihn keine andere Bedeutung haben, als das Gekrabbel der Ameisen. Er schaut dem Jahrmarkt, den er sich zur Unterhaltung hervorgezaubert hat, eine Weile zu und wirft eines Tages die Puppen in den Orkus!
Kurt: Du bist ein Zyniker.
Alfred: Ein Mensch, der ohne Metaphern die Wahrheit sagt, ist also ein Zyniker. Die Gelehrten drücken sich anders aus; ich weiss es. Aber es kommt mir nicht auf den Wortlaut an, sondern auf den Beweis, dass vom Standpunkt des Endes aller Dinge, das Universum durchaus überflüssig ist. Vollends unser Erdball, der eines Tages ein toter Gesteinshaufen sein wird, gemäss dem Gesetze, dass alles, was entsteht, zugrunde gehen muss; dass alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende haben muss.
Kurt: Aber das Universum ist da.
Alfred: Das kann nur heissen, dass man sich, weil es nun einmal da ist, mit ihm abfinden muss; ebenso wie mit den Krankheiten, Flöhen, Erdbeben und so weiter. Dann kommen wir darauf hinaus, dass allem Ueberflüssigen also doch eine Art Notwendigkeit innewohnt. Nichts ist überflüssig; sogar die Verbrechen sind notwendig.
Kurt: Im Sinne der Utilitarier. Weil es ohne Verbrechen keine Richter gäbe, keine Staatsanwälte, Verteidiger, Schutzleute, Schreiber, Gefängniswärter.
Alfred: Das ist das Wenigste. Denn die Verbrecher sind ja auch erst eine Folge der Eigentumsidee.
Kurt: Sie sind die lebendig gewordene Empörung gegen die ungerechte Verteilung der Güter.