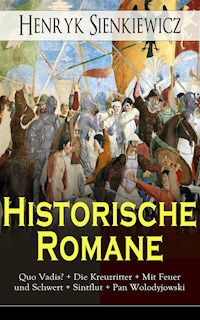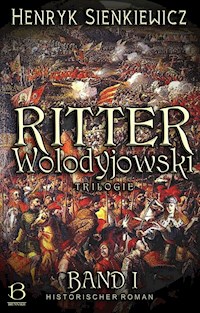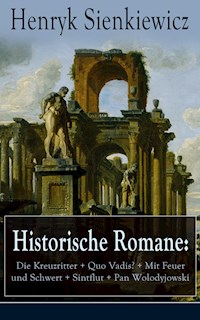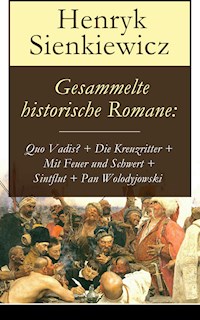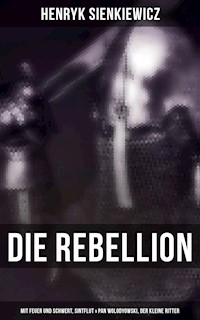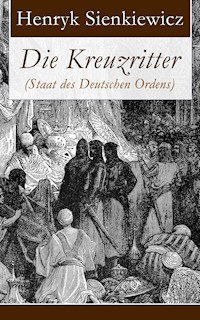Gesammelte Werke: Historische Romane + Erzählungen (17 Titel in einem Buch) E-Book
Henryk Sienkiewicz
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Gesammelte Werke: Historische Romane + Erzählungen" versammelt Henryk Sienkiewicz, der Nobelpreisträger von 1905, eine beeindruckende Sammlung seiner bedeutendsten Werke, die den Leser auf eine fesselnde Reise durch verschiedene historische Epochen mitnehmen. Sienkiewicz verbindet in seinem einzigartigen literarischen Stil detailreiche historische Recherchen mit lebendigen Charakteren und packenden Erzählungen. Die 17 enthaltenen Titel präsentieren nicht nur die Abenteuer von tapferen Helden und leidenschaftlichen Liebenden, sondern spiegeln auch die gesellschaftlichen Strömungen und politischen Konflikte ihrer Zeit wider, wobei der Autor das Spannungsfeld zwischen Mensch und Geschichte meisterhaft einfängt. Henryk Sienkiewicz, geboren 1846 in Polen, verbrachte sein Leben in einer Zeit, die von politischen Umbrüchen und nationaler Identität geprägt war. Seine Erfahrungen als Journalist und Reiseberichterstatter, verbunden mit seiner tiefen Liebe zur polnischen Geschichte, beeinflussten maßgeblich sein Schreiben. Sienkiewicz war nicht nur ein außergewöhnlicher Erzähler, sondern auch ein scharfer Beobachter, der die Wertschätzung für die eigene kulturelle Identität durch seine historischen Romane propagated. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für historische Literatur und die Entwicklung der Nationalliteratur interessieren. Sienkiewicz gelingt es, mit hervorragender Erzählkunst und fesselnder Sprache die Herzen der Leser zu erreichen. Ein Meisterwerk, das historische Erkenntnisse und literarische Schönheit vereint und somit sowohl Bildungs- als auch Genusswert bietet. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Die Autorenbiografie hebt persönliche Meilensteine und literarische Einflüsse hervor, die das gesamte Schaffen prägen. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gesammelte Werke: Historische Romane + Erzählungen (17 Titel in einem Buch)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese Ausgabe versammelt unter dem Titel „Gesammelte Werke: Historische Romane + Erzählungen“ zentrale Texte Henryk Sienkiewicz’, eines der prägenden Erzähler des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Sie bietet einen repräsentativen Überblick über sein Schaffen: große historische Romane neben psychologisch und gesellschaftlich ausgerichteten Prosawerken sowie ausgewählten Erzählungen. Ziel der Zusammenstellung ist es, die Spannweite dieses Œuvres in einer lesbaren, thematisch geordneten Architektur zugänglich zu machen und zugleich die Kontinuitäten sichtbar zu halten, die Sienkiewicz’ Werk zusammenbinden: Geschichtsbewusstsein, moralische Fragestellung, erzählerische Energie und eine unverwechselbare, bildkräftige Sprache, die bis heute ihre Strahlkraft bewahrt.
Im Mittelpunkt stehen vollständige Romane wie Quo vadis?, Mit Feuer und Schwert, Sintflut, Pan Wolodyjowski, Die Kreuzritter, Auf dem Felde der Ehre, Familie Polaniecki, Ohne Dogma sowie Sturmflut (in der Übersetzung von Clara Hillebrand). Ergänzt werden sie durch kürzere Prosastücke – Auf dem „großen Wasser“, Der Leuchtturmwächter, Komödie der Irrungen, Waldidyll, Seemanns-Legende, Die Jagd nach dem Glück, Der Organist von Ponikla, Orso und An der Quelle. Die Sammlung vereint damit epische Geschichtserzählung, Gesellschafts- und Ideenroman sowie Novelle und Skizze und erschließt eine beeindruckende Vielfalt an Tonlagen und Perspektiven.
Die historischen Romane entfalten breite Zeitpanoramen: Quo vadis? führt nach Rom zur Zeit des Kaisers Nero, Die Kreuzritter in das mittelalterliche Mitteleuropa, während Mit Feuer und Schwert, Sintflut und Pan Wolodyjowski die dramatischen Wechselfälle der Frühen Neuzeit in Osteuropa aufrufen. Auf dem Felde der Ehre blickt auf den Vorabend entscheidender Auseinandersetzungen. Diese Werke verbinden sorgfältig recherchierte historische Hintergründe mit spannungsreicher Handlung und lebendig gezeichneten Charakteren. Der Leser gewinnt Zugang zu Epochen, deren Konflikte, Werte und Hoffnungen in Sienkiewicz’ Darstellung anschaulich und zugleich vielschichtig hervortreten.
Mit Familie Polaniecki, Ohne Dogma und Sturmflut richtet sich der Blick auf die Gegenwart des Autors und die Umbrüche einer sich modernisierenden Gesellschaft. Der eine Roman interessiert sich für Vermögen, Verantwortung und familiäre Bindungen, der andere lotet in introspektiver Form die Zerrissenheit einer empfindsamen, reflektierenden Persönlichkeit aus, während Sturmflut soziale Spannungen und innere Bewegungen der Zeit spiegelt. Gemeinsam ist diesen Büchern der Ernst der moralischen Prüfung und der feine Sinn für Zwischentöne, die menschliche Beziehungen, Konventionen und Selbstbilder prägen.
Die Erzählungen und Novellen zeigen Sienkiewicz in kondensierter Form. Der Leuchtturmwächter variiert Motive von Exil, Erinnerung und Pflicht, Auf dem „großen Wasser“ und Seemanns-Legende öffnen den Raum des Meeres, seiner Gefahren und Verheißungen. Waldidyll verfeinert das Blickfeld auf Natur und ländliche Stimmungen, Komödie der Irrungen spielt mit Missverständnissen und Rollenwechseln. Der Organist von Ponikla, Orso, Die Jagd nach dem Glück und An der Quelle zeichnen prägnante Lebenslagen nach. In all diesen Stücken konzentriert sich Sienkiewicz’ Kunst auf die Essenz einer Situation, auf einen Moment der Entscheidung oder Erkenntnis.
Über Gattungsgrenzen hinweg kreisen die Texte um wiederkehrende Themen: Freiheit und Bindung, Ehre und Gewissen, Glaube und Zweifel, Liebe und Treue, Heimat, Verlust und Neubeginn. Historische Umbrüche werden als Prüfsteine persönlicher Haltung erzählt; die Intimität privater Beziehungen spiegelt größere gesellschaftliche und geistige Spannungen. Sienkiewicz zeigt, wie Ideale in Konflikten bestehen müssen und wie aus der Reibung zwischen Person und Gemeinschaft Sinn und Verantwortung erwachsen. Dabei bleibt sein Blick auf das Menschliche gerichtet: die Verletzlichkeit des Einzelnen, seine Würde, seine Fähigkeit zur Hoffnung.
Stilistisch verbindet Sienkiewicz epischen Atem mit szenischer Präzision. Weite Beschreibungen von Landschaften und Städten stehen neben pointierten Dialogen, humorvolle Entlastungen neben pathetischer Erhebung. In den Historienromanen färbt er die Sprache mit einem dezenten historischen Kolorit, ohne die Lesbarkeit zu verlieren; in den modernen und psychologischen Werken dominiert eine fein modulierte Innenschau. Die Erzählungen zeigen eine ökonomische Form, die mit knappen, bildhaften Zügen ganze Lebensgeschichten aufruft. Durchgehende Kennzeichen sind anschauliche Bilder, rhythmische Perioden und eine sichere Dramaturgie der Steigerung.
Die Werke entstanden vor dem Hintergrund einer von politischen Spannungen geprägten Epoche Europas. Sienkiewicz schrieb mit wachem Sinn für das historische Gedächtnis und zugleich mit dem Anspruch, über Zeitgrenzen hinaus zu sprechen. Seine Romane und Erzählungen bewahren kulturelle Erfahrungen und machen sie für spätere Generationen erfahrbar. Zugleich entfalten sie universelle Fragestellungen: Wie behauptet sich das Gewissen in Situationen der Bedrohung? Worin gründet Verantwortung gegenüber anderen? Was trägt ein Gemeinwesen in Krisen? Die historische Darstellung wird so zum Medium ethischer Reflexion.
Bemerkenswert ist die Balance aus Handlung und Reflexion. Sienkiewicz setzt kraftvolle Szenen, die Bewegung und Risiko bündeln, und verschafft danach Raum für Besinnung, Zweifel oder Erneuerung. Figuren erscheinen als Träger von Ideen und zugleich als vollgültige Individuen mit Widersprüchen und Eigenheiten. Diese Doppelperspektive – das Typische und das Einmalige – trägt wesentlich zur Überzeugungskraft seiner Prosa bei. Sie erklärt, warum historische Distanz nicht zur Kälte führt, sondern zur Nähe: Der Leser erkennt eigene Fragen in scheinbar fernen Zeiten wieder.
Auch in der Darstellung von Gemeinschaft zeigt sich eine große Spannweite: vom römischen Hof und der städtischen Gesellschaft über militärische Verbände und Händlerkreise bis zu kleinen Dorfgemeinschaften, Schiffsbesatzungen oder Künstlernischen. Sienkiewicz interessiert die Dynamik von Loyalitäten, die Macht des Gerüchts, die Zähigkeit von Gewohnheiten und die Überraschung des Unerwarteten. Die Bewegung zwischen öffentlicher Bühne und privater Sphäre lässt gesellschaftliche Prozesse nachvollziehbar werden und bewahrt gleichzeitig die Intimität des einzelnen Schicksals.
Die deutsche Ausgabe führt die Bandbreite des Werkes in einer kompakten Form zusammen. Sie stellt vollständige Romane neben maßgeblichen kürzeren Texten und erleichtert so Querbezüge: Motive, die in einem Novellenschluss aufscheinen, kehren in großem Maßstab im Historienroman wieder; psychologische Einsichten der modernen Prosa schärfen den Blick für Entscheidungen der Heldenfiguren. Die beigefügte Übersetzungsangabe zu Sturmflut erinnert daran, dass Sienkiewicz’ Texte in der europäischen Literaturtradition verankert sind und in unterschiedlichen Sprachräumen Resonanz fanden.
Diese Sammlung lädt dazu ein, Sienkiewicz neu oder wiederzuentdecken: als Chronisten großer Zeiten, als feinen Beobachter des bürgerlichen Lebens, als Meister der Novelle. Sie richtet sich an Leser, die epische Weite ebenso schätzen wie formbewusste Kürze, und an alle, die in Literatur eine Schule der Empathie und Urteilskraft sehen. Indem die Bände hier zusammengeführt sind, entsteht ein Panorama, das Sinnzusammenhänge sichtbar macht und Übergänge öffnet – zwischen Epochen, Stilen und Tonlagen. So wird die Vielfalt des Werkes in ihrer inneren Einheit erfahrbar.
Autorenbiografie
Henryk Sienkiewicz (1846–1916) war ein polnischer Romancier und Publizist, der zu den prägenden Erzählern des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts gehört. Er schrieb in einer von den Teilungen Polens gezeichneten Epoche und verband historische Stoffe mit moralischen Fragen von allgemeiner Gültigkeit. International wurde er vor allem durch Quo vadis? bekannt; sein Werk trug maßgeblich zur Verbreitung polnischer Literatur bei. 1905 erhielt er den Nobelpreis für Literatur, was seine Stellung als Weltautor festigte. Zugleich blieb er in Polen ein Bezugspunkt des kulturellen Gedächtnisses, insbesondere durch epische Romane, die nationale Tradition, Pathos und erzählerische Energie vereinen.
Ausgebildet wurde Sienkiewicz in Warschau, wo er an der damaligen Szkoła Główna/Universität studierte und sich mit Geschichte, Literatur und Sprachen befasste. In den intellektuellen Debatten nach dem gescheiterten Aufstand der 1860er Jahre näherte er sich dem Positivismus, zugleich aber prägten ihn die Lektüre europäischer Realisten und das Interesse an der polnischen Adels- und Militärtradition des 17. Jahrhunderts. Früh arbeitete er als Feuilletonist und Kritiker; das journalistische Handwerk schärfte seine Beobachtungsgabe, erzählerische Ökonomie und Sinn für dramatische Szenen. Reisen, darunter ein längerer Aufenthalt in den Vereinigten Staaten in den späten 1870er Jahren, erweiterten seine Perspektive auf Gesellschaften und Mentalitäten.
Seine publizistische Tätigkeit mündete rasch in erzählerische Prosa. In Novellen und Skizzen zeigte Sienkiewicz ein Gespür für prägnante Schauplätze, pointierte Charaktere und moralische Entscheidungslagen. Der Leuchtturmwächter, Orso, Der Organist von Ponikla oder die Seemanns-Legende verbinden anschauliche Szenen mit einer knappen, wirkungsvollen Dramaturgie; nicht selten stehen Fremde, Ausgesetzte oder Pflichtbewusste im Zentrum. Gleichzeitig erreichte er ein großes Publikum durch fortlaufend gedruckte Texte, die gesellschaftliche Beobachtung mit Unterhaltung verbanden. Diese Phase bereitete seine großen Projekte vor: sie schuf Figuren- und Motivreservoirs und erprobte Tonlagen, die vom pathetischen Ernst bis zur humorvollen Milieustudie reichten, ohne den moralischen Kern zu verwischen.
Mit Feuer und Schwert, Sintflut und Pan Wolodyjowski, der kleine Ritter bilden die sogenannte Trilogie, mit der Sienkiewicz in den 1880er und 1890er Jahren eine historisch-epische Erfolgslinie begründete. Die Romane spielen im 17. Jahrhundert und verknüpfen kriegerische Konflikte und Loyalitätsfragen mit Bildern ländlicher Kultur und höfischer Sitten. Ihre packenden Handlungsbögen, die detailreiche Darstellung von Ritten, Festungen und Feldlagern sowie der Ton zwischen Heldentum und Verletzlichkeit erzielten außerordentliche Resonanz. Zugleich wurden sie als literarische Antwort auf politische Ohnmacht gelesen: Vergangenheit als Ressource für Selbstbehauptung, ohne die Zwiespälte von Macht, Religion und Ehre zu beschönigen.
Mit Quo vadis? wandte sich Sienkiewicz dem antiken Rom zu und entfaltete eine Panoramaerzählung, die Verfolgung, Glaube und Machtpolitik in dramatischer Verdichtung zeigt. Das Buch verband sorgfältige Recherche mit der Kunst des fortlaufenden Romans und erreichte ein weltweites Lesepublikum in zahlreichen Übersetzungen. Es schärfte sein Profil als Autor, der historische Stoffe in existenzielle Fragen überführt, ohne die narrative Spannung zu verlieren. Die internationale Rezeption beförderte auch sein Ansehen in Polen, wo man Quo vadis? als Beleg sah, dass nationale Literatur weltliterarische Reichweite gewinnen kann, wenn sie historische Schauplätze mit moralischer Imaginationskraft verbindet.
In den 1890er und frühen 1900er Jahren profilierte sich Sienkiewicz zudem als Beobachter der Gegenwart. Ohne Dogma experimentiert mit der Tagebuchform und beleuchtet Selbstreflexion, Sinnsuche und moralische Verpflichtungen einer gebildeten Elite. Familie Polaniecki schildert Unternehmergeist, soziale Ambitionen und die Reibungen eines bürgerlichen Milieus. Später knüpft Sturmflut in der Übersetzung von Clara Hillebrand an gesellschaftliche Umbrüche und Strömungen an. Diese Romane zeigen Sienkiewicz’ Spannweite: Neben dem historischen Epos beherrschte er psychologische Analyse, Ironie und die Darstellung alltäglicher Routinen, in denen sich größere kulturelle Spannungen bündeln, ohne dass die Figuren zu bloßen Thesenvertretern werden.
In seinem Spätwerk verband Sienkiewicz historische Erweiterungen mit konzentrierter Prosa. Die Kreuzritter boten einen Blick auf Konflikte mit dem Deutschen Orden, während Auf dem Felde der Ehre noch einmal heroische Szenen entfaltet. Zugleich blieb er der kürzeren Form treu; Stücke wie Der Leuchtturmwächter, Orso oder Der Organist von Ponikla werden bis heute gelesen. Sienkiewicz starb 1916 in der Schweiz. Sein Einfluss reicht von populärer Geschichtserzählung bis zur Diskussion über Ethos und Verantwortung. Übersetzungen halten sein Werk international präsent; in Polen bleibt er ein Autor, an dem sich historische Imagination und Gegenwartsbewusstsein schärfen.
Historischer Kontext
Henryk Sienkiewicz (1846–1916) schrieb unter den Bedingungen der polnischen Teilungen und verband in seinem Werk antike, frühneuzeitliche und zeitgenössische Stoffe. Die hier versammelten historischen Romane und Erzählungen reichen von Rom zur Zeit Neros bis zu den polnisch‑litauischen Kriegen des 17. Jahrhunderts und in die gesellschaftliche Moderne des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Spannweite erklärt den anhaltenden Reiz: Geschichte dient ihm als Spiegel aktueller Konflikte – Macht und Widerstand, Glaube und Skepsis, Tradition und Umbruch. Die Sammlung dokumentiert so nicht nur erzählerische Virtuosität, sondern auch die ideengeschichtlichen und politischen Debatten eines Europas im Übergang zur Moderne.
Die Entstehung vieler Texte ist ohne die politischen Realitäten der Teilungszeit nicht denkbar: Russland, Preußen und Österreich prägten das öffentliche Leben durch Verwaltung, Schule und Zensur. Nach den Aufständen von 1830/31 und 1863/64 verschärften sich Repressionen, insbesondere im russischen Teilungsgebiet. Literatur gewann als Träger nationaler Erinnerung und moralischer Selbstbehauptung an Gewicht. Zeitungen und Zeitschriften verbreiteten Fortsetzungsromane und erreichten eine wachsende Leserschaft. In diesem Umfeld entfaltete Sienkiewicz eine Geschichtserzählung, die Emotion und Patriotismus bündelte, ohne auf dokumentarische Elemente zu verzichten, und dadurch zugleich Trost, Orientierung und politisches Signal gab.
Mit Feuer und Schwert, Sintflut und Pan Wolodyjowski, der kleine Ritter – die sogenannte Trilogie – verankern die polnische Erinnerung an das 17. Jahrhundert. Sie durchmessen Konflikte mit Kosaken, Schweden, Tataren und dem Osmanischen Reich und situieren das Schicksal des Gemeinwesens im europäischen Mächtegefüge. Die Romane reagieren auf eine Zeit, in der Polen als Staat nicht existierte, indem sie staatliche Handlungsfähigkeit imaginieren. Dabei verbinden sie Abenteuer, Militärgeschichte und Rechtsvorstellungen der Adelskultur. Die historische Folie dient dazu, Loyalität, Ehre und Gemeinsinn zu diskutieren, ohne die damaligen sozialen Spannungen auszublenden.
Die Welt der polnisch‑litauischen Adelsrepublik war multiethnisch und multikonfessionell. Lateinische, polnische und ruthenische Traditionen, katholische, orthodoxe, protestantische und jüdische Milieus, dazu muslimische Tataren, prägten Regionen und Städte. Sienkiewicz’ Rekurse auf diese Vielfalt knüpfen an die Historiographie des 19. Jahrhunderts an, die die Adelskultur idealisierte, zugleich aber deren politische Defizite problematisierte. Wiederkehrend ist die Frage, wie rechtliche Privilegien, alte Sitten und militärische Tugenden in Krisen bestehen. Die Romane reflektieren so die Spannung zwischen partikularer Standesidentität und dem Bedürfnis nach übergreifender Staatlichkeit im Angesicht äußerer Bedrohung.
Die Kreuzritter reagiert auf die Nationalitätenkonflikte des späten 19. Jahrhunderts, besonders auf Germanisierungsmaßnahmen im preußischen Teilungsgebiet. Der Rückgriff auf den mittelalterlichen Konflikt mit dem Deutschen Orden – und die Erinnerung an Grunwald/Tannenberg (1410) – machte Geschichte zum Medium politischer Selbstvergewisserung. Zeitgleich führte der Kulturkampf in Preußen und die Tätigkeit staatlicher Siedlungspolitik zu einer polarisierenden Öffentlichkeit. Sienkiewicz’ Roman bietet eine symbolische Gegenrede: Er mobilisiert historische Erfahrung, um moderne Identität zu stabilisieren. Zugleich knüpft er an europäische Ritterromantik an, ohne die sozialen Kosten der Verfeindung zu romantisieren.
Quo vadis? verortet die Entstehung des Christentums in einem Rom, das von Verfolgung, Spektakel und imperialer Selbstdarstellung geprägt ist. Um 1900 befeuerten Archäologie, Museumswesen und Bildungsreisen ein allgemeines Antikeninteresse; zugleich suchten viele Leser nach spirituellen Orientierungen im Zeitalter rasanter Säkularisierung. Der Roman verbindet diese Strömungen: Er stellt Moral, Macht und Gewissen in den Raum einer Weltmetropole und diskutiert, wie eine neue religiöse Ethik die alte Ordnung herausfordert. Damit wird antike Geschichte zur Folie für zeitgenössische Fragen von Gewalt, Gemeinschaft und innerer Freiheit.
Die Moderne der Teilungszeit brachte Urbanisierung, Kapitalmobilität und eine bürgerliche Kultur des Unternehmertums. Familie Polaniecki nimmt wirtschaftliche Initiative und soziale Verantwortung in den Blick, während Ohne Dogma im Tagebuchmodus eine fin‑de‑siècle‑Krise von Sinn und Pflicht erkundet. Die Jagd nach dem Glück spiegelt bürgerliche Sehnsüchte und normative Brüche einer Gesellschaft, die zwischen positivistischer Arbeitsethik und ästhetischer Lebenssuche schwankt. Diese Texte registrieren die Verschiebung von einer adligen Ehrenordnung zu bürgerlichen Leistungs- und Gefühlsökonomien – mit neuen Geschlechterrollen, Erwartungen an Bildung und dem Aufstieg der Presse als moralischer Instanz.
Sturmflut, in deutscher Übersetzung von Clara Hillebrand verbreitet, steht im Zeichen der politischen Erschütterungen nach 1905 im Russischen Reich. Streiks, Boykotte, Repression und konkurrierende Programme – von sozialistischen bis nationalen – erhöhten den Druck auf Individuen und Familien. Sienkiewicz nutzt die Romankunst, um Gewissenslagen, Opportunismus und Verantwortung zu verhandeln, ohne programmatisch zu agitieren. Die Zensur zwang zu indirekter Argumentation, die Leser dennoch eindeutig lasen. Die Darstellung zeigt, wie politische Turbulenz in Alltagsroutinen eindringt und wie sich soziale Loyalitäten neu ordnen – in Vereinen, Salons, wirtschaftlichen Netzwerken und der Presse.
Migration prägte die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg. Hunderttausende verließen die polnischen Provinzen Richtung Amerika. Der Leuchtturmwächter und Auf dem "großen Wasser" greifen Erfahrungen der Auswanderung, der Seereise und der Diaspora auf. Sie zeigen die Spannung zwischen Anpassung und Erinnerung, die Bedeutung von Sprache, Lesestoff und religiösen Praktiken für das Selbstverständnis in der Fremde. Die Ozeandampfer, neue Hafenstädte und Vermittlungsagenturen machten Mobilität alltäglich. Literatur wurde zum Bindeglied zwischen Herkunft und Zukunft – und zur Reflexion darüber, was kulturelle Zugehörigkeit in transatlantischen Lebensläufen bedeutet.
Technische Innovationen – Eisenbahn, Telegraf, Dampfschiff – schrumpften Entfernungen und verdichteten Handels- wie Kommunikationsräume. Seemanns‑Legende nutzt das maritime Imaginäre, um Risiken, Aberglauben und Solidaritäten einer globalisierten Arbeitswelt zu fassen. Orso führt in die Welt der Zirkus- und Schaustellerei, deren Wanderbewegungen europäische und amerikanische Orte verbanden. Solche Texte registrieren die neue Sichtbarkeit weltweiter Kontakte ebenso wie die Prekarität mobiler Existenzen. Moderne Unterhaltungskulturen, Massenspektakel und die Ökonomie der Aufmerksamkeit bilden dabei einen Resonanzraum, der soziale Grenzerfahrungen exemplarisch sichtbar macht.
Demgegenüber kultivieren Waldidyll und Der Organist von Ponikla eine kleinstädtisch‑ländliche Perspektive. Sie beobachten Gemeindestrukturen, Frömmigkeit, Schulwesen und die Spannungen zwischen Tradition und sozialer Mobilität nach der schrittweisen Aufhebung der Leibeigenschaft im 19. Jahrhundert in den Teilungsgebieten. An der Quelle setzt – in kontemplativer Tonlage – bei Natur und Ursprungserfahrung an und fragt nach moralischen Ressourcen jenseits politischer Tageskämpfe. Zusammen liefern diese Erzählungen ein Archiv ländlicher Mentalitäten und zeigen, wie tiefgreifend Modernisierung in scheinbar abgelegenen Räumen erlebt und ausgehandelt wurde.
Auf dem Felde der Ehre ruft die Kriegszüge des späten 17. Jahrhunderts in Erinnerung, die mit dem Namen Jan III. Sobieski und der Entsatzleistung für Mitteleuropa verbunden werden. Der Text verhandelt militärische Disziplin, geostrategische Koalitionen und religiöse Symbolik in einem Europa, dessen Grenzen umkämpft waren. Dabei kontrastiert er höfische Politik mit soldatischen Tugenden und stellt die Frage nach dem Preis der „Ehre“ im Spannungsfeld von Staat, Kirche und persönlicher Loyalität. So entsteht ein historisches Tableau, das politische Ordnungsvorstellungen des Barockzeitalters für moderne Leser lesbar macht.
Komödie der Irrungen nutzt das komische Register, um soziale Codes, Heiratsstrategien und die Grammatik des Ansehens zu beleuchten. In einer Epoche, deren Öffentlichkeit von Feuilleton, Salon und Bühne geformt wurde, war das satirische Sehen ein probates Mittel der Gesellschaftskritik. Das Stück bzw. die Erzählung bindet die Tradition europäischer Komödien an zeitgenössische Beobachtungen: das Nebeneinander alter Eliten und aufstrebender Milieus, die Macht der Konvention und die Fallstricke der Selbstdarstellung. Auf diese Weise ergänzt die Komik die heroischen Stoffe des Autors um eine Diagnose bürgerlicher Alltagsvernunft.
Sienkiewicz’ historische Romane arbeiten mit Chroniken, Memoiren und volkskundlichen Materialien, doch sie sind zugleich Kinder der Massenpresse. Die feuilletonistische Fortsetzungstechnik strukturierte Dramaturgie, Dialogdichte und Cliffhanger. Die Erzählweise schließt an die Tradition Walter Scotts und Alexandre Dumas’ an, doch polnische Themen und Sprachregister – inklusive gelegentlicher Archaismen – geben ihr ein eigenes Profil. So entsteht eine Literatur, die zugleich popularisiert und kanonisiert: Sie übersetzt komplexe Forschung in erzählerische Handlung und prägt damit das Geschichtsbewusstsein breiter Leserschichten nachhaltig.
Die Rezeption war früh international. 1905 erhielt Sienkiewicz den Nobelpreis für Literatur; Quo vadis? wurde zu einem der weltweit bekanntesten historischen Romane seiner Zeit und vielfach übersetzt. Deutsche Ausgaben – auch dank Übersetzern wie Clara Hillebrand – erschlossen ein breites Publikum im Kaiserreich und darüber hinaus. Bühnenfassungen und Verfilmungen im 20. Jahrhundert verankerten Motive und Figuren im kollektiven Gedächtnis. Zugleich stimulierte die Popularität Debatten über die Grenzen zwischen Unterhaltung und Bildung sowie über die Verantwortung historischer Fiktion gegenüber wissenschaftlicher Genauigkeit.
Die politische Instrumentalisierung seiner Stoffe blieb nicht aus. In der Zwischenkriegszeit diente das Werk der Nationsbildung und dem Schulkanon. Nach 1945 wurden adelige Perspektiven und nationale Mythologeme teils kritisch gelesen, zugleich aber die antiklerikalen oder antidespotischen Impulse in Quo vadis? betont. In der Spätphase des 20. Jahrhunderts verschoben sich die Lektüren erneut: Forschungen zu Minderheiten, Grenzräumen und Gender rückten blinde Flecken ins Blickfeld. Heute interessiert, wie Die Kreuzritter, die Trilogie oder Sturmflut Machtverhältnisse, Loyalitäten und Gewalt erzählen – und wie diese Erzählweisen selbst zeitgebunden sind.
Die Sammlung kommentiert ihre Entstehungszeit, indem sie Vergangenheit als Reservoir von Deutungsangeboten nutzt. Kriegsbilder, Heiligenlegende, Komödie, Provinz- und Seestücke bilden zusammen ein Panorama gesellschaftlicher Kräfte: Staat und Kirche, Militär und Markt, Familie und Öffentlichkeit. Die Texte zeigen, wie kulturelle Zugehörigkeit hergestellt, bedroht und erneuert wird – in Archiven, Ritualen, Medien und Mobilitäten. Spätere Deutungen lesen darin mal Trost, mal Warnung. So bleibt diese Auswahl ein Zeugnis darüber, wie Literatur historische Erfahrung bündelt und für neue Epochen produktiv macht – zwischen Erinnerungspolitik und ethischer Prüfung.
Synopsis (Auswahl)
Die Trylogie (Mit Feuer und Schwert · Sintflut · Pan Wolodyjowski, der kleine Ritter)
Drei Romane begleiten eine Schar von Soldaten, Edelleuten und Gefährtinnen durch die Kriegsstürme des 17. Jahrhunderts: Mit Feuer und Schwert, Sintflut und Pan Wolodyjowski, der kleine Ritter. Loyalität, Liebesbande und Überlebenskunst werden im Widerstreit von Aufständen, Invasionen und Grenzkriegen erprobt. Der Ton ist episch und schwungvoll, mit martialischer Spannung, Humor und patriotischer Verve.
Quo vadis?
Im Rom Neros verstrickt die Liebe eines Patriziers zu einer Christin ihn in die junge Glaubensgemeinschaft und in die Abgründe einer blutigen Hof- und Spektakelkultur. Der Roman stellt die Sinnlichkeit und Pracht der Antike der inneren Wandlung und Standhaftigkeit gegenüber. Der Ton ist dramatisch, farbig und moralisch fokussiert.
Die Kreuzritter
Eine Familien- und Rittergeschichte entfaltet sich vor dem Hintergrund des Konflikts mit dem Deutschen Orden. Adlige Rivalitäten, Willkür und Treueverhältnisse treiben die Figuren einer großen Auseinandersetzung entgegen. Der Ton ist ritterlich-episch, detailreich und auf nationale Selbstbehauptung gerichtet.
Auf dem Felde der Ehre
Ein kurzer historischer Roman aus der Zeit Sobieskis zeigt junge Helden auf dem Weg in den Krieg und in erste Bewährungsproben der Liebe. Mobilmachung und Lagerleben bilden die Bühne für Mut, Kameradschaft und Pflichtgefühl. Der Ton ist knapp, schwungvoll und von nostalgischer Bewunderung für soldatische Tugenden getragen.
Familie Polaniecki
Ein selbstgemachter Unternehmer ringt zwischen Risiko, gesellschaftlichem Aufstieg und der Gestaltung von Ehe und Familie. Das Buch beobachtet die Spannungen zwischen Nutzenkalkül, Gewissen und häuslicher Ordnung und lässt seine Figur reifen, ohne Illusionen zu nähren. Der Ton ist realistisch, leicht satirisch und versöhnlich.
Ohne Dogma
In Tagebuchform seziert ein zerrissener Aristokrat seine Begierden, Skrupel und Verfehlungen, während er zwischen Beziehungen und Idealen driftet. Der Roman befragt die Müdigkeit der Jahrhundertwende und die Lähmung übersteigerter Selbstbeobachtung. Der Ton ist bekenntnishaft, analytisch und oft ironisch.
Sturmflut (Übersetzung von Clara Hillebrand)
Im modernen städtischen Milieu geraten Figuren in politische Strudel, Salonintrigen und Versuchungen, die Loyalitäten auf die Probe stellen. Private Hoffnungen stehen im Sog gesellschaftlicher Umbrüche und Ideologien. Der Ton ist zeitkritisch, psychologisch differenziert und gespannt.
Seegeschichten und maritime Erzählungen
Diese Erzählungen führen an und auf das Meer und kreisen um Einsamkeit, Heimatsehnsucht und die elementare Gewalt der Natur: Auf dem großen Wasser, Der Leuchtturmwächter und Seemanns-Legende. Ein Wärter, Reisende oder Seeleute treffen Entscheidungen, an denen sich Standhaftigkeit und Erinnerung zeigen. Der Ton ist knapp, elegisch und von Abenteuerhauch umweht.
Komödie der Irrungen
Eine leichte Verwechslungskomödie, in der vertauschte Rollen, Missverständnisse und verletzte Eitelkeiten die Gesellschaft durcheinanderbringen. Hinter der Farce liegt eine milde Entlarvung von Konventionen und Selbsttäuschungen. Der Ton ist spritzig, witzig und nachsichtig.
Waldidyll
Ein pastorales Bild, in dem der Rhythmus des Landlebens einen stillen Charakter- oder Gefühlskonflikt rahmt. Die Natur dient als Spiegel und Zuflucht und glättet das Scharfe ins Nachdenkliche. Der Ton ist lyrisch und zurückhaltend.
Die Jagd nach dem Glück
Figuren verfolgen Wohlstand oder Erfüllung über Distanzen und Klassengrenzen hinweg, oft im Zeichen der Auswanderung. Der Text wägt das Versprechen eines Neuanfangs gegen die damit verbundenen Verluste und Entwurzelungen. Der Ton ist nüchtern, mitfühlend und von Suchbewegungen geprägt.
Der Organist von Ponikla
In einer kleinen Gemeinde gerät ein Musiker zwischen Pflicht, Ansehen und persönlichen Regungen. Eine ethische Entscheidung macht die Würde und Verletzlichkeit des Alltäglichen sichtbar. Der Ton ist intim, moralisch akzentuiert und empathisch.
Orso
Ein reisender Künstler von gewaltiger Körperkraft steht dem Kalkül von Schaustellern und der Gier des Publikums gegenüber. Wo Kunst, Grausamkeit und Spektakel aufeinanderprallen, verschiebt sich der Begriff von Stärke. Der Ton ist bildhaft, dramatisch und dem Außenseiter zugewandt.
An der Quelle
Ein besinnlicher Text über Anfänge: die Entstehung eines Gefühls, einer Erzählung oder eines Lebensweges. Er deutet Erneuerung und Klarheit dort an, wo Erfahrung und Ideal sich berühren. Der Ton ist meditativ und gedrängt.
Wiederkehrende Themen und Stil
Durch die Sammlung zieht sich die Prüfung des Einzelnen zwischen Pflicht, Liebe und Ehre – vom antiken Rom über mittelalterliche Felder bis in bürgerliche Salons. Geschichte wird zur Bühne des Gewissens, und große Tableaus wechseln mit Innenansichten, die Humor und Pathos verbinden. Sienkiewicz' Erzählen ist anschaulich, zügig und reich an lebendigen Nebenfiguren.
Die modernen Romane vertiefen Psychologie, soziale Mobilität und die Desorientierung im Umbruch, während die kürzeren Texte Exil, Heimat und Natur zu emblematischen Momenten verdichten. Wiederkehrende Motive sind Standhaftigkeit, Glaube, Zugehörigkeit und die aufopfernde Kraft von Liebe und Pflicht. Stilistisch pendelt das Werk zwischen epischer Geste und pointierter Skizze.
Gesammelte Werke: Historische Romane + Erzählungen (17 Titel in einem Buch)
Quo vadis?
1.
Petronius erwachte gegen Mittag, fühlte sich aber noch sehr ermattet, denn er hatte gestern ein Gastmahl bei Nero mitgemacht, das bis tief in die Nacht gewährt hatte. Jedoch das Frühbad und das sorgsame Kneten des Körpers durch eigens hiezu geübte Sklaven beschleunigten bald den Lauf seines trägen Blutes und ermunterten ihn, so daß er nach einiger Zeit aus der letzten Prozedur des Bades wie von den Toten auferstanden, mit glänzenden Augen, geistreichem Wesen und Frohsinn, verjüngt, voll Lebensgeist hervorging. Man nannte ihn ja auch mit Recht den Arbiter elegantiarum.
Nach diesem Gastmahl, bei dem ihn die Narrenpossen des Vatinius und Nero, Lucanus und Seneka gelangweilt und er auch an der gelehrten Abhandlung, ob auch die Frau eine Seele habe, sich beteiligt hatte – stand er spät auf und nahm, wie gewöhnlich, ein Bad. Zwei riesige Badediener betteten ihn auf ein mit schneeweißem ägyptischen Byssus bedecktes Lager von Zypressenholz und begannen mit ihren in wohlriechendes Olivenöl getauchten Händen den wohlgestalteten Körper einzureiben – er aber wartete mit geschlossenen Augen, bis die Wärme des Schwitzbades und die Wärme ihrer Hände auf ihn wirkte und die Mattigkeit verscheuchte.
Plötzlich rief der Sklave, der die Namen der ankommenden Gäste melden mußte, durch den Vorhang, daß der junge Markus Vinicius soeben aus Kleinasien zurückgekehrt und zum Besuch eingetroffen sei. Petronius befahl, den Gast sofort hereinzulassen. Vinicius war der Sohn von Petronius’ älterer Schwester, die vor Jahren mit Markus Vinicius, der unter Tiberius die Würde eines Konsularis bekleidete, sich vermählt hatte. Der junge Markus diente gegenwärtig unter Corbulo gegen die Parther und war nach beendetem Feldzug in die Stadt zurückgekehrt. Petronius hatte für ihn jene Schwäche, die an Anhänglichkeit grenzt, denn Markus war ein schöner, athletischer Jüngling, der zugleich feine Umgangsformen besaß, was Petronius über alles schätzte.
»Gruß dem Petronius,« sagte der junge Mann, elastischen Schrittes eintretend, »mögen dir die Götter gewogen sein!«
»Sei gegrüßt in Rom, und die Ruhe sei dir süß nach dem Kampfe,« versetzte Petronius, die Hand aus den Falten des weichen Gewebes, das ihn umhüllte, herausstreckend. – »Was hört man in Armenien? Kamst du auch während deines Aufenthalts in Asien nach Bithynien?«
Petronius war einst in Bithynien Statthalter gewesen und hatte sein Amt mit Umsicht und Gerechtigkeit verwaltet. Sein Charakter war aus den widersprechendsten Eigenschaften zusammengesetzt, und da er allgemein für sehr verweichlicht und prunkliebend galt, erinnerte er sich gern jener Zeiten, weil sie den Beweis dafür erbrachten, daß er auch tätig und energisch sein konnte, wenn es ihm beliebte.
»Ich kam unter anderem auch nach Herakleia,« entgegnete Vinicius. »Corbulo sandte mich dorthin, Verstärkungen zusammenzuziehen.«
»Erzähle mir, was man von den parthischen Grenzen hört! Mich langweilen sie zwar alle, diese barbarischen Völker, die in ihrer Heimat, wie der junge Arulamus erzählt, noch auf allen Vieren kriechen und nur uns gegenüber sich für Menschen ausgeben. Jetzt sind sie ein beliebter Gesprächsstoff in Rom, schon deshalb, weil es gefährlich ist, von anderen Dingen zu sprechen.«
»Dieser Krieg steht schlecht, und wenn Corbulo nicht wäre, könnte man sich auf eine völlige Niederlage gefaßt machen.«
»Corbulo! Beim Bacchus! Der reine Kriegsgott! Ein gewaltiger Heerführer, und zugleich feurig und rechtlich und einfältig. Ich habe ihn schon deshalb gern, weil Nero ihn fürchtet.«
In diesem Augenblick traten zwei Sklaven ein, welche sich um Petronius bemühten und ihm die Härchen der Arme und Hände herauszogen, während Markus das Unterkleid abwarf und auf die Aufforderung des Petronius hin in ein lauwarmes Bad stieg.
Petronius schaute auf den Jüngling mit dem befriedigten Auge eines Künstlers.
Als Markus fertig war und sich seinerseits den Haarauszupfern überließ, trat ein Vorleser ein, der eine Bronzebüchse umgehängt trug, in der eine Papyrusrolle steckte.
»Willst du zuhören?« fragte Petronius.
»Wenn es dein eigenes Werk ist, gern!« versetzte Vinicius. »Wenn nicht, möchte ich mich lieber mit dir unterhalten. Heutzutage fangen die Dichter ihre Zuhörer an allen Straßenecken ab.« »Und ob! Man kommt an keiner Basilika, weder bei den Thermen noch bei einer Bibliothek oder einem Buchladen vorbei, ohne auf einen Dichter zu stoßen, der sich wie ein Affe gebärdet. Als Agrippa aus dem Osten hieherkam, hielt er diese Leute für Besessene. Aber das liegt jetzt so in der Zeit. Wenn der Kaiser Verse schreibt, müssen natürlich alle seinem Beispiel folgen. Nur bessere Verse darf niemand schreiben als der Kaiser, und deshalb schreibe ich nur Prosa, womit ich aber weder mich selbst noch andere behellige. Nein, das, was der Vorleser vortragen soll, ist ein Buch des Fabricius Veiento, das jetzt überall leidenschaftlich gelesen wird, weil es unendlich viel Klatsch und Skandal enthält. Es sucht jedermann in dem Buche sich selbst mit Besorgnis, Bekannte aber mit stillem Vergnügen. In dem Buchladen des Arvinus wird das Buch von hundert Schreibern nach einer Vorlage geschrieben, und der Erfolg ist sicher.«
»Deine Streiche sind dort nicht zu haben?«
»O doch, aber der Verfasser ist fehlgegangen, denn ich bin viel schlechter und weniger fade, als er mich dort schildert. Siehst du, wir haben hier schon längst das Gefühl für das Würdige und Unwürdige verloren, mir geht es selbst so, obwohl Seneka, Musonius und Traseas es zu erkennen glauben. Mir ist auch alles gleichgültig, über Herkules rede ich, was ich denke. Aber dennoch habe ich den Vorzug vor andern, daß ich weiß, was häßlich und was schön ist; dies versteht zum Beispiel unser kupferbärtiger Dichter, dieser Fuhrmann, dieser Gassensänger, dieser Tänzer, nicht.«
»Dennoch tut es mir um Fabricius leid! Er war ein guter Gesellschafter.«
»Seine Eigenliebe hat ihn verdorben. Jeder mißtraute ihm, niemand wußte etwas Rechtes, aber er selbst konnte nichts behalten und erzählte alles nach allen Richtungen hin unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Hörtest du schon die Geschichte des Rufinus?«
»Nein.«
»So gehen wir hinüber ins Frigidarium. Während wir uns abkühlen, erzähle ich dir die Geschichte.«
Beide begaben sich in den Baderaum, in dessen Mitte ein Springbrunnen in hellrosa Farben sprudelte und einen Veilchenduft verbreitete. Dort setzten sie sich in Nischen, die mit Seide ausgepolstert waren, und genossen die Kühle. Es herrschte einen Augenblick Stille.
»Du liebst den Krieg,« begann Petronius, »was ich von mir nicht sagen kann, denn unter den Zelten werden die Fingernägel brüchig und verlieren ihre rosige Färbung. Übrigens hat jeder seine Liebhaberei, so wie der Kupferbärtige den Gesang liebt, besonders seinen eigenen. Übrigens, sage mir, schreibst du auch Verse?«
»Nein. Ich habe noch niemals einen Hexameter fertiggebracht.«
»Spielst du die Laute und singst dazu?«
»Nein.«
»So bist du vielleicht Meister im Wagenlenken?«
»Seinerzeit habe ich mich an den Wettfahrten in Antiochia beteiligt, aber ohne Erfolg.«
»Dann bin ich deinetwegen beruhigt. Zu welcher Partei gehörst du auf der Rennbahn?«
»Zu den Grünen.«
»Dann bin ich völlig beruhigt, besonders da du zwar ein hübsches Vermögen besitzest, aber doch nicht so reich bist wie Pallas und Seneka. Du mußt wissen, daß es bei uns von Vorteil ist, wenn einer dichtet, zur Laute singt, deklamiert und sich im Zirkus an den Wettfahrten beteiligt, besser aber ist es und vor allem ungefährlicher, wenn einer nicht dichtet, nicht die Laute schlägt, nicht singt und nicht an den Wettfahrten im Zirkus teilnimmt, am besten aber ist es, wenn man alles anzustaunen versteht, was der Feuerbart tut. Du bist ein hübscher junger Mann und daher der Gefahr ausgesetzt, daß Poppäa dich liebgewinnt. Doch nein – sie ist darin schon zu erfahren. Sie hat an der Seite ihrer beiden ersten Gatten genug Liebe genossen, und jetzt als Neros Gemahlin denkt sie an ganz andere Dinge.«
»Du wolltest mir ja die Geschichte des armen Rufinus erzählen.«
»Im Salbraum sollst du sie hören.«
Aber im Salbraum wurde die Aufmerksamkeit des Vinicius schnell auf etwas anderes gelenkt, nämlich auf die ungewöhnlich schönen Sklavinnen, die auf die Männer warteten und sich anschickten, ihren Leib mit köstlichen arabischen Salben einzureiben.
»Beim wolkentürmenden Zeus,« rief Markus Vinicius. »Schönere Sklavinnen kann auch der Feuerbart nicht besitzen.« Mit einer freundschaftlichen Gutmütigkeit sagte Petronius: »Du bist ja mein Blutsverwandter, und ich bin weder so ungefällig wie Bassus noch so ein Kleinigkeitskrämer wie Aulus Plautius.« Als Vinicius diesen letzten Namen hörte, hob er rasch das Haupt und fragte: »Wie kommst du jetzt auf Aulus Plautius? Weißt du, daß ich etliche Tage in seinem Hause zubrachte, als ich mir vor der Stadt den Arm verstauchte? Zufällig kam gerade Plautius des Weges gefahren, als mir der Unfall zustieß, und weil er mich leidend sah, nahm er mich zu sich, wo mich sein Sklave, der Arzt Merion, behandelte und ich bald gesundete. Gerade davon wollte ich mit dir sprechen.«
»Warum? Hast du dich gar in Pomponia verliebt? In diesem Falle müßte ich dich bedauern: nicht mehr jung, dagegen tugendhaft! Eine schlimmere Vereinigung könnte ich mir gar nicht vorstellen.«
»In Pomponia nicht – nein!« sagte Vinicius.
»In wen denn?«
»Ja, wenn ich’s nur selber wüßte, in wen! Ich weiß auch nicht einmal genau, wie sie heißt: Lygia oder Callina. Im Hause wird sie Lygia genannt, weil sie dem Lygiervolke entstammt, sie hat aber auch noch ihren Babarennamen Callina. Es ist dies ein merkwürdiges Haus, dieses Haus des Plautius. Mehrere Tage hindurch ahnte ich nicht, welch göttliches Wesen es bewahrt, bis ich es eines Morgens vor Sonnenaufgang erblickte, als es sich an dem Gartenbrunnen wusch. Von dieser Zeit an sah ich sie noch zweimal, und seither weiß ich nicht mehr, was Ruhe ist; ich habe keine andere Sehnsucht mehr; nichts, was die Stadt mir bieten könnte, kann mich locken; ich begehre weder Gold noch korinthisches Erz, weder Bernstein noch Perlen, noch Wein und Festgelage, nur Lygia will ich. Ich sage dir offen, Petronius, ich sehne mich nach ihr Tag und Nacht.«
»Wenn sie eine Sklavin ist, so kaufe sie doch!«
»Sie ist keine Sklavin.«
»Was ist sie denn? Eine Freigelassene des Plautius?«
»Ich weiß es nicht; eine Königstochter oder etwas Ähnliches.« »Du machst mich sehr neugierig, Vinicius.«
»Wenn du mich nun anhören willst, werde ich gleich deine Neugierde befriedigen. Die Geschichte ist nicht sehr lang. Du kanntest vielleicht gar persönlich den König der Sueven, Vannius, der, aus seinem Reiche vertrieben, sich lange Zeit in Rom aufhielt. Kaiser Drusus brachte ihn wieder auf seinen Thron. Vannius war ein tüchtiger Mann, regierte anfangs gut und führte glückliche Kriege, später fing er jedoch an, nicht nur die Nachbarn, sondern auch seine eigenen Untertanen zu schinden. Um diese Zeit beschlossen Vangio und Sido, Söhne des Vibilius, Königs der Hermunduren, ihren Onkel Vannius zu zwingen, wieder nach Rom zu flüchten.«
»Ganz recht, ich erinnere mich, es ist ja noch gar nicht so lange her, es war zu Claudius’ Zeiten.«
»Nun brach der Krieg aus. Vannius rief die Jazygen zu Hilfe, seine beiden Schwiegersöhne dagegen die Lygier, welche von den Reichtümern des Vannius gehört hatten und, herbeigelockt in der Hoffnung auf reiche Beute, in so großer Anzahl kamen, daß selbst der Kaiser Claudius für die Ruhe seiner Grenzen fürchtete. Claudius wollte sich in einen Krieg mit den Barbaren nicht einmischen und schrieb an Atelius Hister, den Führer der Donaulegionen, daß er ein wachsames Auge auf den Verlauf des Krieges richte und über den Frieden jener Gegenden wache. Hister verlangte nun von den Lygiern, daß sie sich verpflichten, die Grenzen nicht zu überschreiten; dies wurde nicht nur bereitwillig zugesagt, sondern auch Geiseln gestellt, unter denen sich die Frau und Tochter ihres Heerführers befanden… also ist meine Lygia die Tochter jenes Heerführers.«
»Woher weißt du das alles?«
»Dies erzählte mir alles Aulus Plautius selbst. Die Lygier haben zwar nicht die Grenzen überschritten; aber die Barbaren kommen wie ein Unwetter und verschwinden ebenso; so verschwanden auch sie samt ihren Auerochshörnern, die sie auf den Köpfen trugen. Sie schlugen den Vannius und seine Verbündeten, jedoch fiel ihr König, und sie machten sich mit dem Raube davon und ließen die Geiseln in den Händen des Hister. Kurz darauf starb die Mutter, und das Kind sandte Hister an Pomponius, der damals Statthalter von Germanien war. Pomponius kehrte nach Beendigung des Krieges mit den Chatten nach Rom im Triumph zurück. Die Jungfrau ging hinter dem Triumphwagen des Siegers. Nach beendeter Einzugsfeier wußte Pomponius selbst nicht, was er mit der Geisel, die er nicht gut als Gefangene behandeln konnte, anfangen sollte, und schenkte sie seiner Schwester Pomponia Graecina, der Frau des Plautius. In diesem Hause, wo alles – vom Herrn angefangen bis zum Federvieh – tugendhaft ist, wuchs sie heran und ist ebenso tugendhaft wie Graecina selbst und so schön, daß selbst Poppäa neben ihr wie eine herbstliche Feige neben einem Hesperidenapfel sich ausnehmen müßte.«
»Und nach dieser Jungfrau sehnst du dich?«
»Ja, ich will Lygia haben. Ich will sie mit meinen Armen umschlingen und an meine Brust drücken und ihren Atem fühlen. Ich will sie in meinem Hause haben, immerzu, bis mein Haupt weiß ist wie der Gipfel des Soracte im Winter.«
»Sie ist keine Sklavin, gehört aber schließlich doch zur Familie des Plautius und wird wohl, da sie eine verlassene Waise ist, als Pflegling betrachtet werden müssen. Plautius könnte sie dir abtreten, wenn er wollte.«
»Da kennst du aber Pomponia Graecina nicht. Schließlich haben sich beide an sie gewöhnt, als wäre Lygia ihr eigenes Kind.«
»Ob ich Pomponia kenne! Die reinste Zypresse! Wäre sie nicht des Aulus Ehefrau, könnte man sie als Klageweib verdingen. Auch Aulus Plautius kenne ich, und ich glaube, daß er eine gewisse Schwäche für mich hat, obwohl er mit meiner Lebensweise nicht einverstanden ist. Sicher schätzt er mich höher als all die andern, wie zum Beispiel Domitius Afer, Tigellinus und den übrigen Freundestroß Feuerbarts, da ich mich niemals zum Angeber hergegeben habe. Neros Ausführung hat schon oft mein Mißfallen erregt, wenn Seneka und Burrhus noch durch die Finger sahen. Glaubst du, daß ich beim Plautius etwas für dich erreichen könnte, so stehe ich dir zu Diensten.«
»Ich glaube, daß du es kannst. Du hast Einfluß auf ihn und besitzest großen Scharfsinn. Wenn du mit Plautius sprechen wolltest…«
»Du hast zwar eine große Meinung von meinem Einfluß und meiner Klugheit, und wenn es sich um sonst nichts handelt, so will ich mit Plautius reden, sobald er in die Stadt übergesiedelt ist.« »Sie sind schon seit zwei Tagen hier.«
»So wollen wir in das Triklinium gehen, wo das Frühstück unser harrt, und dann lassen wir uns neugestärkt zu Plautius tragen.« »Du warst mir immer lieb,« rief Vinicius lebhaft, »jetzt aber möchte ich am liebsten hier in diesem Raume deine Bildsäule aufstellen – so schön wie diese hier – und ihr Opfer darbringen.« So sprechend wandte er sich den Statuen zu, welche eine Seitenwand der duftdurchschwängerten Lichthalle zierten, und wies mit der Hand auf eine Bildsäule des Petronius, die ihn als Hermes mit einem goldenen Stab in der Hand darstellte.
Dann sagte er weiter: »Beim Lichte des Helios, wenn der göttliche Alexander dir ähnlich gewesen ist, dann kann man sich über Helena nicht wundern.«
Dieser Ausruf enthielt ebensoviel Wahrheit als Schmeichelei, denn Petronius, wenn auch älter und minder athletisch gebaut, war noch schöner als Vinicius. Die Frauen in Rom bewunderten an ihm nicht nur die geistige Gewandtheit und den seinen Geschmack, der ihm den Beinamen Arbiter elegantiarum eingebracht hatte, sondern auch die Wohlgestalt seiner Erscheinung. Tiefe Bewunderung drückte sich auf den Gesichtern der Mädchen aus Kos aus, welche jetzt die Falten seiner Toga ordneten, von denen besonders eine, Eunike mit Namen, ihm voll Demut und Entzücken in die Augen schaute; liebte sie ihn doch insgeheim.
Er achtete jedoch nicht darauf sondern lächelte Vinicius zu. Dann schlang er seinen Arm um seinen Nacken und führte ihn in den Speisesaal.
Im Unctuarium blieb nur Eunike zurück, hob den mit Bernstein und Elfenbein kunstvoll eingelegten Stuhl, auf welchem Petronius gesessen, und rückte ihn vorsichtig bis zu dessen Bildsäule. Sie bestieg den Stuhl, und als sie in gleicher Höhe mit der Bildsäule war, schlang sie plötzlich die Arme um den Hals, dann warf sie ihr Goldhaar zurück, schmiegte ihren rosigen Leib an den weißen Marmor und preßte voll Leidenschaft ihren Mund auf die kalten Lippen des Petronius.
2.
Nach dem Frühstück schlug Petronius einen kleinen Schlummer vor. Seiner Ansicht nach war es noch zu früh, um Besuche zu machen. Am geeignetsten erschienen ihm dazu die Nachmittagsstunden, aber nicht eher, als bis die Sonne den Tempel des Kapitolinischen Zeus überstiegen hatte und die Strahlen schräg auf das Forum fielen. Inzwischen könnten sie, meinte er, ruhig ein Schläfchen machen. Es sei so angenehm, im Atrium dem Geplätscher des Brunnens zu lauschen und nach den üblichen tausend Schritten in dem rötlichen Lichte, welches durch den purpurnen, halbzugezogenen Vorhang drang, vor sich hinzuträumen.
Vinicius gab Petronius recht, und sie begannen auf und ab zu schreiten, über die neuesten Vorkommnisse in der Stadt und auf dem Palatinus plaudernd oder auch philosophische Bemerkungen austauschend. Hierauf begab sich Petronius in das Schlafzimmer, schlief jedoch nicht lange. Schon nach einer halben Stunde kam er wieder zum Vorschein, ließ sich Verbenaöl bringen und rieb sich damit Hände und Schläfen ein.
»Du glaubst nicht, wie sehr das belebt und erfrischt,« bemerkte er. »So, jetzt bin ich fertig.«
Die Sänfte stand schon längst bereit; sie stiegen ein und ließen sich nach dem Vicus Patricius, ins Haus des Aulus, tragen. Das Haus des Petronius lag an dem südlichen Abhang des Palatinus, unfern des von den reichsten Leuten bewohnten Stadtteils Carinae. Der kürzeste Weg dahin führte unterhalb des Forums, aber Petronius wollte noch beim Juwelier Idomen vorsprechen und befahl, über den Vicus Apollinis und über das Forum gegen den Vicus Sceleratus zu gehen, an dessen Ecke sich die mannigfachsten Verkaufsläden befanden.
Riesige Mohren hoben die Sänfte und setzten sich in Bewegung, voraus gingen Sklaven, pedisequi genannt. Petronius hielt die nach Verbenaöl duftenden Finger vor die Nasenlöcher und schien nachzusinnen, dann sagte,er: »Es fällt mir eben ein, daß deine Waldnymphe, wenn sie keine Sklavin ist, das Haus des Plautius verlassen und in das deine übersiedeln könnte. Du müßtest sie natürlich mit Liebesbeweisen, mit Reichtümern überhäufen, wie ich meine vergötterte Chrysotemis, die ich, unter uns gesagt, mindestens schon ebenso satt habe wie sie mich.«
Markus schüttelte das Haupt.
»Also nicht?« fragte Petronius. »Du würdest bei dieser Angelegenheit schlimmstenfalls eine Stütze am Kaiser finden, und du kannst versichert sein, daß unser Feuerbart, infolge meines Einflusses, auf deiner Seite wäre.«
»Du kennst Lygia nicht!« versetzte Vinicius.
»So gestatte mir die Frage: Kennst du sie anders als vom Sehen? Hast du mit ihr gesprochen? Hast du ihr deine Liebe gestanden?«
»Ich sah sie zuerst am Springbrunnen, und dann traf ich nur zweimal mit ihr zusammen. Du mußt wissen, daß ich während meines Aufenthaltes auf dem Landsitze des Aulus in einer Seitenvilla wohnte, welche für Gäste bestimmt ist, und da ich den Arm verstaucht hatte, konnte ich an den gemeinschaftlichen Mahlzeiten nicht teilnehmen. Erst am Vorabend meines Weggangs traf ich Lygia bei der Mahlzeit, konnte jedoch kein Wort mit ihr sprechen. Ich mußte anhören, was mir Aulus von seinen in Britannien erfochtenen Siegen erzählte und dann von dem Niedergang der kleinen Leute in Italien, welchem zu steuern sich Licinius Stolo bemühte. Dann sah ich Lygia wieder bei der Zisterne im Garten; sie hielt ein eben ausgerissenes Schilfrohr in der Hand, dessen Kolben sie ins Wasser tauchte, um die im Umkreise wachsenden Irisblumen damit zu besprengen. Beim Schilde des Herakles, ich sage dir, meine Knie zitterten nicht, als die heulenden Parther wie ein finsteres Gewölk auf unsere Schlachtreihen losstürmten, aber sie zitterten bei jener Zisterne. Verwirrt wie ein Knabe flehte ich nur mit den Augen um Erbarmen. Lange vermochte ich kein Wort hervorzubringen.«
Petronius warf dem jungen Mann einen Blick zu, in dem etwas wie Neid lag. »Du Glücklicher!« rief er aus. »Welt und Leben mögen schlecht sein wie sie wollen, eines in ihnen bleibt doch ewig gut: die Jugend!« Nach einer Weile fragte er wieder: »Und du hast sie nicht angesprochen?«
»O doch! Ich rang nach Fassung, und als ich wieder zur Besinnung gekommen war, sprach ich mit ihr. Aus Asien, sagte ich ihr, sei ich zurückgekehrt und habe mir ganz nahe vor der Stadt den Arm verstaucht. Große Schmerzen habe ich erdulden müssen; da aber die Zeit gekommen sei, dieses gastliche Haus verlassen zu sollen, sei ich zu der Einsicht gekommen, daß es besser sei, hier zu leiden, als anderswo zu genießen. Sie hörte mich an, gleichfalls verwirrt, mit gesenktem Köpfchen, während sie mit dem Schilf etwas in den safrangelben Sand zeichnete. Dann blickte sie flüchtig empor, ließ ihre Augen von den gemachten Zeichen zu mir schweifen, als wollte sie etwas fragen – und entfloh dann plötzlich.«
»Sie muß schöne Augen haben.«
»Wie das Meer – ich versenkte mich in sie wie in ein Meer. Nach wenigen Augenblicken kam der kleine Plautius auf mich zu und wollte etwas fragen. Ich aber verstand nicht, um was es sich handelte.«
»O du Frühlingsknöspchen am Baume des Lebens! Du erstes, grünes Ästchen an der Weinranke! Ich sollte dich eigentlich statt zum Plautius in das Haus des Gelocius bringen lassen, wo eine Schule für lebensunkundige Knaben ist.«
»Ja, was willst du denn eigentlich?«
»Und was schrieb sie denn in den Sand? War es vielleicht ein von einem Pfeile durchbohrtes Herz oder ähnliches? Wie konntest du solche Zeichen unbeachtet lassen!«
»Länger trage ich die Toga, als du glaubst, und ehe noch der kleine Plautius dazukam, hatte ich die Zeichen längst geprüft. Ich wußte auch, daß die griechischen und römischen Jungfrauen oft ein Geständnis in den Sand graben, das sie nicht aussprechen wollen … Aber errate, was sie zeichnete!«
»Wenn es etwas anderes ist, als ich vermute, so rate ich nicht.«
»Einen Fisch!«
»Wie sagst du?«
»Einen Fisch, sagte ich. Sollte dies vielleicht bedeuten, daß in ihren Adern bisher noch kaltes Blut fließt? Ich weiß es nicht. Du aber, der du mich eine Frühlingsknospe am Baume des Lebens nanntest, wirst dieses Zeichen gewiß besser verstehen.«
»O Teuerster! Über solche Dinge frage Plitius. Er ist Kenner von Fischen. Würde der alte Apicius noch leben, der könnte dir ebenfalls noch etwas erzählen. Dieser hat in seinem Leben mehr Fische gegessen, als ihrer mit einem Male in der Bucht von Neapel Platz haben.«
Das weitere Gespräch ward unterbrochen, denn sie kamen jetzt in belebte Straßen, wo der Menschenlärm es übertönt hätte. Bei dem Vicus Apollinis wendeten sie sich nach dem Boarium und dann nach dem Forum Romanum, wo an schönen Tagen vor Sonnenuntergang sich eine dichte Volksmenge zu versammeln pflegte. Die Leute strömten durch die Säulenhalle, um Neuigkeiten auszutauschen, sie betrachteten die Sänften vornehmer Persönlichkeiten, die vorüber getragen wurden, oder sie drängten sich vor den Gewölben der Händler zusammen. Die eine Hälfte des Forums, die dicht unter den hervorspringenden Felsen des Kastells lag, war schon in Schatten getaucht, während die Säulen der höher gelegenen Tempel in goldenem und bläulichem Schimmer erglänzten. Die tieferstehenden warfen lange Schatten auf die Marmorplatten. Das Forum war derart mit Säulen bebaut, daß das Auge sich darin wie in einem Walde verlor. Häuser und Säulen schienen zusammengehäuft, sie türmten sich übereinander; sie strebten teils der Höhe zu, teils klebten sie an der Felswand des Kapitols.
Von den breiten Stufen des »dem höchsten Gotte« geweihten Tempels kam ein neuer Menschenstrom. Auf den Rednerbühnen ließen sich verschiedene Redner hören. Hie und da ertönten Rufe der Verkäufer, die Früchte, Wein oder mit Feigensaft gemischtes Wasser feilboten, von Quacksalbern, die wunderbare Heilmittel anpriesen, von Wahrsagern, die verborgene Schätze zu entdecken versprachen, und von Traumdeutern. Da und dort hörte man Töne einer ägyptischen Sistra, einer Sambuke oder einer griechischen Flöte; durch den ohrenbetäubenden Tumult sah man Kranke, Fromme, Betrübte, die Opfergaben nach den Tempeln trugen; Taubenschwärme flogen über die Köpfe der Menge und ließen sich auf einem freien Plätzchen des Marktes nieder, gierig die Körner aufpickend, die man ihnen hinwarf, um gleich wieder aufzufliegen, wenn jemand kam. Zwischen den zahlreichen Gruppen drängten sich zeitweise Abteilungen von Soldaten und Wachen durch, welche für Straßenordnung zu sorgen hatten. Die griechische Sprache hörte man überall ebenso oft wie die lateinische, und jede andere Sprache wurde geduldet.
Vinicius, der lange nicht in der Stadt gewesen war, betrachtete mit einer gewissen Neugierde den Menschenschwarm und das Forum Romanum, das die Welt beherrschte, aber zugleich ganz überflutet schien von Menschen fremder Abstammung und Sprache. In der Tat verschwand das heimische Element fast in dieser Masse, die aus den verschiedenartigsten Rassen und Nationen zusammengesetzt war. Man sah hier Äthiopier und blonde Riesen aus dem fernen Norden, Britannier, Gallier und Germanen; man sah Mongolen mit ihren geschlitzten, schiefstehenden Augen, Leute vom Euphrat, Männer vom Indus mit ziegelrot gefärbten Bärten, Syrer von den Ufern des Orontes mit schwarzen, sanftblickenden Augen; knochendürre Wüstenbewohner Arabiens, Juden mit eingefallenem Brustkorb, Ägypter mit dem ewig gleichgültigen Lächeln auf den Gesichtern, Numidier und Afrikaner; Griechen aus Hellas, welche gleich den Römern über die Stadt herrschten, die aber wegen ihres Wissens, ihrer Kunst, ihres Verstandes und ihrer Verschlagenheit zu solcher Macht gekommen waren, Griechen von den kleinasiatischen Inseln, aus Ägypten, aus Italien und dem narbonnensischen Gallien. Bei der großen Schar von Sklaven mit durchlöcherten Ohren mangelte es auch nicht an freigelassenen, müßigen Leuten, welche der Kaiser unterhielt, nährte, sogar kleidete. Es fehlte auch nicht an Schacherern und Priestern der Isis, auf deren Altar mehr Opfer dargebracht wurden als in dem Heiligtum des Zeus auf dem Kapitol – es mangelte nicht an Priestern der Kybel, die goldene Maisähren in der Hand trugen, an Priestern der Wandergötter, an morgenländischen Tänzerinnen, die grellfarbige Mitra auf dem Haupt, an Amulettenhändlern, an Schlangenbändigern und chaldäischen Magiern, endlich an Leuten ohne irgendwelche Beschäftigung, die sich jede Woche in den diesseits des Tiber gelegenen Getreidespeichern meldeten, sich um Lotterielose in den Zirkussen schlugen, die Nächte in den jeden Augenblick mit Einsturz drohenden Häusern des jenseits des Tiber gelegenen Stadtteils verbrachten, die sonnigen und wärmeren Tage aber in den Kryptoportiken, in den schmutzigen Garküchen der Vorstädte oder vor den Häusern der Reichen, von wo ihnen zuweilen die Reste vom Tische der Sklaven zugeworfen wurden.
Petronius war bei der Menge wohlbekannt. An Vinicius’ Ohr drang fortwährend der Ruf: Das ist er! Das ist er! Man liebte ihn wegen seiner Freigebigkeit, und seine Popularität hatte sich noch gesteigert, als man erfuhr, daß er sich vor dem Kaiser gegen das Todesurteil ausgesprochen hatte, welches über die ganze Familia des Präfekten Pedanius Secundus, ohne Unterschied des Alters und Geschlechts, verhängt worden war, weil einer von ihnen in einem Anfall von Verzweiflung den Tyrannen getötet hatte. Petronius erklärte zwar öffentlich, daß ihm die Sache höchst gleichgültig sei und er sich nur in seiner Eigenschaft als Arbiter elegantiarum dagegen ausgesprochen habe, weil sich sein ästhetisches Gefühl durch das barbarische Urteil beleidigt fühle, das vielleicht roher Skythen, niemals aber römischer Männer würdig sei. Das über dieses Blutbad aufgeregte Volk liebte Petronius seit dieser Zeit trotzdem.
Aber er achtete nicht darauf, denn er erinnerte sich, daß dieses Volk auch den Britannicus geliebt, welchen Nero vergiften, und Agrippina, welche er ermorden ließ, und Octavia, die man erwürgte, nachdem man ihr vorher im heißen Dampfbade die Adern geöffnet, Rubelius Plautius, der ausgewiesen wurde, und Traseas, dem schon der morgige Tag das Todesurteil bringen konnte. Die Liebe des Volkes konnte eigentlich als schlechte Vorbedeutung gelten, und der skeptische Petronius war abergläubisch. Zudem verachtete er die Menge als Aristokrat und als Ästhetiker. Diese Leute, die in dem bauschigen Teil ihres Gewands geröstete Bohnen bei sich trugen, nach denen sie rochen, diese Leute, die fortwährend heiser und schweißtriefend waren durch das Moraspiel an den Straßenecken und in den Säulengängen, verdienten in seinen Augen nicht Menschen genannt zu werden.
Ohne daher die Beifallsrufe und Kußhände, die ihm da und dort zugeworfen wurden, zu beachten, erzählte er dem Markus die Geschichte des Petanius und spottete über die Wandelbarkeit des Straßenpöbels, der am Tage nach einem drohenden Aufruhr dem Nero auf seiner Fahrt zum Tempel des Jupiter Stator zugejubelt hatte.
Vor dem Buchladen des Arvinus ließ Petronius halten und kaufte ein zierliches Manuskript, welches er Vinicius überreichte. »Ein Geschenk für dich«, erklärte er.
»Danke dir!« versetzte Vinicius, und mit einem Blick auf den Titel bemerkte er fragend:
»Satirikon? Das ist etwas Neues. Von wem denn?«
»Von mir, doch will ich nicht in die Fußstapfen des Rufinus treten, dessen Geschichte ich dir erzählen wollte, noch in die des Fabricius Veiento, ich bitte dich also, mich nicht zu verraten, denn kein Mensch weiß davon.«
»Aber du sagtest doch, du schriebest keine Verse?« fragte Vinicius, einen Blick in das Manuskript werfend. »Hier aber finde ich die Prosa stark mit Versen durchflochten.«
»Wenn du es lesen wirst, richte deine Aufmerksamkeit vor allem auf das Gastmahl des Trimalchion. was die Verse anlangt, so sind sie mir von dem Augenblick an verleidet, seit Nero ein Epos schrieb. Aber ich wollte dir ja die Geschichte des Rufinus erzählen, um dir zu zeigen, was Autoreneitelkeit ist.«
Doch ehe er noch begonnen hatte, bogen sie in den Vicus Patricius ein und befanden sich gleich darauf vor der Behausung des Aulus. Ein junger, kräftiger Türhüter öffnete ihnen die Tür, über der eine in einem Käfig eingeschlossene Elster in einem Bauer hing, die die Angekommenen mit einem lauten »Salve!« begrüßte.
Auf dem Wege aus der zweiten Vorhalle in das Atrium sagte Vinicius: »Hast du bemerkt, daß der Türhüter hier keine Ketten trägt?«
»Ein merkwürdiges Haus«, versetzte halblaut Petronius. »Es ist dir gewiß bekannt, daß Pomponia Graecina im Verdachte steht, Bekennerin eines Aberglaubens zu sein, der aus dem Osten kommt und auf der Verehrung eines gewissen ›Christos‹ beruht. Crispinilla ist die Urheberin dieses Verdachts gegen Pomponia. Jene kann es ihr nicht verzeihen, daß sie sich mit einem Manne für ihr ganzes Leben begnügte. Eine Schüssel eßbarer Pilze aus Noricum dürfte heutzutage leichter zu haben sein, als eine zweite derartige Frau zu finden. Man hat sogar Hausgericht über sie abgehalten…«
»Du hast recht, es ist ein merkwürdiges Haus. Später erzähle ich dir noch, was ich gesehen und gehört habe.«
So sprechend waren sie im Atrium angelangt. Der die Aufsicht darüber führende Sklave, der Atriensis, sandte den Nomenklator weg, um die Gäste anzumelden, während die andern Diener Sessel und Fußschemel für sie zurechtstellten. Petronius, der sich vorstellte, in diesem Hause herrsche ewig Trübsinn – da er nie in diesem Hause verkehrte –, blickte mit einem gewissen Staunen, ja, mit einem Gefühl der Enttäuschung umher, denn das Atrium machte einen durchaus heiteren Eindruck.
Aus der Höhe drang durch die zweite Öffnung eine helle Lichtgarbe, die an dem Springbrunnen in tausend Funken zerstäubte. Der viereckige Teich, in dessen Mitte der Springquell emporsprudelte, war von Anemonen und Lilien umgeben. Besonders für Lilien schien eine Vorliebe im Hause zu herrschen; es gab deren ganze Büsche; weiße und feuerfarbige Lilien und violette Irisblumen, deren zarte Blütenblätter unter dem zerstäubenden Wasser wie versilbert erschienen. Durch das feuchte Moos, mit welchem die Lilienblätter bedeckt waren, und durch die Blätterbüschel sah man Bronzestatuetten hervorschimmern, welche Kinder und Wasservögel darstellten. An einer Ecke stand, gleichfalls aus Bronze, eine Hirschkuh, die ihren durch die Feuchtigkeit von Rost grünlich gewordenen Kopf gegen das Wasser neigte, als ob sie trinken wollte. Der Fußboden des Atriums war aus Mosaik, die Wände, teils mit rotem Marmor ausgelegt, teils mit Bäumen, Fischen, Vögeln und Greifen bemalt, erfreuten das Auge durch ihre Farbenpracht. Die Füllungen an den zu den anstoßenden Räumen führenden Türen waren teils mit Schildkrot, teils mit Elfenbein verziert; an den Wänden, zwischen den Türen, standen die Statuen der Vorfahren des Aulus. In allem verriet sich eine gewisse gediegene Wohlhabenheit, frei von jedem Luxus, aber überall ein vornehmes Selbstbewußtsein.
Petronius, der zwar viel prächtiger eingerichtet war, fand hier doch nichts, was seinen Geschmack beleidigt hätte, und er wollte sich gerade mit einer Bemerkung darüber an Vinicius wenden, als der Türsteher den Vorhang zur Seite schob, welcher das Atrium von dem Tablinum trennte, und aus der Tiefe des Hauses sich Aulus Plautius eiligen Schritts näherte.
Aulus war ein in vorgerückten Jahren stehender Mann mit schon ergrauten Haaren; aber er war noch sehr rüstig und frisch, und sein etwas zu kurzes Gesicht mit dem an einen Adler erinnernden Profil deutete auf einen energischen Charakter. Jetzt aber malte sich etwas wie Erstaunen, ja wie Unruhe auf seinen Zügen über den unerwarteten Besuch des Freundes, Gefährten und Vertrauten Neros.
Petronius war zu sehr Weltmann und zu scharfsinnig, als daß er dies nicht bemerkt hätte. Nach den ersten Begrüßungen versicherte er daher auch mit aller Unbefangenheit und Liebenswürdigkeit, die ihm zu Gebote stand, daß er gekommen sei, für die freundliche Pflege, die seinem Schwestersohn in diesem Hause zuteil geworden, zu danken. Sein Besuch, zu dem er sich übrigens durch seine lange Bekanntschaft mit Aulus berechtigt gefühlt habe, sei einzig und allein auf diesen Grund zurückzuführen.
Aulus versicherte seinerseits, daß er ihm ein lieber Gast sei, und was die Dankbarkeit beträfe, so hege er selbst etwas dergleichen für Petronius, wenn auch dieser vielleicht den Grund nicht erraten würde.
»Du hast nämlich dem Vespasian, den ich schätze und liebe, das Leben gerettet, als er das Unglück hatte, bei einer Vorlesung der Gedichte des Kaisers einzuschlafen.«
»Ein Glück für ihn,« versetzte Petronius, »denn auf die Art hat er sie wenigstens nicht gehört. Ich will auch zugeben, daß die Sache für ihn hätte unglücklich ausfallen können. Der Feuerbart wollte durchaus einen Centurio zu ihm schicken, mit dem freundschaftlichen Auftrag, er möchte sich die Adern öffnen.«
»Du aber, Petronius, lachtest ihn aus.«
»So ist es, oder vielmehr ich sagte ihm, wenn Orpheus durch seinen Gesang die wilden Tiere eingeschläfert habe, sei sein Triumph kein geringerer, wenn es ihm gelang, Vespasian einzuschläfern. Man darf ja den Feuerbart tadeln, vorausgesetzt, daß der Tadel sich auch als Schmeichelei auffassen läßt. Unsre huldreiche Augusta Poppäa versteht dies ausgezeichnet.«
»Ja, leider, das sind jetzt schlimme Zeiten,« erwiderte Aulus. »Mir fehlen zwei Vorderzähne, die mir ein von Britannenhand geschleuderter Stein einschlug, und seither zische ich; aber die glücklichste Zeit meines Lebens habe ich doch in Britannien zugebracht.«
»Weil es eine siegreiche Zeit war,« warf Vinicius ein.
Petronius befürchtete, der alte Feldherr möchte von seinen Schlachten berichten, und änderte schnell den Gesprächsgegenstand. Er erzählte, daß Landleute bei Präneste einen toten jungen Wolf mit zwei Köpfen gefunden hätten, daß der Blitz einen Eckpfeiler des Lunatempels beschädigt habe, und daß einige Priester das für ein böses Zeichen hielten und den Untergang Roms prophezeiten.
Aulus hörte aufmerksam zu und sagte, daß man solche Zeichen nicht so leicht aufnehmen dürfe. Die Götter können über die Greueltaten erzürnt sein, dies wäre auch nicht zu verwundern – und in so einem Falle wären die Opfer angebracht.
Petronius begann nunmehr die Besitzung des Plautius sowie auch den guten Geschmack, der sich in der ganzen Ausstattung verriet, zu loben.
»Ein alter Familiensitz ist das,« versetzte Plautius, »in welchem ich seit meiner Inbesitznahme nichts geändert habe.«
Der Vorhang zwischen dem Atrium und dem Tablinum wurde nunmehr zurückgeschoben, und man konnte durch mehrere Räume hindurch in den Garten blicken, der in der Ferne wie ein helles Bild in dunklem Rahmen aussah. Fröhliches Kinderlachen drang von dort bis ins Atrium.
»O Feldherr,« rief Petronius, »gestatte uns, dieses fröhliche Lachen in der Nähe anzuhören, es ist eine Seltenheit heutzutage.«
»Recht gern,« sagte Plautius, sich erhebend. »Mein kleiner Aulus und Lygia ergötzen sich beim Ballspiel. Was aber das Lachen anbelangt, Petronius, so glaubte ich, dein ganzes Leben ginge unter Lachen dahin.«
»Das Leben ist des Lachens wert, deshalb lache ich,« entgegnete Petronius, »jedoch klingt dies Lachen anders.«
»Petronius«, fügte Vinicius hinzu, »lacht weniger bei Tage, aber um so mehr bei der Nacht.«
So plaudernd durchschritten sie das Haus und gelangten in den Garten, wo Lygia und der kleine Aulus mit Bällen spielten, welche von ausschließlich zu dieser Unterhaltung bestimmten Sklaven, Spheristae genannt, vom Boden aufgelesen und immer wieder den Spielenden überreicht wurden. Petronius warf einen raschen Blick auf Lygia, während der kleine Aulus, als er Vinicius erblickte, auf diesen zulief. Der junge Mann aber neigte im Vorüberschreiten das Haupt vor dem lieblichen Mädchen, das, den Ball in der Hand, mit etwas gelösten Haaren noch ganz atemlos und errötend dastand.