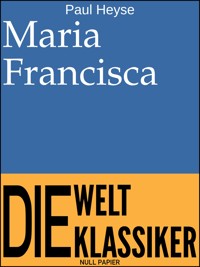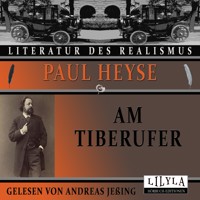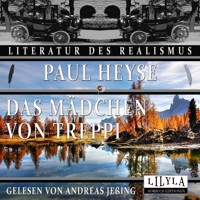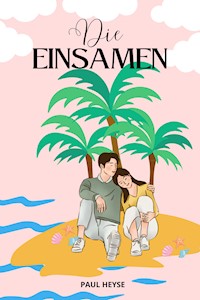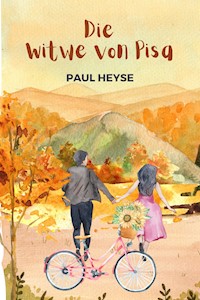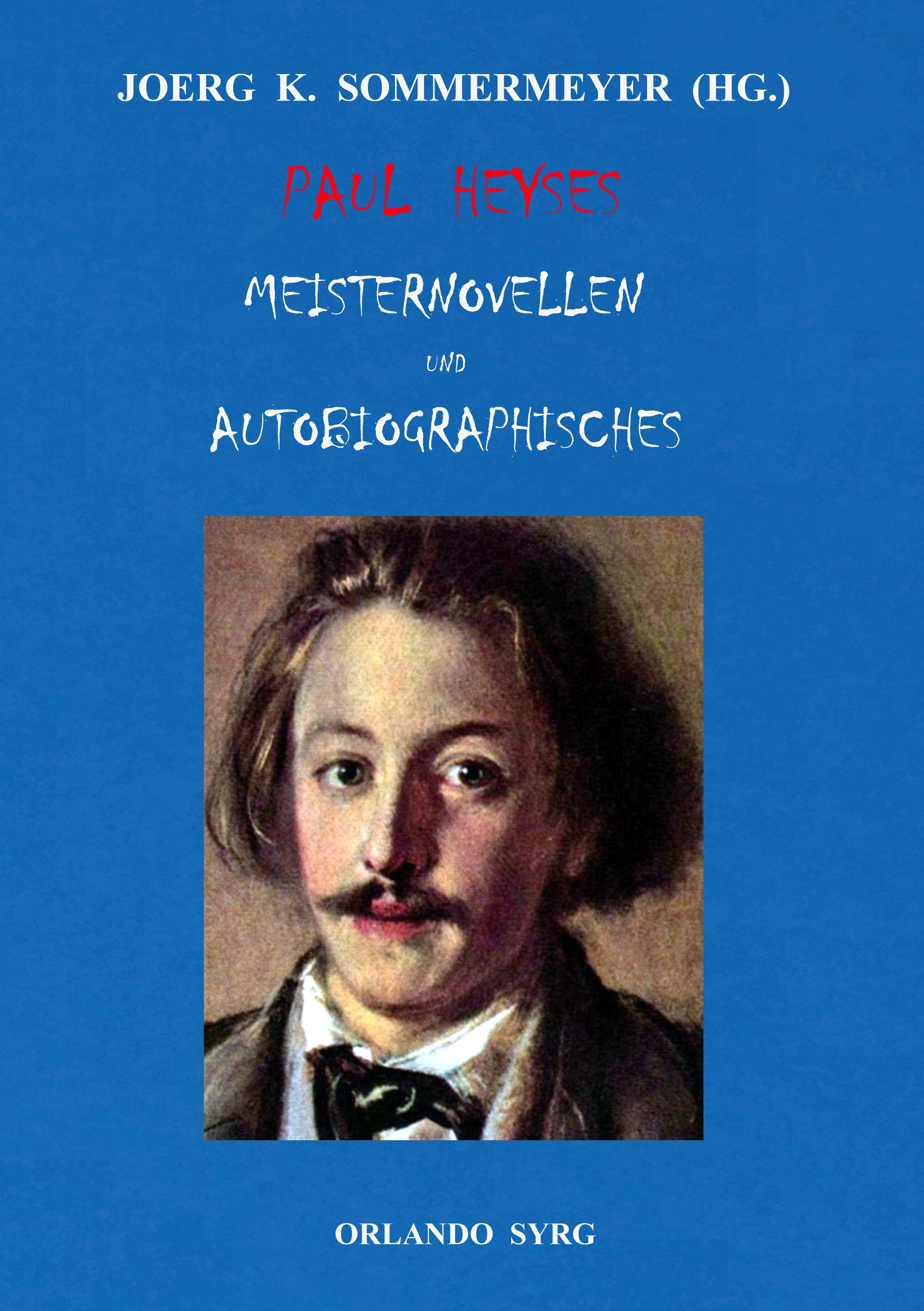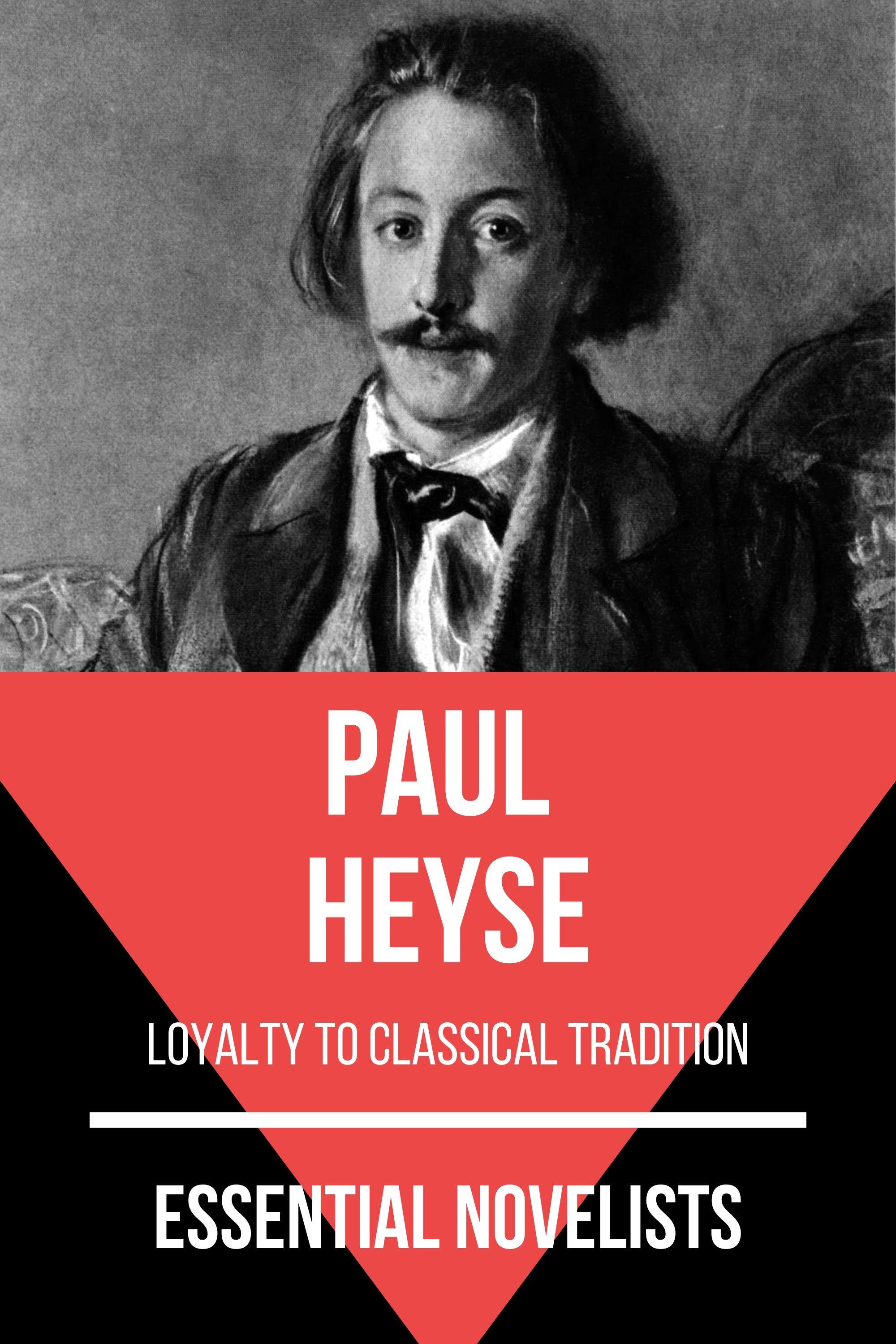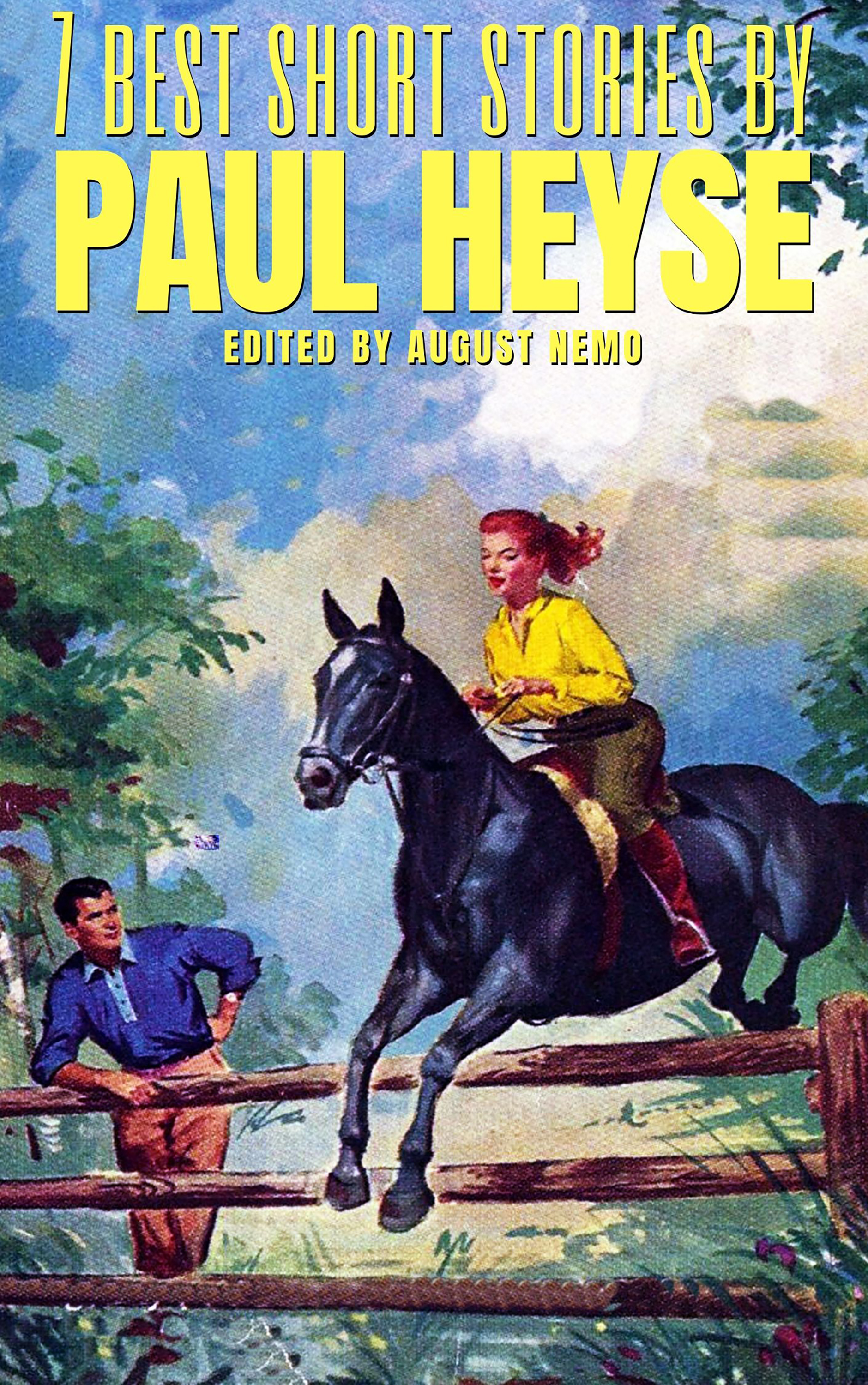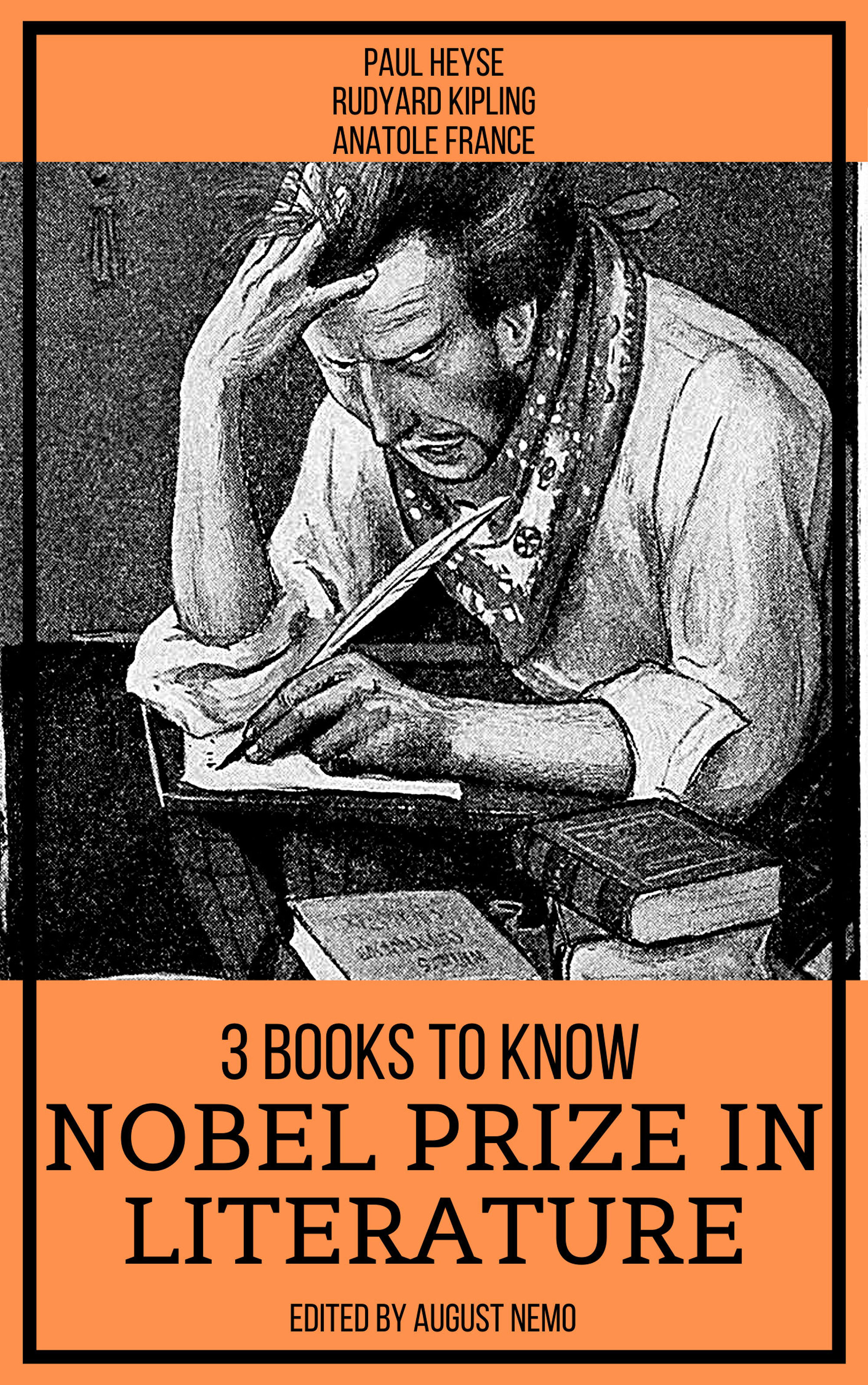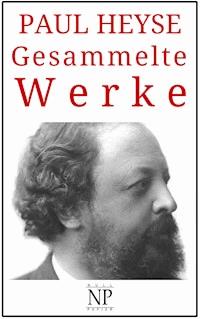
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Mit Index Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 4325
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Paul Heyse – Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
Paul Heyse
Paul Heyse – Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-04-4
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Biographisches
Leben
Werk
Andrea Delfin
1
2
3
4
Am Tiberufer
Anfang und Ende
Barbarossa
Beatrice
Das Bild der Mutter
Das Glück von Rothenburg
Das Mädchen von Treppi
Der Kinder Sünde, der Väter Fluch
Der Kreisrichter
Der letzte Zentaur
Der Weinhüter
Die Blinden
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Die Einsamen
Die kleine Mama
Die Pfadfinderin
Die Witwe von Pisa
Ein Ring
Erkenne dich selbst
Im Grafenschloss
In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten
Widmung
In der Geisterstunde
Martin der Streber
Das Haus »Zum ungläubigen Thomas«
Kleopatra
L’Arrabbiata
Maria Francisca
Marienkind
Marion
Neue Moralische Novellen
Widmung
Jorinde
Getreu bis in den Tod
Die Kaiserin von Spinetta
Das Seeweib
Die Frau Marchesa
Novellen in Versen
Die Braut von Cypern.
Die Brüder.
König und Magier.
Margherita Spoletina.
Urica.
Die Furie.
Rafael.
Michelangelo Buonarotti.
Die Hochzeitsreise an den Walchensee.
Novellen vom Gardasee
Widmung
Gefangene Singvögel
Die Macht der Stunde
San Vigilio
Entsagende Liebe
Eine venezianische Nacht
Antiquarische Briefe
Spielmannslegende
Troubadour-Novellen
Widmung
Der lahme Engel
Die Rache der Vizegräfin
Die Dichterin von Carcassonne
Der Mönch von Montaudon
Ehre über Alles
Der verkaufte Gesang
Unheilbar
Unvergessbare Worte
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Biographisches
Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die »Breite seiner Produktion«. Der einflussreiche Münchner »Dichterfürst« unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt.
1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen »geben würde und ein Heysesches Zeitalter« dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur.
Leben
Heyse wird am 15. März 1830 in Berlin geboren. Sein Vater Karl Wilhelm Ludwig Heyse ist Professor für Klassische Philologie und Allgemeine Sprachwissenschaft. Die Mutter Julie Heyse stammt aus einer wohlhabenden und kunstliebenden Familie. Im Elternhaus trifft sich die kulturelle Spitze der Stadt. Er besucht das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium. Sein Abitur erzielt er mit Bestnoten.
1846 lernt er seinen späteren Mentor, den 15 Jahre älteren Dichter Emanuel Geibel kennen, der damals große Popularität genießt. Zwischen den beiden Schriftstellern entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. Über Geibel lernt Heyse auch seine spätere Ehefrau kennen.
Nach dem Abitur beginnt Paul Heyse 1847 in Berlin mit dem Studium der Klassischen Philologie. 1848 werden erste Gedichte von ihm veröffentlicht. Er kommt in Kontakt mit Jacob Burckhardt, Adolph Menzel, Theodor Fontane und Theodor Storm.
Nach zwei Jahren Studium in Berlin wechselt er im April 1849 nach Bonn, um an der dortigen Universität Kunstgeschichte und Romanistik zu studieren. 1850 entscheidet er sich endgültig, Dichter zu werden. Wegen einer Liebesaffäre mit der Frau eines seiner Professoren muss Heyse aber nach Berlin zurückkehren. Im selben Jahr erscheint sein Debüt »Der Jungbrunnen«, das er aber anonym veröffentlicht.
Sein erster Roman »Marion« wird 1852 ausgezeichnet. Ebenfalls 1852 übersetzt er erstmalig Texte von Geibel für ein Liederbuch ins Spanische. Zeit seines Lebens soll er auch als hervorragender Übersetzer (besonders für Italisch) zu Ruhm gelangen.
Nach einer Promotion 1852 unternimmt Heyse erste Reisen nach Italien, dem Land, dem er für immer verbunden bleiben wird – nicht zuletzt auch in seinen Werken.
Unter dem Einfluss der italienischen Landschaft verfasst er Werke, die ihn als Schriftsteller berühmt machen sollen, u.a. die Tragödie »Francesca von Rimini«, seinen berühmtesten Roman, »L’Arrabbiata« (1853) und seine »Lieder aus Sorrent« (1852/53).
Heyse ist ein »Wiederentdecker Italiens«. Er nennt Italien und Deutschland seine beiden Herkunftsländer. Er verschafft der neueren, italienischen Literatur – nicht zuletzt durch seine kongenialen Übersetzungen – Gehör und trägt mit seinen Veröffentlichungen und seiner Mitarbeit an verschiedensten Anthologien viel zum Austausch beider Kulturen bei.
Durch Vermittlung seines Freundes Geibel wird der bayerische König Maximilian II. auf Heyse aufmerksam. Maximilian heuert ihn für eine staatliche Leibrente als eine Art literarischen Berater, Übersetzer, Reisebegleiter und Vorleser an. Es folgt 1854 der Umzug nach München. Im jungen Alter von 24 hat es Heyse so schon zu beachtlichen Erfolg gebracht.
Seine Frau Margaretha, geborene Kugler, schenkt Heyse vier Kinder. Das Erstgeborene, Franz, kommt 1855 zur Welt. Am 30. September 1862 stirbt Margaretha an einer Lungenkrankheit. Heyse heiratet 1867 erneut.
1868 überwirft sich Heyse mit König Maximilian und verzichtet daraufhin auf seine jährliche Rente. Heyse ist ein Mann der Mitte, ein liberal gesinnter Anhänger Bismarcks. Wie viele seiner Schriftstellerkollegen setzt er große Hoffnungen auf die Reichsgründung. In Kaiser Wilhelm II. sieht Heyse eine Gefahr für das Land. Und trotz seiner Bewunderung für Bismarck teilt er dessen negative Ansichten über die aufkommende Sozialdemokratie in Deutschland nicht.
Heyse ist zu seiner Zeit ein literarischer Fixstern in Deutschland. In München gilt er nicht nur als schriftstellerisches Vorbild und einflussreicher Kunstkenner, sondern auch als beliebter Gastgeber. Er engagiert sich für die rechtlichen und sozialen Belange seines Berufsstandes und ist als Mäzen tätig. Heyse bietet zahlreichen zeitgenössischen Autoren Hilfe und Freundschaft an. Immer wieder ermutigt er zum Beispiel den schwäbischen Dichter Hermann Kurz und bearbeitet nach seinem Tod dessen Gesamtausgabe.
Viele jüngere Schriftsteller können ihm den Respekt vor seinem facettenreichen Werk nicht verwehren: »Vielleicht nur noch Maupassant gab mir technisch und stilistisch so viel Vorbildliches wie Paul Heyse«, schreibt zum Beispiel Ludwig Ganghofer. Viele, erst nach seinem Tode aktive Autoren des noch jungen 20. Jahrhunderts, von Thomas Mann bis Isolde Kurz, gehören zu seinen Lesern.
Im Jahre 1856 ist Heyse maßgeblich an der Gründung des Dichterverbandes »Die Krokodile« beteiligt. Das Ziel ist die Schaffung eines literarischen Salons, um sich auch mit jüngeren Dichtern und Autoren auszutauschen. Im Verein, der sich wie eine Geheimloge geriert, werden Vorträge und Diskussionen feierlich zelebriert. Zu den bekannteren Mitgliedern zählen neben Geibel und Heyse die Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riehl, Felix Dahn, Wilhelm Hertz, Hermann Lingg, Franz von Kobell, Friedrich Bodenstedt, der Komponist Robert von Hornstein und der Reiseschriftsteller und Kunstmäzen Adolf Friedrich von Schack.
Im Jahre 1900 veröffentlicht Heyse seine Jugenderinnerungen. Er wird Ehrenvorsitzender des Deutschen Goethe-Verbandes und Ehrenmitglied der Deutschen Schiller-Stiftung. Zu seinem 70. Geburtstag erscheinen Sonderausgaben, Alben und zahlreiche Publikationen.
Die Stadt München ernennt Heyse 1910 anlässlich seines 80. Geburtstages zum Ehrenbürger der Stadt. Er wird geadelt, nutzt den Titel aber nie. Am 10. Dezember erhält Heyse den Nobelpreis für Literatur.
Heyse, der letzte große Erzähler des 19. Jahrhunderts, stirbt am 2. April 1914, wenige Monate vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Werk
Heyse wird einer der berühmtesten Dichter seiner Zeit. Allein vom Gedicht »Im Walde« sind 32 vertonte Versionen bekannt. Heyses Gedichte können sich in den Augen seiner Dichterkollegen mit den hochgeschätzten Balladen eines Fontane messen.
Die insgesamt 177 Novellen sind als wichtigster Teil des Gesamtwerkes anzusehen, obwohl Heyse sie als Nebenprodukt seines Schaffens betrachtet. »Andrea Delfin« oder »Die Stickerin von Treviso« gehören neben den Novellen Storms zu den Besten in diesem Genre. Die Qualität der Novellen ist jedoch sehr uneinheitlich, was Heyse selbst in seiner Autobiografie »Jugenderinnerungen und Bekenntnisse« eingesteht.
Die Geschichten werden von Heyse nach sorgfältiger Planung auf einen Schlag niedergeschrieben, im Druckprozess werden dann nur flüchtige Fehler korrigiert und einige Wörter durch passendere ersetzt.
Sein Werk ist unpolitisch; er vertritt einen künstlerischen Idealismus: Die Kunst soll »vergolden und veredeln« und die Gegenwart »im Licht der Ewigkeit« darstellen. Seine Helden sind of »schöne Seelen«, vorbildliche, künstlerisch sensible, junge Menschen und selbstlose Heroinen. Und meist müssen diese dann an der Härte der Realität verzweifeln und scheitern. Die Novelle »Andrea Delfin« beschäftigt sich mit dem Thema des »gerechten Rächers«, der durch seine Taten nur neue Ungerechtigkeit schafft.
International bekannt wird Heyse durch seinen ersten Roman »Kinder der Welt« (1873). Er zeichnet darin die Figur des Franzelius, eines Sozialisten, der eine bürgerliche Karriere für seine utopischen Ideale aufgibt. Das sechsbändige Frühwerk erregt erstes, großes Aufsehen und inspiriert besonders junge Leser. Seit den 1860er Jahren ist Heyse einer der beliebtesten und meistgelesenen deutschen Autoren. Für bürgerliche Kreise gilt er als ein schriftstellerisches Ideal, mithin als legitimer Nachfahre Goethes.
Aber um die Jahrhundertwende hat Heyse den Zenit seines Ruhmes überschritten. Die jüngere Schriftstellergeneration verweigert ihm zusehends die Anerkennung. Ringelnatz, der ihn persönlich trifft, verspottet ihn. Im Simplicissimus erscheint er als Karikatur. Den Autoren der Berliner Naturalisten um Gerhart Hauptmann gilt er zusehends als Epigone ohne eigene Kreativität; sie bezeichnen seine Sprache als »geistesarm«, seine Figuren als »flach und reizlos«. Fraglich ist, ob diese Kritik nicht mehr dem Neid als der künstlerischen Auseinandersetzung geschuldet ist.
In Berlin, München und Leipzig werden Straßen nach Heyse benannt. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Autor ist schon längst tot, werden er und sein Werk zur Zielscheibe aufkommender antiliberaler und antijüdischer Tendenzen. Er wird verleugnet, gerät in Vergessenheit. Heute, mehr als hundert Jahre nach seinem Tod, ist trotz seines Erfolges zu Lebzeiten seine Bedeutung hinter der eines Fontanes, Storms oder Kellers zurückgeblieben. Es gilt, ihn neu (wieder) zu entdecken.
Andrea Delfin
1
In jener Gasse Venedigs, die den freundlichen Namen Bella Cortesia trägt, stand um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein einfaches, einstöckiges Bürgerhaus, über dessen niedrigem Portal, von zwei gewundenen hölzernen Säulen und barockem Gesims eingerahmt, ein Madonnenbild in der Nische thronte und ein ewiges Lämpchen bescheiden hinter rotem Glas hervorschimmerte. Trat man in den unteren Flur, so stand man am Fuße einer breiten, steilen Treppe, die ohne Windung zu den oberen Zimmern hinaufführte. Auch hier brannte Tag und Nacht eine Lampe, die an blanken Kettchen von der Decke herabhing, da in das Innere nur Tageslicht eindrang, wenn einmal die Haustür geöffnet wurde. Aber trotz dieser ewigen Dämmerung war die Treppe der Lieblingsaufenthalt von Frau Giovanna Danieli, der Besitzerin des Hauses, die seit dem Tode ihres Mannes mit ihrer einzigen Tochter Marietta das ererbte Häuschen bewohnte und einige überflüssige Zimmer an ruhige Leute vermietete. Sie behauptete, die Tränen, die sie um ihren lieben Mann geweint, hätten ihre Augen zu sehr geschwächt, um das Sonnenlicht noch zu vertragen. Die Nachbarn aber sagten ihr nach, dass sie nur darum von Morgen bis Abend auf dem oberen Treppenabsatz ihr Wesen treibe, um mit jedem, der aus- und einginge, anzubinden und ihn nicht vorüberzulassen, ehe er ihrer Neugier und Gesprächigkeit den Zoll entrichtet habe. Um die Zeit, wo wir sie kennen lernen, konnte dieser Grund sie schwerlich bewegen, den harten Sitz auf der Treppenstufe einem bequemen Sessel vorzuziehen. Es war im August des Jahres 1762. Schon seit einem halben Jahr standen die Zimmer, die sie vermietete, leer, und mit ihren Nachbarn verkehrte sie wenig. Dazu ging es schon auf die Nacht, und ein Besuch um diese Zeit war ganz ungewöhnlich. Dennoch saß die kleine Frau beharrlich auf ihrem Posten und sah nachdenklich in den leeren Flur hinab. Sie hatte ihr Kind zu Bett geschickt und ein paar Kürbisse neben sich gelegt, um sie noch vor Schlafengehen auszukernen. Aber allerlei Gedanken und Betrachtungen waren ihr dazwischen gekommen. Ihre Hände ruhten im Schoß, ihr Kopf lehnte am Geländer, es war nicht das erste Mal, dass sie in dieser Stellung eingeschlafen war.
Sie war auch heute nahe daran, als drei langsame, aber nachdrückliche Schläge an die Haustür sie plötzlich aufschreckten. »Misericordia!«,1 sagte die Frau, indem sie aufstand, aber unbewegliche stehen blieb, »was ist das? Hab’ ich geträumt? Kann er es wirklich sein?«
Sie horchte. Die Schläge mit dem Klopfer wiederholten sich. »Nein«, sagte sie, »Orso ist es nicht. Das klang anders. Auch die Sbirren2 sind es nicht. Lass sehen, was der Himmel schickt.« – Damit stieg sie schwerfällig hinunter und fragte durch die Tür, wer Einlass begehre.
Eine Stimme antwortete, es stehe ein Fremder draußen, der hier eine Wohnung suche. Das Haus sei ihm gut empfohlen; er hoffe, lange zu bleiben und die Wirtin wohl zufrieden zu stellen. Das alles wurde höflich und in gutem Venezianisch vorgetragen, so dass Frau Giovanna, trotz der späten Zeit, sich nicht bedachte, die Tür zu öffnen. Der Anblick ihres Gastes rechtfertigte ihr Vertrauen. Er trug, soviel sie in der Dämmerung sehen konnte, die anständige schwarze Kleidung des niederen Bürgerstandes, einen ledernen Mantelsack unter dem Arm, den Hut bescheiden in der Hand. Nur sein Gesicht befremdete die Frau. Es war nicht jung, nicht alt, der Bart noch dunkelbraun, die Stirn faltenlos, die Augen feurig, dagegen der Ausdruck des Mundes und die Art zu sprechen müde und überlebt, und das kurz geschorene Haar in seltsamem Gegensatz zu den noch jugendlichen Zügen völlig ergraut.
»Gute Frau«, sagte er, »ich habe Euch schon im Schlafe gestört, und sogar vielleicht vergebens. Denn, um es gleich zu sagen, wenn Ihr kein Zimmer habt, das auf einen Kanal hinausgeht, bin ich nicht Euer Mieter. Ich komme von Brescia, mein Arzt hat mir die feuchte Luft Venedigs empfohlen für meine schwache Brust; ich soll überm Wasser wohnen.«
»Nun Gott sei Dank!«, sagte die Witwe, »so kommt doch einmal einer, der unserem Kanal Ehre antut. Ich hatte einen Spanier vorigen Sommer, der auszog, weil er sagte, das Wasser habe einen Geruch, als wären Ratten und Melonen darin gekocht worden! Und Euch ist es empfohlen worden? Wir sagen wohl hier in Venedig:
Wasser vom Kanal. Kuriert radikal.
Aber es hat einen eigenen Sinn, Herr, einen bösen Sinn, wenn man bedenkt, wie manches Mal auf Befehl der Oberen eine Gondel mit Dreien auf die Lagunen hinausfuhr und mit Zweien wiederkam. Davon nichts mehr, Herr – Gott behüt’ uns alle! Aber habt Ihr Euren Pass in Ordnung? Ich könnt’ Euch sonst nicht aufnehmen.«
»Ich hab’ ihn schon drei Mal präsentiert, gute Frau, in Mestre, bei der Wachtgondel draußen und am Traghetto. Mein Name ist Andrea Delfin, mein Stand rechtskundiger Schreiber bei den Notaren, als welcher ich in Brescia fungiert habe. Ich bin ein ruhiger Mensch und habe nie mit der Polizei gern zu schaffen gehabt.«
»Um so besser«, sagte die Frau, indem sie jetzt ihrem Gaste voran die Treppe wieder hinaufstieg. »Besser bewahrt als beklagt, ein Aug’ auf die Katze, das andere auf die Pfanne, und es ist nützlicher, Furcht zu haben als Schaden. O, über die Zeiten, in denen wir leben, Herr Andrea! Man soll nicht drüber nachdenken. Denken verkürzt das Leben, aber Kummer schließt das Herz auf. Da seht, und sie öffnete ein großes Zimmer, ist es nicht hübsch hier, nicht wohnlich? Dort das Bett, mit meinen eigenen Händen hab’ ich’s genäht, als ich jung war, aber am Morgen kennt man nicht den Tag. Und da ist das Fenster nach dem Kanal, der nicht breit ist, wie Ihr seht, aber desto tiefer, und das andere Fenster dort nach der kleinen Gasse, das Ihr zuhalten müsst, denn die Fledermäuse werden immer dreister. Seht da überm Kanal, fast mit der Hand abzureichen, der Palast der Gräfin Amidei, die blond ist wie das Gold und durch ebenso viel Hände geht. Aber hier steh’ ich und schwatze, und Ihr habt noch weder Licht noch Wasser und werdet hungrig sein.«
Der Fremde hatte gleich beim Eintreten das Zimmer mit raschem Blick gemustert, war von Fenster zu Fenster gegangen und warf jetzt seinen Mantelsack auf einen Sessel. »Es ist alles in der besten Ordnung«, sagte er. »Über den Preis werden wir uns wohl einigen. Bringt mir nur einen Bissen und, wenn Ihr ihn habt, einen Tropfen Wein. Dann will ich schlafen.«
Es war etwas seltsam Gebieterisches in seiner Gebärde, so milde der Ton seiner Worte klang. Eilig gehorchte die Frau und ließ ihn auf kurze Zeit allein. Nun trat er sofort wieder ans Fenster, bog sich hinaus und sah den sehr engen Kanal hinab, der durch kein Zittern seiner schwarzen Flut verriet, dass er teilhabe an dem Leben des großen Meeres, dem Wellenschlag der alten Adria. Der Palast gegenüber stieg in schwerer Masse vor ihm auf, alle Fenster waren dunkel, da die Vorderseite nicht dem Kanal zugekehrt war; nur eine schmale Tür öffnete sich unten, dicht über dem Wasserspiegel, und eine schwarze Gondel lag angekettet vor der Schwelle.
Das alles schien den Wünschen des neuen Ankömmlings durchaus zu entsprechen, nicht minder auch, dass man ihm durch das andere Fenster, das nach der Sackgasse ging, nicht ins Zimmer sehen konnte. Denn drüben lief eine fensterlose Wand ohne andere Unterbrechung als einige Vorsprünge, Risse und Kellerlöcher hin, und nur den Katzen, Mardern und Nachtvögeln konnte dieser düstere Winkel angenehm und wohnlich erscheinen.
Ein Lichtstrahl aus dem Flur drang ins Gemach, die Tür öffnete sich, und mit der Kerze in der Hand trat die kleine Witwe wieder ein, hinter ihr die Tochter, die in der Eile noch einmal hatte aufstehen müssen, um beim Empfang des Gastes zu helfen. Die Gestalt des Mädchens war fast noch kleiner als die der Mutter, erschien aber doch durch die höchste Zierlichkeit und kaum gereifte Schlankheit aller Formen größer und wie auf den Fußspitzen schwebend, während man auch im Gesicht dieselbe Ähnlichkeit und denselben Unterschied, der auf Rechnung der Jahre kam, auf den ersten Blick erkannte. Nur der Ausdruck in beiden Gesichtern schien niemals einander ähnlich werden zu können. Es war zwischen den dichten Brauen der Frau Giovanna ein Zug von Spannung und kummervollem Harren, der auch mit den Erfahrungen des Alters auf Mariettas klarer Stirn nie dauernd eine Stätte finden konnte. Diese Augen mussten immer lachen, dieser Mund immer ein wenig geöffnet sein, um jeden Scherz unverzüglich hinauszulassen. Es war unendlich drollig zu sehen, wie jetzt in diesem Gesichtchen Verschlagenheit, Überraschung, Neugier und Mutwille miteinander kämpften. Sie bog beim Eintreten den Kopf, dessen lose Flechten mit einem schmalen Tuch umwunden waren, seitwärts, um den neuen Hausgenossen zu sehen. Auch seine ernste Miene und sein graues Haar stimmten ihre Munterkeit nicht herab. Mutter, flüsterte sie, indem sie einen großen Teller mit Schinken, Brot und frischen Feigen und eine halb volle Flasche Wein auf den Tisch stellte, er hat ein kurioses Gesicht, wie ein neues Haus im Winter, wenn der Schnee aufs Dach gefallen ist.
»Schweig, du schlimme Hexe!«, sagte die Mutter rasch. »Weiße Haare sind falsche Zeugen. Er ist krank, musst du wissen, und du solltest Respekt haben, denn Krankheiten kommen zu Pferde und gehen zu Fuß, und Gott behüte dich und mich, denn die Kranken essen wenig, aber die Krankheit frisst alles. Hole nur ein wenig Wasser, soviel wir noch haben. Morgen müssen wir früh auf und neues kaufen. Sieh, er sitzt da, als ob er schliefe. Er ist müde von der Reise, und du bist müde vom Stillsitzen. So ist die Welt verschieden.«
Während dieser halblauten Reden hatte der Fremde am Fenster gesessen und den Kopf in die Hand gestützt. Auch als er jetzt aufsah, schien er die Gegenwart des zierlichen Mädchens, das ihm eine Verbeugung machte, kaum zu bemerken.
»Kommt und esst etwas, Herr Andrea«, sagte die Witwe. »Wer nicht zu Nacht isst, hungert im Traum. Seht, die Feigen sind frisch, und der Schinken zart, und dies ist Zyperwein, wie ihn der Doge nicht besser trinkt. Sein Kellermeister hat ihn uns selbst verkauft, eine alte Bekanntschaft noch von meinem Mann her. Ihr seid gereist, Herr. Ist er Euch nicht einmal begegnet, mein Orso, Orso Danieli?«
»Gute Frau«, sagte der Fremde, indem er einige Tropfen Wein ins Glas goss und eine der Feigen aufbrach, »ich bin nie über Brescia hinausgekommen und kenne keinen dieses Namens.«
Marietta verließ das Zimmer, und man hörte sie, während sie die Treppe hinunterflog, ein Liedchen mit heller Stimme vor sich hin singen.
»Hört Ihr das Kind?«, fragte Frau Giovanna. »Man hielte sie nicht für meine Tochter, obwohl auch eine schwarze Henne ein weißes Ei legt. Immer singen und springen, als wären wir hier nicht in Venedig, wo es gut ist, dass die Fische stumm sind, weil sie sonst reden würden, was einem das Haar sträubte. Aber so war ihr Vater auch, Orso Danieli, der erste Arbeiter auf Murano, wo sie die bunten Gläser machen, wie nirgend auf der Welt. Ein fröhlich Herz macht rote Wangen, das war sein Spruch. Und darum sagte er eines Tages zu mir, ›Giovannina‹, sagte er, ›ich halt’ es hier nicht aus, die Luft schnürt mir die Kehle zu, gestern erst ist wieder einer erdrosselt und mit dem Fuß an den Galgen gehenkt worden, weil er freie Reden geführt hat gegen die Inquisitoren.3 und den Rat der Zehn4 Man weiß, wo man geboren wird, aber nicht, wo man stirbt, und mancher denkt auf dem Pferde zu sitzen und sitzt auf der Erde. Also, Giovannina‹, sagte er, ›ich will nach Frankreich, Kunst bringt Gunst, und der Heller läuft dem Batzen nach. Meine Sache verstehe ich, und wenn ich’s draußen zu was gebracht habe, kommst du nach mit unserem Kind.‹ – Das war damals acht Jahre alt, Herr Andrea. Es lachte, als es der Vater zuletzt küsste; da lachte er auch. Ich aber weinte, da musste er wohl mitweinen, obwohl er ganz lustig wegfuhr in der Gondel, ich hört’ ihn noch pfeifen, als er schon um die Ecke war. So ging es ein Jahr. Und was geschah? Die Signoria ließ nach ihm fragen; es dürfe keiner von Murano sein Gewerk ins Ausland tragen, damit sie es dort ihm nicht absähen; ich sollt’ ihm schreiben, dass er wiederkäme, bei Todesstrafe. Über den Brief lachte er; aber den Herren vom Tribunal war’s nicht spaßhaft. Eines Morgens, da wir noch zu Bett waren, wurde ich abgeholt, das Kind mit mir, und hinaufgeschleppt unter die Bleidächer, und musste ihm wieder schreiben, wo ich wäre, ich und unser Kind, und dass ich da bleiben würde, bis er selber mich abforderte in Venedig. Nicht lange, so hatte ich seine Antwort, das Lachen sei ihm vergangen, er wandere dem Brief auf den Fersen nach. Nun, ich hoffte täglich, dass er es wahrmachen werde. Aber Wochen und Monde vergingen, und mir ward immer weher ums Herz und kränker im Haupt, denn da droben ist die Hölle, Herr Andrea, nur dass ich das Kind hatte, das nichts von dem Jammer begriff, außer dass es schlecht aß und über Tag heiß hatte; aber dennoch sang es, um mich lustig zu machen, dass mich’s vollends angriff, die Tränen zu verhalten. Erst im dritten Monat wurden wir herausgeholt, es hieß, der Glasbläser Orso Danieli sei in Mailand am Fieber gestorben, und wir könnten nach Hause gehen. Ich habe es auch von anderen gehört – aber wer das glaubt, kennt die Signoria nicht. Gestorben? Stirbt man auch, wenn man Frau und Kind unter den Bleidächern sitzen hat und sie herausholen soll?«
»Und was meint Ihr, dass aus Eurem Mann geworden sei?«, fragte der Fremde.
Sie sah mit einem Blick ihm ins Gesicht, der ihn daran gemahnte, dass die arme Frau lange Wochen unter den Bleidächern gelebt hatte. »Es ist nicht richtig«, sagte sie. »Mancher lebt und kommt doch nicht wieder, und mancher ist tot und kommt doch wieder. Aber davon wollen wir schweigen. Ja, wenn ich es Euch sagte, wer steht mir dafür, dass Ihr nicht hingeht und es vor dem Tribunal ausplaudert? Ihr seht aus wie ein Galantuomo; aber wer ist noch rechtschaffen heutzutage? Von tausend einer, von hundert keiner. Nichts für ungut, Herr Andrea, aber Ihr wisst wohl, wie es in Venedig heißt:
Mit Lug und Listen kommt man aus, Mit List und Lügen hält man haus.«
Es entstand eine Pause. Der Fremde hatte längst den Teller weggeschoben und der Witwe gespannt zugehört.
»Ich verdenke es Euch nicht«, sagte er, »dass Ihr mir Eure Geheimnisse nicht anvertrauen wollt. Sie gehen mich auch nichts an, und zu helfen wüsst’ ich Euch ohnedies nicht. Aber wie kommt es, Frau, dass Ihr dieses Tribunal, unter dem Ihr so viel gelitten, dennoch Euch gefallen lasset, Ihr und alles Volk in Venedig? Denn ich weiß zwar wenig, wie es hier aussieht – ich habe mich nie in politische Fragen vertieft – aber so viel habe ich doch gehört, dass erst im vorigen Jahr hier ein Tumult war, um das heimliche Tribunal abzuschaffen, dass einer vom Adel selbst dagegen auftrat und der Große Rat eine Kommission wählte, die Sache zu bedenken, und alles in Bewegung geriet für und wider. Ich hörte davon sogar in meiner Schreibstube zu Brescia. Und als endlich alles beim alten blieb und die Macht des heimlichen Gerichts fester gegründet stand als je, warum zündete da das Volk Freudenfeuer an auf den Plätzen und verhöhnte die vom Adel, die gegen das Tribunal gestimmt hatten und nun seine Rache fürchten mussten? Warum war niemand, der es hinderte, dass die Inquisitoren ihren kühnen Feind nach Verona verbannten? Und wer weiß, ob sie ihn dort am Leben lassen, oder ob die Dolche schon geschliffen sind, die ihn für immer stumm machen sollen? Ich – wie gesagt – weiß nur wenig hiervon; ich kenne auch jenen Mann nicht, und es ist mir alles sehr gleichgültig, was hier geschieht, denn ich bin krank und werde es in dieser bunten Welt ohnehin nicht mehr lange treiben. Aber es wundert mich doch, dieses wankelmütige Volk zu sehen, das heute diese drei Männer seine Tyrannen nennt und morgen frohlockt, wenn die untergehen, welche der Tyrannei ein Ende machen wollten.«
»Wie Ihr da redet, Herr!«, sagte die Witwe und schüttelte den Kopf. »Ihr habt ihn nie gesehen, den Herrn Avogadore Angelo Querini, den sie verbannt haben, weil er der heimlichen Justiz den Krieg erklärte? Nun wohl, Herr, aber ich habe ihn gesehen und die anderen armen Leute, und sie sagen alle, er sei ein rechtschaffener Herr und ein großer Gelehrter, der Tag und Nacht die alten Geschichten von Venedig studiert hat und die Gesetze kennt, wie der Fuchs den Taubenschlag. Aber wer ihn über die Straße gehen oder im Broglio mit seinen Freunden stehen sah, so an die Säule gelehnt und die Augen halb zugedrückt, der wusste, dass er ein Nobile war von der Feder am Hut bis zu den Schuhschnallen, und was er gegen das Tribunal redete und handelte, war nicht fürs Volk, sondern für die großen Herren. Den Schafen aber ist es gleich, Herr Delfin, ob sie geschlachtet oder vom Wolf gefressen werden, und
Rauft sich der Habicht mit dem Weih, Ist das Feld für die Hühner frei.
Seht, Lieber, darum war die Schadenfreude groß, als das Tribunal in allen Rechten bestätigt wurde und nach wie vor niemandem Rechenschaft schulden sollte als am Jüngsten Tage dem Herrgott und alle Tage dem Gewissen. Im Kanal Orfano, von Hunderten, die dort ihr letztes Ave gebetet haben, liegen zehn von den kleinen Leuten neben neunzig von den großen Herren. Aber setzt den Fall, es würden adlige Verbrecher und bürgerliche vom Großen Rat öffentlich gerichtet und hingerichtet – Misericordia! wir hätten achthundert Henker anstatt drei, und der große Dieb hängte den kleinen auf.«
Er schien etwas erwidern zu wollen, aber mit einem kurzen Auflachen, das die Wirtin für Zustimmung nahm, hatte es sein Bewenden. Indem trat Marietta wieder herein, ein Gefäß mit Wasser tragend und ein Räucherpfännchen, auf dem ein scharfriechendes Kraut glimmte und ihr seinen Dampf ins Gesicht trieb, dass sie mit Husten, Schelten und Augenreiben die drolligsten Gebärden machte. Sie trug das Räucherwerk mit kleinen Schritten dicht an den vier Wänden herum, die mit einer Unzahl Fliegen und Mücken bedeckt waren.
»Marschiert da weg, ihr Gesindel«, sagte sie, »ihr Blutsauger, schlimmer als Advokaten und Doktoren! Hättet ihr auch Lust, Feigen zu Nacht zu essen und Zyper zu naschen? Da könntet ihr wohl lachen und hernach zum Dank dem Herrn da, wenn er schläft, das Gesicht zerstechen, ihr Meuchelmörder! Wartet, ich will euch was eingeben, das euch ohne Abendessen in Schlaf bringen soll.«
»Musst du immer schwatzen, du gottlose Kreatur?«, sagte die Mutter, die allen Bewegungen ihres Lieblings mit strahlenden Blicken folgte. »Weißt du nicht, dass ein Fass, das klingt, leer ist, und wer viel spricht, wenig sagt?«
»Mutter«, sagte das Mädchen lachend, »ich muss den Mücken ein Schlaflied singen, und seht, wie es hilft! Da fallen sie schon von der Wand. Gute Nacht, ihr Tagediebe, ihr schlechten Gesellen, die ihr keine Miete bezahlt und doch in alle Töpfe guckt. Wir sprechen uns morgen wieder, wenn ihr heute nicht genug bekommen habt.«
Sie schwenkte das erlöschende Kraut noch einmal wie beschwörend überm Haupte und schüttete die Asche in den Kanal, dann verbeugte sie sich rasch gegen den Fremden und lief wie der Wind hinaus.
»Ist es nicht eine Hexe, ein hässliches, unerzogenes Geschöpf?«, sagte Frau Giovanna, indem sie aufstand und sich ebenfalls zum Gehen anschickte. »Und doch gefällt jeder Äffin ihr Äffchen. Und übrigens, so klein sie ist und nichtsnutzig, so anstellig ist sie auch, und es heißt auch von ihr:
Bis die Große sich nur bückt, Hat die Kleine schon das Kraut gepflückt.
Wenn ich das Kind nicht hätte, Herr Andrea! Aber Ihr wollt schlafen, und ich stehe noch hier und brodle wie die Suppe überm Feuer. Schlaft wohl und willkommen in Venedig!«
Er erwiderte ihren Gruß trocken und schien es nicht zu bemerken, dass sie offenbar noch ein lobendes Wort über ihre Tochter von ihm erwartete. Als er endlich allein war, saß er noch eine Weile am Tisch, und sein Gesicht wurde immer düsterer und schmerzlicher. Das Licht brannte mit langem Docht, die Fliegen, die Mariettas Hexenkünsten entgangen waren, belagerten in schwarzen Klumpen die überreifen Feigen, draußen in dem Sackgässchen flogen die Fledermäuse ans Fenster und stießen gegen das Gitter – der einsame Fremde schien für alles um ihn her erstorben, und nur die Augen lebten an ihm.
Erst als es elf schlug vom Turm einer nahen Kirche, richtete er sich mechanisch auf und sah um sich. An der Decke seines niedrigen Zimmers zog in grauen Streifen der scharfe Dunst des Räucherkrautes hin und der Dampf der Kerze gesellte sich zu der Wolke droben. Andrea öffnete das Fenster nach dem Kanal, um die Luft zu reinigen. Da sah er gegenüber Licht in einem durch einen weißen Vorhang nur halb geschlossenen Fenster und konnte durch die Lücke deutlich ein Mädchen beobachten, welches am Tisch vor einer Schüssel saß und die Reste einer großen Pastete hastig verzehrte, mit den Fingern die Bissen zum Munde führend und dazu dann und wann aus einem Kristallfläschchen trinkend. Das Gesicht hatte einen leichtsinnigen, aber eben nicht herausfordernden Ausdruck, nicht mehr in erster Jugend. In der nachlässigen Kleidung und dem halbaufgelösten Haar lag etwas Studiertes und Bewusstes, was doch nicht ungefällig war. Sie musste längst bemerkt haben, dass das Zimmer gegenüber einen neuen Bewohner aufgenommen hatte; aber obwohl sie denselben jetzt am Fenster sah, fuhr sie ruhig im Schmausen fort, und nur wenn sie trank, schwenkte sie das Fläschchen erst vor sich her, als wolle sie einen Mittrinker begrüßen. Darauf stellte sie die leere Schüssel beiseite, rückte den Tisch mit der Lampe so gegen die Wand, dass alles Licht auf einen breiten Spiegel im Hintergrunde fiel, und begann nun einen Haufen Maskenanzüge, der auf einem Armsessel bunt übereinander lag, der Reihe nach vor dem Spiegel anzuprobieren, so dass der Fremde gegenüber, dem sie den Rücken dabei zudrehte, desto deutlicher ihr Abbild sehen musste. Sie schien sich nicht wenig in ihren Verkleidungen zu gefallen. Wenigstens nickte sie ihrem Bilde aufs freundlichste zu, lachte sich an, dass Zähne und Lippen schimmerten, runzelte die Brauen, um eine tragische oder schmachtende Miene zu machen, und sah dabei heimlich seitwärts nach dem Beobachter drüben, den sie ebenfalls durch den Spiegel im Auge behielt. Als die dunkle Gestalt unbeweglich blieb und die erhofften Zeichen des Beifalls auf sich warten ließen, wurde sie ungehalten und bereitete einen Hauptschlag vor. Sie band sich einen großen roten Turban um die Schläfen, aus dem an blitzender Agraffe eine Reiherfeder hervorsah. Das Rot stand allerdings nicht übel zu ihrer gelben Gesichtsfarbe, und sie machte sich selbst eine tiefe Verbeugung der Anerkennung. Als es aber drüben auch jetzt noch still blieb, riss ihr die Geduld, und sie trat, den Turban noch auf dem Kopf, hastig an das Fenster, dessen Vorhang sie ganz zurückschob.
»Guten Tag, Monsù«, sagte sie freundlich. »Ihr seid mein Nachbar geworden, wie ich sehe. Hoffentlich spielt Ihr nicht die Flöte wie Euer Vorgänger, der mich die halbe Nacht nicht schlafen ließ.«
»Schöne Nachbarin«, sagte der Fremde, »ich werde Euch mit keiner Art von Musik lästig fallen. Ich bin ein kranker Mensch, dem es lieb ist, wenn man ihm selbst seinen Schlaf nicht stört.«
»So!«, erwiderte das Mädchen mit gedehntem Ton. »Krank seid Ihr? Aber seid Ihr auch reich?«
»Nein! Warum fragt Ihr?«
»Weil es ja schrecklich ist, krank und arm zugleich zu sein. Wer seid Ihr denn eigentlich?«
»Andrea Delfin ist mein Name. Ich bin Gerichtsschreiber gewesen in Brescia und suche hier einen stilleren Dienst bei einem Notar.«
Die Antwort schien ihre Erwartungen von der neuen Bekanntschaft vollends herabzustimmen. Sie spielte nachdenklich mit einer goldenen Kette, die sie um den Hals trug.
»Und wer seid Ihr, schöne Nachbarin?«, fragte Andrea mit einem zärtlichen Ton, der dem eisernen Ausdruck seines Gesichtes völlig widersprach. »Euer holdes Bild so nahe zu haben, wird mir ein Trost sein in meinen Leiden.«
Sie fühlte sich offenbar befriedigt, dass er in den Ton einlenkte, den sie zu erwarten berechtigt war.
»Für Euch«, sagte sie, »bin ich die Prinzessin Smeraldina, die Euch erlaubt, von fern nach ihrer Gunst zu schmachten. Wenn Ihr mich diesen Turban aufsetzen seht, so sei es Euch ein Zeichen, dass ich geneigt bin, mit Euch zu plaudern. Denn ich langweile mich mehr, als bei meiner Jugend und meinen Reizen zu ertragen ist. Ihr müsst wissen, fuhr sie fort, indem sie plötzlich aus der Rolle fiel, dass meine Herrschaft, die Gräfin, durchaus nicht erlaubt, dass ich auch nur die kleinste Liebschaft habe, obwohl sie selbst ihre Liebhaber öfter wechselt als ihre Hemden. Sie sagt, dass sie ihre Vertraute und Kammerjungfer stets aus dem Dienst gejagt habe, sobald sie zweien Herren habe dienen wollen, ihr und dem kleinen Gott mit den Flügeln. Unter diesem Vorurteil muss ich nun seufzen, und fänd’ ich nicht sonst hier meine Rechnung, und wohnte nicht zuweilen drüben in Eurem Zimmer ein artiger Fremder, der sich ein wenig in mich verliebt …«
»Wer ist jetzt gerade der Liebhaber deiner Herrin?«, unterbrach sie Andrea trocken. »Empfängt sie den hohen Adel Venedigs? Gehen die fremden Gesandten bei ihr aus und ein?«
»Sie kommen meist in der Maske«, erwiderte Smeraldina. »Aber das weiß ich wohl, dass der junge Gritti ihr der Liebste ist, mehr als jemals ein anderer, solange ich in ihrem Dienste bin; ja mehr als der österreichische Gesandte, der ihr so den Hof macht, dass es zum Lachen ist. Kennt Ihr meine Gräfin auch? Sie ist schön.«
»Ich bin fremd hier, Kind. Ich kenne sie nicht.«
»Wisst«, sagte das Mädchen mit einem schlauen Gesicht, »sie schminkt sich stark, obwohl sie noch nicht dreißig ist. Wenn Ihr sie einmal sehen wollt, nichts leichter. Man legt ein Brett von Eurem Fenster in meines. Ihr steigt herüber, und ich führe Euch an einen Ort, wo Ihr sie ganz verstohlen betrachten könnt. Was tut man nicht einem Nachbar zuliebe! – Aber jetzt gute Nacht. Ich werde gerufen.«
»Gute Nacht, Smeraldina!«
Sie schloss das Fenster. »Arm – und krank«, sagte sie für sich, indem sie den Vorhang dicht zusammenzog. »Je nun, für die Langeweile immer noch gut genug.«
Auch er hatte das Fenster geschlossen und durchmaß nun sein Zimmer mit langsamen Schritten. »Es ist gut«, sagte er, »es kommt mir gelegen. Im schlimmsten Falle kann ich auch davon Vorteil ziehen.«
Seine Miene zeigte, dass er an alles eher dachte als an Liebesabenteuer.
Nun packte er seinen Mantelsack aus, der nur wenig Wäsche und ein paar Gebetbücher enthielt, und legte alles in einen Schrank an der Wand. Eines der Bücher fiel zu Boden, und die Steinplatte gab einen hohlen Ton. Sofort löschte er das Licht, verriegelte die Tür und fing an, in der Dämmerung, die durch den fernen Schein von Smeraldinas Lämpchen entstand, den Boden genauer zu untersuchen. Nach einiger Arbeit gelang es ihm, die Steinplatte, die sauber, aber ohne Mörtel eingefügt war, herauszuheben, und er entdeckte darunter ein ziemlich geräumiges Loch, handhoch und einen Schuh breit im Geviert. Rasch warf er sein Oberkleid ab und band sich einen schweren Gürtel mit mehreren Taschen ab, den er um den Leib trug. Er hatte ihn schon in das Loch gelegt, als er plötzlich innehielt.
»Nein«, sagte er, »es könnte eine Falle sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei in Mietwohnungen dergleichen Verstecke angelegt hat, um hernach bei Haussuchungen zu wissen, wo sie anzuklopfen hat. Dies ist zu lockend eingerichtet, um ihm trauen zu können.«
Er senkte die Steinplatte wieder ein und suchte nach einem sichereren Behälter für seine Geheimnisse. Das Fenster nach der Sackgasse war mit einem Gitter versehen, dessen Stäbe einen Arm durchgreifen ließen. Er öffnete es, fasste hindurch und tastete an der Außenwand herum. Er fand dicht unter dem Sims ein kleines Loch in der Mauer, das schon einmal Fledermäuse bewohnt zu haben schienen. Von unten aus konnte es nicht bemerkt werden, und oben sprang das Gesims darüber vor. Geräuschlos erweiterte er mit seinem Dolch die Öffnung, indem er Mörtel und Steine herausbrach, und war bald so weit gediehen, dass er den breiten Gürtel bequem darin unterbringen konnte. Als er fertig war, stand ihm der kalte Schweiß auf der Stirn. Er fühlte noch einmal nach, ob auch nirgend ein Stück Riemen oder eine Schnalle hervorstehe, und schloss dann das Fenster. Eine Stunde später lag er in Kleidern auf dem Bett und schlief. Die Mücken summten über seiner Stirn, die Nachtvögel draußen umschwirrten neugierig das Loch, worin sein Schatz verborgen war. Die Lippen des Schläfers aber waren zu fest geschlossen, um selbst im Traum ein Wort von seinen Geheimnissen zu verraten.
In derselben Nacht saß in Verona ein Mann bei seiner einsamen Lampe und entfaltete, nachdem er Fensterläden und Tür sorgfältig verschlossen hatte, einen Brief, der ihm heute in der Dämmerung, als er in der Nähe des Amphitheaters sich erging, von einem bettelnden Kapuziner heimlich zugesteckt worden war. Der Brief trug keine Aufschrift. Aber auf die Frage, woher der Überbringer wisse, dass er das Schreiben in die richtigen Hände gebe, hatte der Mönch geantwortet: »Jedes Kind in Verona kennt den edlen Angelo Querini wie seinen Vater.« Darauf war der Bote gegangen. Der Verbannte aber, dessen Haft durch die Achtung, die ihm in das Unglück folgte, gelockert worden war, hatte den Brief trotz der Späher, die ihn beobachteten, unbemerkt in seine Wohnung gebracht und las jetzt, während der Schritt der Wache draußen am Hause drohend durch die Stille erklang, folgende Zeilen:
An Angelo Querini.
Ich kann nicht hoffen, dass Ihr Euch der flüchtigen Stunde erinnert, in der ich Euch persönlich begegnet bin. Viele Jahre liegen zwischen damals und heute. Ich war mit meinen Geschwistern in der ländlichen Stille unserer Güter in Friaul aufgewachsen; erst als ich beide Eltern verloren hatte, trennte ich mich von meiner Schwester und dem jüngeren Bruder. Schon nach wenigen Tagen hatte mich der verführerische Strudel Venedigs verschlungen.
Da wurde ich eines Tages im Palast Morosini Euch vorgestellt. Noch fühle ich den Blick, mit dem Ihr uns junge Leute mustertet, einen nach dem anderen. Euer Auge sagte: »und das ist das Geschlecht, auf dessen Schultern die Zukunft Venedigs ruhen soll?« – Man nannte Euch meinen Namen. Unvermerkt lenktet Ihr das Gespräch mit mir auf die große Vergangenheit des Staates, dem meine Ahnen ihre Dienste gewidmet hatten. Von der Gegenwart und den Diensten, die ich ihm schuldig blieb, schwiegt Ihr schonend.
Seit jenem Gespräch las ich Tag und Nacht in einem Buch, das ich früher nie eines Blickes gewürdigt hatte, in der Geschichte meines Vaterlandes. Die Frucht dieses Studiums war, dass ich, von Grauen und Abscheu getrieben, die Stadt für immer verließ, die einst Länder und Meere beherrscht hatte und nun die Sklavin einer kläglichen Tyrannis war, nach außen so ohnmächtig, wie unselig und gewalttätig nach innen.
Ich kehrte zu meinen Geschwistern zurück. Es gelang mir, meinen Bruder zu warnen, ihm die Fäulnis des Lebens aufzudecken, das von fern sich so gleißend ansah. Aber ich dachte nicht, dass alles, was ich tat, um ihn und uns zu retten, uns nur um so gewisser verderben sollte.
Ihr kennt die Eifersucht, mit der die Machthaber in der Mutterstadt den Adel der Terraferma von jeher betrachtet haben. Hatte man doch in Zeiten, wo der Republik zu dienen eine Ehre war, nie aufgehört, ein Losreißen des Festlandes zu fürchten. Jetzt, wo verschuldete und unvermeidliche Übel eine Änderung der Weltstellung Venedigs herbeigeführt hatten, wurde jene Furcht die Quelle der unerhörtesten Ränke und Freveltaten.
Lasst mich von den Schicksalen schweigen, die ich in der Nachbarschaft meiner Provinz mit ansah, von den ausgesuchten Mitteln, durch die man die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Adels von Friaul zu brechen suchte, von dem Heer der Bravi, welches man gegen Widerspenstige schickte und durch eine Unzahl von Amnestiedekreten selbst von der Strafe ihrer eigenen Gewissen entband. Wie man den Zwist in die Familien zu tragen, Freundschaften zu vergiften, Verrat und Hinterlist im Schoß der engsten Blutsgenossenschaft zu erkaufen strebte, das alles ist Euch länger bekannt als mir.
Und nicht lange sollte mich das Andenken, das ich durch meine lockeren Sitten in Venedig zurückgelassen hatte, vor dem Verdacht schützen, dass auch ich eines Tages gefährlich werden könnte. Als ich für meine Schwester um die Erlaubnis nachsuchte, die Hand eines vornehmen deutschen Herrn anzunehmen, wurde die Einwilligung der Regierung rundweg verweigert. Man wähnte mich und meinen Bruder im Einverständnis mit der kaiserlichen Politik und beschloss, uns büßen zu lassen.
Eine Beschwerde der Provinz gegen ihren Gouverneur, die ich samt dem Bruder mit unterzeichnete, lieferte der Inquisition den Anlass, das Netz über uns zu werfen.
Mein Bruder wurde nach Venedig gerufen, sich zu verantworten. Als er kam, wurde er unter die Bleidächer geführt, und viele Wochen lang suchte man bald durch Drohungen, bald durch verlockende Anerbietungen ihn zu Geständnissen zu bewegen. Jenen einen Schritt brauchte er nicht zu beschönigen; er war gesetzlich. Anderes hatte er nicht zu gestehen, da wir nichts gegen den Staat unternommen hatten. So musste man ihn endlich entlassen. Aber man dachte nicht daran, ihn zu begnadigen.
Ich selbst hatte ihn schriftlich gebeten, nicht sogleich abzureisen, um nicht neuen Verdacht zu erwecken. Wir wollten ihn lieber einige Monate länger entbehren. Als er endlich kam, sollten wir ihn nach wenigen Tagen für immer missen. Er erlag einem langsam wirkenden Gift, das man ihm in einem der glänzenden Häuser, die er besuchte, unter die Speisen gemischt hatte.
Noch war der Stein über seinem Grabe nicht aufgerichtet, als der Gouverneur der Provinz meiner Schwester seine Hand antrug. Sie wies sie mit Entrüstung zurück; in ihrem Schmerz entfuhren ihr Worte, die ihren Nachhall im Saal des Inquisitionstribunals finden sollten.
Eine neue Anstrengung des Adels von Friaul, die Lage des Landes zu bessern, wurde beraten. Ich hielt mich von den geheimen Anstalten fern, da ich von ihrer Fruchtlosigkeit überzeugt war. Aber das böse Gewissen der Herren der Republik deutete auf mich, als den am härtesten Getroffenen, der einen Bruder zu rächen hatte. Ein Haufen gedungener Bravi überfiel nachts unsere einsame Villa in den Bergen. Ich hatte nur meine Diener zur Verteidigung. Als die Elenden uns wohlgerüstet und entschlossen fanden, uns nicht leichten Kaufs zu ergeben, zündeten sie das Haus an vier Ecken an. Ich machte mit meinen Leuten einen verzweifelten Ausfall, die Schwester, die selbst eine Pistole trug, in unserer Mitte. Da streckte mich ein Schlag gegen die Stirn besinnungslos zu Boden.
Erst am Morgen wachte ich auf. Die Stätte war ein menschenleerer Trümmerhaufen, meine Schwester in den Flammen umgekommen, meine braven Diener teils erschlagen, teils in das brennende Haus zurückgetrieben.
Viele Stunden lag ich so neben dem rauchenden Schutt und starrte in das leere Nichts, das mir meine Zukunft bedeutete. Erst als ich unten im Tal Bauern heranziehen sah, raffte ich mich auf. Eins wusste ich: Solange man mich am Leben glaubte, würde man mich für einen Feind halten und überall hin verfolgen. Das brennende Grab war geräumig genug; wenn ich verschwand, würde niemand zweifeln, dass auch ich dort bei den Meinigen ausruhte. Im Herumirren auf der Felshöhe fand ich die Brieftasche eines meiner Bedienten, der aus Brescia gebürtig und viel in der Welt herumgefahren war. Seine Papiere lagen darin; ich steckte sie zu mir, auf alle Fälle, und floh durch den dichten Klippenwald. Niemandem begegnete ich, der mich hätte verraten können. Als ich mich verschmachtet zu einem trüben Waldsee bückte, sah ich, dass auch mein Äußeres mich nicht verraten konnte. Mein Haar war in der Nacht ergraut; meine Züge waren um viele Jahre gealtert.
In Brescia angelangt, konnte ich ohne Schwierigkeiten mich für meinen Diener ausgeben, da derselbe schon als Knabe die Stadt verlassen hatte und dort keine Verwandten mehr besaß. Fünf Jahre lang lebte ich wie ein lichtscheuer Verbrecher und vermied die Menschen. Eine Ohnmacht hatte sich auf meinen Geist gesenkt, als wäre durch jenen Schlag, der mich zu Boden warf, das Organ des Willens in mir zertrümmert worden.
Dass es nicht zerstört, sondern nur gelähmt war, empfand ich bei der Kunde von Eurem Auftreten gegen das Tribunal. Mit einer fieberhaften Spannung, die mich verjüngte und mir das Bewusstsein meiner Lebenskraft zurückgab, verfolgte ich die Nachrichten aus Venedig. Als ich das Scheitern Eures hochherzigen Wagnisses vernahm, sank ich nur auf einen Augenblick in die alte, dumpfe Resignation zurück. Im nächsten Augenblick drang es wie ein Feuerstrom durch alle meine Sinne. Der Entschluss stand fest, das Werk, das Ihr auf dem offenen Wege des Rechts und des Gesetzes nicht hattet vollbringen können, auf dem Wege der Gewalt und einer furchtbaren Notwehr, mit dem Arm des unsichtbaren Richters und Rächers zum Heil meines teuren Vaterlandes hinauszuführen.
Ich habe diesen Entschluss seither unablässig geprüft und meine Absicht unsträflich gefunden. Ich bin mir heilig bewusst, dass nicht Hass gegen die Personen, nicht Rache für erlittenes Leid, nicht einmal der gerechte Gram um das Weh, das meinen Lieben widerfahren, meinen Arm gegen die Gewaltherren bewaffnet. Was mich bewegt, für ein ganzes in Knechtschaft versunkenes Volk als Retter aufzutreten und einzeln den Spruch zu vollstrecken, der zu anderen Zeiten vom Gesamtwillen einer freien Nation über ungerechte, dem Arm des Richters unerreichbare Mächtige verhängt worden ist – es ist weder Eigensucht, noch eitle Ruhmbegier; es ist nur eine Schuld, die ich durch eine tatenlose Jugend auf mich geladen habe, und an deren Bezahlung mich damals Euer Blick im Palast Morosini mahnte.
Gott, in dessen Schutz ich meine Sache befehle, möge mir als einzigen Ersatz für alles, was er mir genommen, die Gnade zuteil werden lassen, dass ich in einem befreiten Venedig Euch noch einmal die Hand drücken kann. Ihr werdet die blutbefleckte nicht zurückstoßen, die dann in keiner Freundeshand mehr ruhen wird; denn wer das Amt des Henkers verwaltet hat, ist der Einsamkeit geweiht und hat den Blick der Menschen zu meiden. Gehe ich aber an meinem Werk zugrunde, so weiß derjenige, an dessen Achtung mir am meisten gelegen ist, dass es auch in dem jüngeren Geschlecht nicht ganz an Männern fehlt, die für Venedig zu sterben wissen.
Diesen Brief wird Euch ein zuverlässiger Mann zustellen, der das Kleid eines Sekretärs der Inquisition mit der Mönchskutte vertauscht hat, um durch Fasten und Gebet die Sünden der Republik zu büßen, denen er seine Feder leihen musste. Verbrennt dieses Blatt. Lebt wohl!
Candiano.
Als der Verbannte den Brief zu Ende gelesen hatte, saß er wohl eine Stunde in tiefem Kummer vor den verhängnisvollen Blättern. Dann hielt er sie über die Flamme, streute die Asche in den Kamin und ging ruhelos bis an den frühen Morgen auf und nieder, während der Unglückliche, dessen Beichte er vernommen, wie einer, dessen Sache gerecht und dessen Sachwalter der Himmel ist, schon längst den Schlaf gefunden hatte.
Barmherzigkeit <<<
militärisch organisierten Gerichtsdiener im Vatikan und der Republik Venedig <<<
Die venezianische Staatsinquisition war eine Gerichtsbarkeit der Republik Venedig, die für Staatsverbrechen wie Hochverrat, Spionage, Geheimnisverrat, Sabotage, Geldfälscherei oder Konspiration jeglicher Art zuständig war. Sie war demzufolge von der kirchlichen Inquisition, der Glaubensgerichtsbarkeit, getrennt. <<<
Der Rat der Zehn war seit seiner Gründung im Jahr 1310 eines der wichtigsten Gremien im Justiz- und Herrschaftssystem der Republik Venedig. Gegründet als außerordentlicher Gerichtshof, wurde der Rat der Zehn bald eine ständige Einrichtung als höchstes Gericht und oberste Polizeibehörde. Im Laufe des 15. Jahrhunderts konnte sich der Rat der Zehn immer mehr Kompetenzen aneignen. <<<
2
Am anderen Tage ging der späte Ankömmling in der Straße della Cortesia zeitig aus. Das lustige Singen Mariettas draußen auf dem Flur hätte ihn vielleicht noch länger schlafen lassen, aber das laute Schelten der Mutter, dass sie einen Lärm mache, der einen Toten erwecken könne, und dass sie noch alle Fremden aus dem Hause treiben würde, ermunterte ihn völlig. Er hielt sich an der Stiege, wo seine Wirtin bereits auf ihrem alten Posten saß, nur gerade so lange auf, um sich nach den Wohnungen einiger Notare und Advokaten zu erkundigen, deren Namen ihm ein Freund in Brescia aufgeschrieben hatte. Als er Bescheid wusste, konnte weder die zärtliche Sorge der Witwe um seine Gesundheit, noch die rote Schleife, die Marietta in ihr Haar gesteckt hatte, ihn zu längerem Verweilen bewegen, und während sich die gute Frau sonst bemüht hatte, den Verkehr ihrer Mietsleute mit ihrer Tochter möglichst zu verhindern, war es ihr jetzt fast unheimlich, dass der Fremde das liebe Geschöpf, ihren Augapfel, hartnäckig übersah. Sein ergrautes Haar erklärte ihr diese seltsame Blindheit nicht genügend. Er musste einen geheimen Kummer haben oder sich so krank fühlen, dass ihm der Anblick eines frischen Lebens wehe tat. Dennoch ging er straff und rasch, und seine Brust war breit und gewölbt, so dass die Krankheit, von der er sprach, tief im Innern ihren Sitz haben musste. Auch seine Gesichtsfarbe war nicht verdächtig. Wie er die Straßen Venedigs durchschritt, zog er den wohlgefälligen Blick manch eines Frauenauges auf sich, und auch Marietta sah ihm aus einem der oberen Fenster nicht ohne Anteil nach.
Er aber ging in sich gekehrt seinen Geschäften nach, und obgleich er sich bei Frau Giovanna umständlich nach dem Weg erkundigt hatte und endlich über seine Ortsunkenntnis durch das Sprüchlein: »Mit Fragen kommt man bis Rom« von ihr getröstet worden war, schien er doch jetzt ohne alle Hilfe sich in dem Netz der Gassen und Kanäle zurechtzufinden. Mehrere Stunden vergingen ihm mit Besuchen bei Advokaten, die aber auf seine Empfehlung von einem Kollegen aus Brescia wenig Gewicht legten und denen er, so bescheiden er auftrat, verdächtig vorkommen mochte. Denn allerdings war ein gewisser Stolz in der Falte seiner Stirn, der einem schärferen Beobachter sagte, dass er die Arbeit, die er suchte, eigentlich unter seiner Würde hielt. Zuletzt kam er zu einem Notar, der in einem Seitengässchen der Merceria wohnte und allerlei Winkelgeschäfte nebenbei zu treiben schien. Hier fand er mit einem sehr mäßigen Gehalt eine Stelle als Schreiber, vorläufig zum Versuch, und die hastige Art, wie er zugriff, brachte den Mann zu dem Verdacht, er habe es etwa mit einem verarmten Nobile zu tun, deren mancher, nur um das Leben zu fristen, sich zu jeder Arbeit willig finden ließ, ohne um ihren Preis zu handeln.
Andrea jedoch war augenscheinlich mit dem Erfolg seiner Bemühungen sehr zufrieden und trat, da es inzwischen Mittag geworden war, in die nächste Schenke, wo er Leute aus den unteren Klassen an langen ungedeckten Tischen sitzen sah, die ihre sehr einfache Kost mit einem Glas trüben Weins würzten. Er nahm seinen Platz in einem Winkel nahe der Tür und aß die etwas ranzigen Fische ohne Murren, während er freilich den Wein, nachdem er ihn gekostet hatte, verschmähte.
Er war schon im Begriff, nach der Zeche zu fragen, als er sich von seinem Nachbar höflich anreden hörte. Der Mann, den er bisher ganz übersehen hatte, saß schon lange vor seiner halben Flasche Wein, aß nichts, trank nur dann und wann einen Schluck, wobei er jedes Mal den Mund ein wenig verzog; während er aber scheinbar vor Müdigkeit die Augen halb geschlossen hielt, wanderten seine scharfen Blicke durch die ganze düsterliche Halle und hefteten sich mit besonderem Anteil an unseren Brescianer, der seinerseits nichts Merkwürdiges an ihm wahrgenommen hatte. Es war ein Mann in den Dreißigen, mit blondem, lockigen Haar, der in der schwarzen venezianischen Tracht seine jüdische Herkunft nicht sogleich verriet. In den Ohren trug er schwere goldene Ringe, an den Schuhen Schnallen mit großen Topasen, während sein Halskragen zerknittert und unsauber, und sein Rock von feinem Wollenstoff seit Wochen nicht gebürstet war.
»Dem Herrn schmeckt der Wein nicht«, sagte er halblaut, indem er sich geschmeidig zu Andrea hinbog. »Der Herr scheint überhaupt nur aus Irrtum hier zu sein, wo man nicht gewohnt ist, Gäste von besserem Stande zu bewirten.«
»Um Vergebung, Herr«, erwiderte Andrea ruhig, obwohl er sich Gewalt antat, überhaupt zu antworten, »was wisst Ihr von meinem Stande?«
»Ich seh es an der Art, wie der Herr isst, dass er eine andere Gesellschaft gewohnt ist, als er hier findet«, sagte der Jude.
Andrea maß ihn mit einem festen Blick, vor dem das lauernde Auge des anderen sich senkte. Dann schien ein Gedanke in ihm aufzusteigen, der ihn plötzlich bewog, dem Zudringlichen mit einer Art von Vertraulichkeit entgegenzukommen.
»Ihr seid ein scharfer Menschenkenner«, sagte er. »Es ist Euch nicht entgangen, dass ich einst bessere Tage gesehen und einen unverfälschten Wein getrunken habe. Auch kam ich in gute Gesellschaft, obwohl ich der Sohn eines kleinen Bürgers bin und nur kümmerlich die Rechte studiert habe, ohne einen Titel zu erwerben. Das hat sich geändert. Mein Vater machte Bankrott, ich wurde arm, und ein armer Gerichtsschreiber und Advokatengehilfe hat auf nichts Besseres Anspruch zu machen, als was er in dieser Kneipe findet.«
»Ein studierter Herr hat immer Anspruch auf Verehrung«, sagte der andere mit einem sehr verbindlichen Lächeln. »Es würde mich glücklich machen, wenn ich Euer Gnaden einen Dienst erweisen könnte; denn ich habe stets nach dem Umgang gelehrter Männer gestrebt und bei meinen vielen Geschäften nicht selten die Gelegenheit gehabt, mich ihnen zu nähern. Wenn ich Euer Gnaden vorschlagen dürfte, ein besseres Glas Wein mit mir zu trinken, als hier zu haben ist …«
»Ich kann besseren Wein nicht bezahlen«, sagte der andere gleichgültig.
»Es würde mir eine Ehre sein, gegen den Herrn, der hier fremd scheint, die venezianische Gastfreundschaft zu üben. Wenn ich sonst mit meinem Vermögen und meiner Ortskenntnis dem Herrn irgend nützlich sein kann …«
Andrea wollte ihm eben ausweichend antworten, als er bemerkte, dass der Wirt der Schenke, der im Hintergrunde am Kredenztische stand, ihn lebhaft mit dem kahlen Kopf zu sich heranwinkte. Auch von den anderen Gästen, die aus Handwerkern, Marktweibern und Tagedieben bestanden, machte ihn mancher mit verstohlenen Zeichen aufmerksam, dass man ihm gern etwas mitgeteilt hätte, was man nicht laut zu sagen wagte. Unter dem Vorwand, erst zu bezahlen, ehe er auf die höfliche Einladung antwortete, verließ er seinen Platz und ging mit der lauten Frage, was er schuldig sei, auf den Wirt zu.
»Herr«, flüsterte der gutmütige Alte, »nehmt Euch in acht vor dem. Ihr habt es mit einem Schlimmen zu tun. Die Inquisitoren bezahlen ihn, dass er die Heimlichkeiten der Fremden ausspürt, die sich hier blicken lassen. Seht Ihr nicht, dass der Winkel leer ist, wo er Platz genommen hat? Sie kennen ihn alle, und nächstens fliegt er einmal zur Tür hinaus, der Gott Abrahams gesegn’ es ihm! Ich aber, obwohl ich ihn dulden muss, um mir nicht die Finger zu verbrennen, bin es Euch doch schuldig, Euch reinen Wein einzuschenken.«
»Ich dank’ Euch, Freund«, sagte Andrea laut. »Euer Wein ist ein wenig trübe, aber gesund. Guten Tag.«
Damit kehrte er auf seinen Platz zurück, nahm seinen Hut und sagte zu seinem dienstfertigen Nachbar: »Kommt, Herr, wenn es Euch gefällt. Man sieht Euch hier nicht gern, fügte er leiser hinzu. Man hält Euch für einen Spion, wie ich habe merken können. Wir wollen anderswo unsere Bekanntschaft fortsetzen.«
Das schmale Gesicht des Juden erblasste. »Bei Gott«, sagte er, »man verkennt mich! Aber ich kann es den Leuten nicht verdenken, wenn sie auf der Hut sind, denn es wimmelt hier in Venedig von Spürhunden der Signoria. Meine Geschäfte, fuhr er fort, als sie schon auf der Gasse waren, meine vielen Verbindungen führen mich in so manche Häuser, dass es wohl scheinen mag, als bekümmerte ich mich um fremde Geheimnisse. Gott soll mich leben lassen hundert Jahr, aber was gehen mich fremde Leute an? Wenn sie mir zahlen, was sie mir schuldig sind, will ich ein Hund sein, wenn ich ihnen was nachrede.«
»Ich meine aber doch, Herr – wie ist Euer Name?«
»Samuele.«
»Ich meine aber, Herr Samuele, dass Ihr zu übel denkt von denen, die zum Besten des Staates die Pläne und Anschläge der Bürger ausspähen und Verschwörungen gegen die Republik an den Tag bringen, ehe sie schaden können.«
Der Jude stand still, hielt den andern am Ärmel und sah ihn an. »Warum hab’ ich Euch nicht gleich erkannt?«, sagte er. »Ich musste wissen, dass Ihr nicht zufällig in jene elende Kneipe geraten konntet, dass ich einen Kollegen in Euch zu begrüßen hatte. Seit wann seid Ihr im Amt?«
»Ich? Seit übermorgen.«
»Was meint Ihr, Herr? Wollt Ihr mich foppen?«
»Wahrlich nicht«, erwiderte Andrea. »Denn es ist mein voller Ernst, dass ich nächstens so weit kommen werde, mich in Euern Orden aufnehmen zu lassen. Es geht mir schlecht, wie ich Euch gesagt habe, und ich bin nach Venedig gekommen, meine Umstände zu verbessern. Der Schreiberlohn, um den ich mich heute bei einem Notar verdungen habe, ist nicht das, was ich hier vom Glück und von meinem bisschen Verstand erhofft habe. Venedig ist eine schöne Stadt, eine lustige Stadt; aber in dem Lachen der schönen Weiber ist ein Goldklang, der mich immer an meine Armut erinnert. Ich denke, das kann nicht immer so währen.«
»Euer Vertrauen ehrt mich sehr«, sagte der Jude mit einem nachdenklichen Zug. »Aber ich muss Euch sagen, dass die Herren nicht gern fremde Ankömmlinge in ihre Dienste nehmen, ehe sie eine Probezeit bestanden und sich ein wenig umgesehen haben. Wenn ich Euch bis dahin mit meiner Börse aushelfen kann – ich nehme niedrige Prozente von meinen Freunden.«
»Ich dank’ Euch, Herr Samuele«, erwiderte Andrea gleichmütig. »Eure Protektion ist mir wertvoller, der ich mich hiermit bestens empfohlen haben will. Dies aber ist mein Haus; ich nötige Euch nicht hinein, weil ich Arbeit vollauf habe für meinen neuen Brotherrn. Andrea Delfin ist mein Name. Wenn es Zeit ist, dass man mich brauchen kann, denkt an mich: Andrea Delfin, Calle della Cortesia.«
Er schüttelte dem seltsamen Freunde die Hand, der draußen noch eine Weile stehen blieb, sich das Haus und die nächste Umgebung genau ansah und dabei mit einer Miene des Zweifels und der listigen Überlegung vor sich hinmurmelte, aus der hervorging, dass er den Brescianer von seiner Probezeit nicht so rasch freisprechen würde.
Als Andrea die Treppe hinaufstieg, konnte er an Frau Giovanna nicht vorüber, ohne ihr Rede zu stehen. Sie war nicht damit zufrieden, dass er nur einen so geringen Platz gefunden hatte. Sie werde nicht ruhen, bis er ihn aufgegeben und sich einen einträglicheren und ehrenvolleren gesucht habe. Er schüttelte den Kopf. »Es reicht wohl, gute Frau«, sagte er ernsthaft, »für die Spanne Zeit, die ich noch vor mir habe.«
»Was Ihr auch redet!«, schalt die Frau. »Dem Guten entgegengehen und das Böse kommen lassen, so ziemt sich’s für einen Mann, und nach Honig schleckt man, nach Wermut spuckt man. Seht die schöne Sonne draußen und schämt Euch, dass Ihr schon nach Hause kommt, während auf der Piazzetta Musik ist und alles, was hübsch und reich und vornehm ist, den Markusplatz auf und ab spaziert. Da gehöret Ihr hin, Herr Andrea, statt ins Zimmer.«
»Ich bin weder hübsch, noch reich, noch vornehm, Frau Giovanna.«
»Habt Ihr denn gar keine Freude, die schöne Welt zu sehen?«, fragte sie eifrig, und sah sich dabei um, ob Marietta nicht etwa in der Nähe sei. »Ihr seid doch nicht etwa liebeskrank?«
»Nein, Frau Giovanna.«