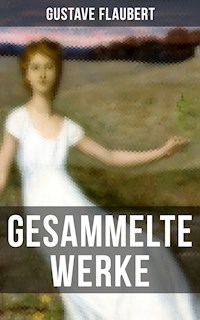1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die "Gesammelten Werke von Gustave Flaubert" bieten einen tiefen Einblick in das literarische Schaffen eines der bedeutendsten Autoren des 19. Jahrhunderts. Dieser Band vereint Flauberts meisterhafte Romane, Essays und Briefe, in denen er mit präziser Sprache und unübertroffener Stilistik die gesellschaftlichen und psychologischen Strukturen seiner Zeit analysiert. Flaubert, bekannt für seinen Perfektionismus und seine Detailversessenheit, nutzt eine Vielzahl von literarischen Techniken, um die Komplexität menschlicher Emotionen und die Absurditäten des Alltagslebens einzufangen, wobei sein berühmtes Werk "Madame Bovary" exemplarisch für seinen innovativen Erzählstil steht. Gustave Flaubert, geboren 1821 in Rouen, war ein Wegbereiter des literarischen Realismus und der moderne Erzählkunst. Sein Lebensweg, geprägt von persönlichen Krisen und einer tiefen Liebe zur Literatur, führte ihn dazu, die Hypokrisie und das Streben nach Glück in einer schnelllebigen Welt zu hinterfragen. Flauberts umfangreiche Briefe werfen zusätzliches Licht auf seine Entstehungsprozesse und seine Beziehungen zu zeitgenössischen Schriftstellern und Philosophen, wodurch sein literarisches Erbe weiter vertieft wird. Empfehlenswert ist dieses Werk sowohl für eingefleischte Flaubert-Leser als auch für Neulinge, die sich auf eine literarische Entdeckungsreise begeben möchten. Die "Gesammelten Werke" sind nicht nur eine Hommage an Flauberts Genialität, sondern auch ein unverzichtbares Dokument der literarischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts, das den Leser dazu einlädt, die Tragik, den Humor und die Schönheit der menschlichen Erfahrung neu zu entdecken. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Die Autorenbiografie hebt persönliche Meilensteine und literarische Einflüsse hervor, die das gesamte Schaffen prägen. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gesammelte Werke von Gustave Flaubert
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese Ausgabe der Gesammelten Werke von Gustave Flaubert führt zentrale Texte verschiedener Schaffensphasen zusammen und macht die Spannweite eines Autors sichtbar, der den europäischen Roman und die moderne Prosa nachhaltig geprägt hat. Sie vereint vollständig vorliegende Romane, Erzählungen, frühe autobiografische Stücke, Reisetexte sowie ausgewählte Briefe. Der Zweck der Zusammenstellung ist doppelt: Sie soll eine verlässliche Lektürebasis bieten und zugleich die innere Verknüpfung von Themen, Formen und Tonlagen erkennbar machen. Wer Flaubert neu entdeckt oder wiederliest, erhält hier einen Überblick, der Vielfalt nicht nivelliert, sondern als charakteristisches Merkmal eines konsequenten stilistischen Ethos ausstellt.
Mit Madame Bovary, Salammbô und Die Schule der Empfindsamkeit sind drei große Romane vertreten, die jeweils eine andere Seite von Flauberts Kunst entfalten. Madame Bovary führt in die französische Provinz und in das Spannungsfeld zwischen Sehnsucht und gesellschaftlicher Ordnung. Salammbô öffnet den Blick auf eine antike Welt, die in opulenter Detailarbeit beschworen wird. Die Schule der Empfindsamkeit zeigt die Bildung eines jungen Mannes im Spiegel seiner Gefühle und Erwartungen. Gemeinsam dokumentieren diese Werke Flauberts Fähigkeit, Milieus präzise zu beobachten, Figuren in ihrer Lebenswirklichkeit ernst zu nehmen und aus Alltags- wie Weltgeschichten formstrenge Dichtung zu formen.
Die frühen Texte Gedanken eines Zweiflers (auch unter Erinnerungen eines Verrückten bekannt) und November lassen den Autor im Experimentierfeld der Selbstbeobachtung erkennen. Sie verbinden kontemplative Innenschau mit der Frage nach der eigenen Berufung und nach den Möglichkeiten der Sprache, Erregung, Zweifel und Ernüchterung zu fassen. In diesen Stücken erprobt Flaubert den Ton einer nüchternen Empfindsamkeit und eine Prosa, die persönliche Erfahrung ins Allgemeine hebt, ohne sich in Bekenntnissen zu verlieren. Der autobiografische Impuls wird kontrolliert durch formale Disziplin und markiert den Weg hin zu jener Sachlichkeit, die seine späteren Werke kennzeichnet.
Ein einfältig Herz, Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien und Herodias bilden ein Triptychon der Erzählkunst, das zwischen dem Alltäglichen, dem Legendären und dem Biblischen vermittelt. Die Lebensgeschichte einer Dienerin, die mittelalterliche Legende eines heiligen Hospitaliers und eine dramatische Episode aus einer Herrscherwelt zeigen, wie Flaubert Gattungsgrenzen verschiebt: realistische Genauigkeit trifft auf mythische Strenge, Andacht auf psychologische Beobachtung. In knapper Form entfaltet sich eine Prosa, die aus wenigen Motiven eine große Spannweite an Stimmungen gewinnt und in jedem Register eine ebenso klare wie eindringliche Diktion wahrt.
Leidenschaft und Tugend gehört zu den frühen Versuchen, Leidenschaften literarisch zu ordnen, ohne sie moralisch zu simplifizieren. Der Text tastet sich an jene Grenzlinie heran, an der affektive Intensität auf gesellschaftliche Normen trifft. Auffällig ist dabei die nüchterne Präzision, mit der Flaubert den verführerischen Glanz des Pathetischen begrenzt und in eine straffe, kontrollierte Erzählbewegung überführt. Schon hier zeigt sich sein Misstrauen gegenüber programmatischen Lehrstücken: Nicht die Thesen stehen im Vordergrund, sondern die genaue Darstellung der Kräfte, die Menschen leiten, hemmen und in widersprüchliche Handlungen verwickeln.
Mit Über Feld und Strand und den Briefen aus dem Orient treten die Schreibweisen des Reisenden und des Korrespondenten hinzu. Das erstgenannte Werk, entstanden in Zusammenarbeit mit Maxime Du Camp, verbindet Landschaftsbeobachtung und kulturhistorische Notizen zu einem Reisebild, das den Blick schärft, ohne Exotismus zu reproduzieren. Die Briefe aus dem Orient dokumentieren Eindrücke einer ausgedehnten Fahrt und zeigen, wie Notat, Reflexion und Recherche ineinandergreifen. Beide Textsorten offenbaren Flauberts Werkstatt: das Sammeln von Details, die geduldige Prüfung des Gesehenen und die Umformung des Erlebten in eine sprechende, aber unaufdringliche Prosa.
Flauberts Markenzeichen ist die kompromisslose Arbeit am Satz. Sein Streben nach dem treffenden Wort, nach Rhythmus, Klang und syntaktischer Balance verleiht den Texten eine dichte, oft musikalische Oberfläche. Die scheinbare Sachlichkeit entsteht aus unablässiger Revision und dem Bewusstsein, dass Stil Erkenntnis ist. In dieser Haltung liegt keine Kälte: Die Genauigkeit erlaubt Empathie, weil sie dem Gegenstand gerecht werden will. Hinzu kommt der impersonal gehaltene Erzähler und die frei indirekte Rede, die Figurenrede und Erzählsprache durchdringen. So entstehen Perspektiven, die Nähe schaffen, ohne autoritäre Kommentare zu liefern.
In den hier versammelten Werken wiederholt sich ein Motivbündel, das Flauberts Denken prägt: das Ringen zwischen Wunsch und Wirklichkeit, die Verführungskraft der Bilder, die Macht sozialer Konventionen, die Gleichzeitigkeit von Leidenschaft und Müdigkeit. Die Provinz, die antike Stadt, der Markt, die Stube und die Pilgerstraße werden zu Bühnen, auf denen der Mensch sich entwirft und verfehlt. Immer wieder erkundet Flaubert, wie Ideen Besitz ergreifen, wie Sprache Gefühle formt und wie die Phantasie Rettung verspricht, während sie die Distanz zum Gegebenen vergrößert. Das Ergebnis ist eine Literatur der klaren, zugleich verletzlichen Erkenntnis.
Historische und geographische Räume sind bei Flaubert keine bloßen Kulissen. In Salammbô tritt die sorgfältige Rekonstruktion einer fernen Welt an die Stelle schwärmerischer Ferne. In Herodias gründet die Strenge der Form die Glaubwürdigkeit eines Ereignisrahmens. Über Feld und Strand und die Briefe aus dem Orient zeigen, wie Beobachten, Nachlesen und Vergleichen zur Methode werden. So verbindet Flaubert Recherche und Einbildungskraft: Er respektiert Quellen, doch er überträgt sie in eine autonome Kunstsprache. Aus dieser Spannung bezieht das Werk seine Autorität, die gleichermaßen historisch verantwortet und ästhetisch eigenständig ist.
Die Erzählstimme wahrt Distanz und fordert Urteilskraft. Ironie ist bei Flaubert kein Spott, sondern ein Verfahren, das die Dinge sprechen lässt, bis sie sich selbst beleuchten. Moralische Bilanzierungen werden nicht verkündet, sondern im Verlauf der Darstellung möglich. Besonders deutlich wird dies in den frühen Ich-Texten, in denen Selbsterforschung durch Stil gebändigt wird, und in den Romanen, deren Figuren wir folgen, ohne dass sie zu exemplarischen Fällen erstarren. Die Spannung zwischen Empathie und Strenge, zwischen Zurückhaltung und Deutlichkeit, macht die anhaltende Modernität dieser Prosa aus.
Die literarische Bedeutung Flauberts beruht nicht allein auf thematischer Kühnheit, sondern auf der Erfindung neuer Verfahren des Erzählens. Die Mischung aus dokumentarischer Aufmerksamkeit, szenischer Komposition und unaufgeregter, aber energischer Sprache wirkt bis heute fort. Leserinnen und Leser finden in diesen Texten einen Maßstab für Genauigkeit und Formbewusstsein, der die Wahrnehmung schärft. Dass diese Prosa weder belehrt noch schmeichelt, sondern fordert, erklärt ihre Dauerhaftigkeit: Sie bleibt aktuell, weil sie weder auf Moden reagiert noch sich dem Augenblick ausliefert, sondern in der Sache und in der Sprache Maß hält.
Die vorliegende Sammlung will die Vielfalt von Flauberts Werk als zusammenhängende Erfahrung zugänglich machen. Sie lädt zum Querlesen ein: vom groß angelegten Roman zur konzentrierten Erzählung, vom inneren Protokoll zur Reisebeschreibung, vom Alltagsdetail zum historischen Tableau. Die Texte sind ohne Vorkenntnisse lesbar und gewinnen zugleich, wenn man ihre formalen und motivischen Korrespondenzen wahrnimmt. So entsteht ein Porträt des Autors als konsequenter Arbeiter an der Prosa und als aufmerksamem Beobachter seiner Welt. Wer Flaubert hier begegnet, findet ein Werk, das sich durch Strenge öffnet und durch Genauigkeit berührt.
Autorenbiografie
Gustave Flaubert (1821–1880) gilt als einer der prägenden Romanciers des 19. Jahrhunderts und als Hauptfigur des literarischen Realismus. Sein Werk verbindet formale Strenge, historische Recherche und eine radikal unpersönliche Erzählhaltung. Mit der Suche nach dem mot juste und einer nüchternen, doch musikalisch gesetzten Prosa beeinflusste er Generationen von Autorinnen und Autoren. Von der Provinz bis zu antiken Schauplätzen, von psychologischer Analyse bis zur Reisebeobachtung reicht sein Spektrum. Titel wie Frau Bovary (Madame Bovary), Die Schule der Empfindsamkeit und Salambo markieren zentrale Stationen, während kürzere Erzählungen und Reiseschriften die Vielseitigkeit seines Projekts eindrucksvoll erweitern.
Flaubert erhielt eine schulische Ausbildung in der Provinz und wechselte später zum Jurastudium nach Paris, wandte sich jedoch endgültig der Literatur zu. Begegnungen mit zeitgenössischen Strömungen – von der Spätromantik bis zu realistischen Positionen – schärften seinen Anspruch auf künstlerische Objektivität. Maßgeblich war sein Studium klassischer Prosa und historischer Quellen, das ihn zu minutiöser Recherche verpflichtete. Reisen und die Teilnahme an literarischen Zirkeln festigten Stil und Arbeitsweise. Die lange Freundschaft mit dem Schriftsteller und Fotografen Maxime Du Camp, mit dem er aufbrach, um Länder des Mittelmeerraums zu erkunden, förderte seine Beobachtungsgabe und bereitete spätere Stoffe und Formen vor.
Seine frühen Arbeiten zeigen eine tastende Suche nach Form und Stimme. In Gedanken eines Zweiflers (Erinnerungen eines Verrückten), einer autobiografisch gefärbten Geschichte, prüft Flaubert Skepsis, Selbstbeobachtung und das Spannungsverhältnis zwischen Gefühl und Reflexion. November vertieft diese Erfahrung als nüchternes Protokoll jugendlicher Desillusion, während Leidenschaft und Tugend die moralischen Forderungen der Gesellschaft gegen die Impulse des Herzens ausspielt. Bereits hier wird der Wille zur genauen, unpathetischen Formulierung sichtbar, verbunden mit einer Distanz, die später zur Markenzeichen werden sollte. Die Themen, die er hier erprobt, liefern psychologische und stilistische Bausteine seiner reifen Prosakunst.
Mit Frau Bovary (Madame Bovary) erreichte Flaubert einen ersten großen Durchbruch. Der Roman über das Begehren nach einem intensiveren Leben und die Ernüchterungen der Provinzgesellschaft verband literarische Präzision mit nüchterner Beobachtung und einer bemerkenswert unpersönlichen Erzählhaltung. Die Veröffentlichung provozierte einen aufsehenerregenden Prozess wegen vermeintlicher Sittenverletzung, der mit einem Freispruch endete und das Buch schlagartig bekannt machte. Seither gilt es als Inbegriff realistischer Prosa: eine Studie der Illusionen, ohne moralisierenden Kommentar, getragen vom rigorosen Streben nach formaler Perfektion. Flaubert etablierte damit die Tonlage, die sein späteres Werk konsequent weiterentwickelte. Die zeitgenössische Resonanz schwankte, doch der nachhaltige Einfluss ist unbestritten.
Ein zweiter Zentralroman ist Die Schule der Empfindsamkeit, ein weitgespanntes Panorama aus Liebesbegehren, gesellschaftlichen Erwartungen und politischer Bewegung. Flaubert zeichnet die Bildung eines jungen Mannes im Paris der Umbruchszeit nach und verbindet Privaterfahrungen mit Beobachtungen der städtischen Moderne, wirtschaftlicher Dynamiken und Milieuwechsel. Statt dramatischer Zuspitzungen setzt er auf Verlauf, Tonlagen und die beharrliche Genauigkeit des Alltags. So entsteht eine kunstvolle Chronik enttäuschter Hoffnungen, die weniger durch Handlung als durch Haltung wirkt. Die Verbindung von psychologischer Nüchternheit und sozialer Weite macht das Buch zu einem Scharnier seines Schaffens und zu einem Maßstab realistischer Erzählkunst.
Nach der Provinz und der modernen Stadt wandte sich Flaubert mit Salambo der Antike und einem exotischen Schauplatz zu. Der Roman beruht auf intensiver Quellenlektüre und archäologischem Interesse; er sucht Anschaulichkeit nicht durch Fantasie, sondern durch historisches Detail und kontrollierten Rhythmus. Seine Reiseschriften vertiefen diese Blickrichtung. Über Feld und Strand, entstanden auf Wanderungen mit Maxime Du Camp, verbindet Landschaftsbeobachtung mit stilistischer Disziplin. Briefe aus dem Orient dokumentieren Eindrücke einer längeren Fahrt durch den östlichen Mittelmeerraum und zeigen, wie Notiz, Beschreibung und Reflexion in Flauberts Werk ineinandergreifen und Stoffe für die erzählerische Arbeit bereiten.
Zu seinen späten Meisterstücken der Kurzprosa zählen Ein einfältig Herz, Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien und Herodias. In ihrer formalen Konzentration verbinden sie mythische Überhöhung, historische Stoffe und stille Alltagsdramen zu eindringlichen Miniaturen. Sie zeigen Flauberts Ideal einer unpersönlichen, präzisen Sprache auf engem Raum, ohne Pathos und ohne erklärende Moral. In den letzten Jahren hielt er an disziplinierter Arbeit und rigoroser Revision fest. Sein Vermächtnis wirkt in realistischen, naturalistischen und modernen Erzählverfahren fort; die heute anhaltende Rezeption gründet auf der Verbindlichkeit des Stils und der unbestechlichen, doch menschenfreundlichen Beobachtung.
Historischer Kontext
Gustave Flaubert (1821–1880) schrieb in einem Frankreich, das in kurzer Folge die Julimonarchie, die Zweite Republik, das Zweite Kaiserreich und den Beginn der Dritten Republik erlebte. Seine in dieser Sammlung versammelten Texte reichen von frühen Versuchen der 1830er und 1840er Jahre bis zu späten Meisterwerken der 1870er Jahre. Sie bewegen sich zwischen zeitgenössischer Provinz, revolutionärem Paris, antiker Welt und legendären Stoffen. Dadurch spiegeln sie nicht nur die raschen politischen Umbauten, sondern auch die kulturelle Vielfalt und die Spannungen einer Gesellschaft, die Modernisierung, Säkularisierung und imperialen Blick zugleich durchlief und literarisch neu zu fassen suchte.
Die Jahrzehnte um 1848 prägte eine Abfolge politischer Erschütterungen: wirtschaftliche Krisen, soziale Proteste, der Sturz der Julimonarchie, die Revolution und die kurze Zweite Republik, gefolgt vom autoritären Zweiten Kaiserreich. Parallel verdichteten sich Industrialisierung, Verstädterung und neue Klassenkonstellationen. Diese Umwälzungen schufen eine bürgerliche Öffentlichkeit mit ambivalenten Normen und Ansprüchen. Flaubert beobachtete diese Welt ohne programmatische Parteinahme, aber mit kompromissloser Genauigkeit – ein methodischer Realismus, der in verschiedenen Werken der Sammlung, von Frau Bovary bis Die Schule der Empfindsamkeit, die Illusionen, Routinen und Selbstbilder dieser Gesellschaft aus historisch bestimmbarer Nähe beleuchtet.
Der literarische Markt expandierte stark: Zeitungen, Revue-Formate und der Fortsetzungsdruck vergrößerten Reichweite und Kontrolle zugleich. Frau Bovary erschien 1856 in der Revue de Paris und führte 1857 zu einem aufsehenerregenden Prozess wegen „Verletzung der Sittlichkeit“, der mit einem Freispruch endete. Diese Mischung aus medialer Verbreitung und juristischer Überwachung prägte Flauberts Bedingungen des Publizierens. Zugleich stärkten Leihbibliotheken und verbesserte Transportwege den Buchhandel. Die wachsende Leserschaft erwartete zugleich Unterhaltung und „Wahrheit“. Flaubert antwortete darauf mit einer Ästhetik der Genauigkeit, die sich der Reportage-Mechanik entzieht und doch von ihr profitiert.
Frau Bovary richtet den Blick auf die französische Provinz der Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Sphäre der kleinbürgerlichen Ambition, religiösen Formen und aufkommender Konsumverführungen. Die öffentliche Debatte um das Buch kreiste weniger um Technik als um Moral, Leserschaft und Geschlechterrollen, was den Streit zwischen künstlerischer Freiheit und sozialer Norm sichtbar machte. Spätere Deutungen prägten mit „Bovarysme“ einen Begriff für eskapistische Selbsttäuschung, der weit über den Roman hinaus verwandt wurde. Historisch markiert das Werk die Zuspitzung des Konflikts zwischen literarischem Realismus und bürgerlicher Sittenpolitik im Frankreich des Zweiten Kaiserreichs.
Die Schule der Empfindsamkeit (L’Éducation sentimentale, 1869) entstand vor dem Hintergrund der Erfahrung der 1840er Jahre und der Revolution von 1848. Der Roman verdichtet politische Hoffnungen, soziale Mobilität und Ernüchterung einer Generation, die in Vereinen, Salons und auf den Straßen nach Orientierung suchte. Flaubert liefert dabei kein revolutionäres Programm, sondern eine historisch genaue Topographie von Milieus, Ideenmoden und ökonomischen Interessen. Der anfänglich zurückhaltenden Aufnahme folgte eine Neubewertung im 20. Jahrhundert, die das Werk als präzise Chronik politischer und emotionaler Desillusion an einem Scharnierpunkt der französischen Moderne wahrnahm.
Salambo (1862) gehört zur Welle historistischer Imagination des 19. Jahrhunderts, die sich auf philologische und archäologische Forschung stützte. Flaubert reiste 1858 nach Nordafrika, um Schauplätze und Überlieferungen zu prüfen; antike Quellen wie Polybios informierten seine Rekonstruktion der Söldnerkriege in Karthago. Der Roman steht zugleich im Feld des zeitgenössischen Orientalismus: Er bedient das Interesse an altertümlicher Fremde und exponiert die Spannungen einer europäischen Sicht auf den „Orient“. Unter dem Zweiten Kaiserreich, das Antike und Exotik schätzte, traf das Werk auf ein Publikum, das historische Genauigkeit und spektakuläre Anschaulichkeit verlangte.
Die späten Erzählungen Ein einfältig Herz, Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien und Herodias (als Zyklus 1877 erschienen) bündeln Flauberts reife Formkunst. Sie verbinden alltägliche Frömmigkeit, mittelalterliche Legendenwelt und biblische Antike mit nüchterner Klarheit. Historisch fallen sie in die frühe Dritte Republik, die moralische Selbstvergewisserung, Bildungsreformen und eine erneuerte Debattenkultur erlebte. Die Erzählungen reagierten nicht programmatisch, sondern durch präzise, häufig knappe Darstellung, die im Lesepublikum Anerkennung fand. Sie zeigen, wie Flaubert historische Stoffe und gegenwärtige Sensibilitäten ohne Zeitfarbenmalerei, doch unter genauer Kenntnis ihrer kulturellen Kontexte gestaltet.
Die frühen Texte Gedanken eines Zweiflers (Erinnerungen eines Verrückten), November und Leidenschaft und Tugend stammen aus den späten 1830er und frühen 1840er Jahren. Sie tragen Züge der romantischen Innenschau und des experimentellen Erzählens. Mehrere dieser Schriften wurden erst postum gedruckt und dokumentieren die Werkgenese vor den großen Romanen. Historisch geben sie Einblick in eine Generation, die zwischen klassizistischen Bildungsnormen, romantischem Pathos und der aufkommenden Forderung nach sachlicher Beobachtung oszillierte. Aus ihnen lässt sich der Weg zu Flauberts späterer Unpersönlichkeit im Stil ablesen, ohne dass sie selbst bereits die ausgereifte Technik des Realismus erreichen.
Über Feld und Strand (Par les champs et par les grèves, 1847), gemeinsam mit Maxime Du Camp verfasst, ist in einer Phase entstanden, in der Reiseberichte als Beobachtungsprosa beliebt wurden. Die Wanderung durch westfranzösische Landschaften dokumentiert Regionen am Vorabend politischer und ökonomischer Umbrüche. Zugleich zeigt der Text, wie Alltagskultur, Dialekte und Arbeitswelten literarisch erfasst werden konnten, ohne sich dem Folklorismus zu überlassen. Er steht im Kontext wachsender Mobilität und eines Interesses an „innerer Ethnographie“, das Frankreichs Provinzen zu Forschungsfeldern machte und literarische Verfahren der genauen Beschreibung beförderte.
Die Briefe aus dem Orient reflektieren Flauberts Reise von 1849 bis 1851 durch Ägypten, das Levantegebiet, Kleinasien und Griechenland. Sie entstanden im Zeitalter der Tanzimat-Reformen im Osmanischen Reich, das europäische Beobachter besonders aufmerksam verfolgten. Maxime Du Camp nutzte auf der Reise die neue Fotografie; Text und Bild verknüpften sich zu einem Wissensregime der Anschauung. Flauberts Briefe liefern keine ethnographischen Systeme, doch ein genaues Register von Eindrücken, das Europas neugierigen Blick auf Städte, Monumente und soziale Praktiken spiegelt. Zugleich markiert die Korrespondenz eine historische Phase intensiver Reise- und Wissenszirkulation zwischen Mittelmeerraum und Westeuropa.
Flauberts Realismus war keine soziologische Doktrin, sondern eine stilistische Ethik. Sein berühmtes Streben nach dem mot juste und das laute Korrekturlesen am „gueuloir“ in Croisset stehen für eine Arbeitshaltung, die Detailtreue und rhythmische Strenge verlangte. Historisch korrespondiert diese Arbeit an der Form mit der Ausdifferenzierung philologischer und historischer Wissenschaften. Die in der Sammlung versammelten Texte zeigen die Reichweite dieser Methode: von der Provinzbeobachtung bis zur antiken Szene. Indem Flaubert Person und Autorhaltung zurücknahm, antwortete er auf ein Publikum, das Fakten verlangte, aber auch an Kunstmitteln der Darstellung gemessen wurde.
Das intellektuelle Klima der Zeit war von Positivismus, Naturwissenschaften und neuem Quellenkritizismus geprägt. Flaubert wuchs als Sohn eines leitenden Chirurgen in Rouen in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus auf; medizinische Diskurse und beobachtende Nüchternheit waren ihm früh präsent. Dieses Umfeld beförderte eine Haltung, die Erscheinungen auf Präzision hin befragt, ohne sie moralisch zu taxieren. In Romanen und Erzählungen der Sammlung wird diese Haltung sichtbar: Figuren, Räume und Gegenstände erhalten Kontur durch genaue, vielfach sachorientierte Sprache, die die Lektüre an die Stelle von Sentenz und Tendenz setzt – eine Signatur der literarischen Moderne.
Die bürgerliche Frauenbildung, die Praxis des Lesens von Leihromanen, religiöse Erneuerungen und der Druck konventioneller Moralrahmen bilden den gesellschaftlichen Hintergrund, vor dem Werke wie Frau Bovary und Ein einfältig Herz gelesen wurden. Der Katholizismus blieb in vielen Regionen kulturell prägend, während urbanes Leben säkulare Routinen verstärkte. Diese Koexistenz erzeugte Spannungen zwischen Frömmigkeit, sozialem Aufstieg und privater Aspiration. Flaubert nutzte sie nicht, um Thesen zu illustrieren, sondern um die sozialen Register einer Epoche hörbar zu machen, in der Individuen vermehrt durch Medien, Waren und Rollenbilder adressiert wurden.
Exotismus und koloniale Expansion prägten die französische Imagination des 19. Jahrhunderts. Frankreichs Präsenz in Nordafrika seit den 1830er Jahren, wissenschaftliche Expeditionen und Sammlungen formten den Blick auf Antike und Gegenwart des Mittelmeerraums. Salambo und die Orientbriefe stehen in diesem Feld: Sie profitieren von gesteigertem Quelleninteresse und stehen zugleich späterer Kritik an orientalistischen Stereotypen gegenüber. Diese doppelte Verortung macht die Texte historisch bedeutsam, weil sie zeigen, wie Forschung, Reise und Fiktion ein Wissensarsenal erzeugten, das europäische Lesarten der Fremde stabilisierte und zugleich – durch penible Genauigkeit – irritieren konnte.
Die Rechts- und Medienordnung des Zweiten Kaiserreichs stärkte die Zensurmöglichkeiten und machte Prozesse wie den von 1857 möglich. Zugleich förderten Infrastruktur und Verlage die Reichweite von Büchern. Flauberts spätere Veröffentlichungspraxis profitierte unter der Dritten Republik von einer liberaleren Öffentlichkeit. Die Sammlung zeigt daher auch institutionelle Geschichte: dieselben Verfahren realistischer Darstellung, die einst Anstoß erregten, wurden später als Maßstäbe literarischer Sorgfalt gewürdigt. Diese Verschiebung der Rezeptionsnormen erklärt, warum Texte wie die drei Erzählungen von 1877 früh breite Anerkennung fanden, während andere zunächst Streit auslösten.
In der literarischen Geschichte wurde Flaubert zu einem Bezugspunkt für Naturalisten, Symbolisten und spätere Romanautoren. Seine prägnante Nutzung der erlebten Rede prägte Erzähltheorie und Stilreflexion, ohne dass er als „Erfinder“ allein zu nennen wäre. Der Begriff „Bovarysme“, von Jules de Gaultier zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt, zeigt, wie seine Figurenwelten zu kulturkritischen Kategorien wurden. Auch Historiker des Jahres 1848 und der Provinzkultur griffen auf Flauberts minutiöse Szenarien zurück, um mentale Dispositionen und soziale Codes der Zeit zu diskutieren – eine anhaltende, quellengesättigte Wirkung.
Als Ganzes kommentiert die Sammlung die Moderne im Entstehen: die Verrechtlichung des öffentlichen Lebens, die Expansion der Märkte, die Neuordnung von Geschlechter- und Klassenrollen, die Wiederentdeckung und Deutung der Antike, das Reisen als Wissenspraxis. Indem sie frühe und späte Texte zusammenführt, macht sie sichtbar, wie sich Flauberts Verfahren aus romantischer Innenschau zur unpersönlichen Genauigkeit verschob. Spätere Lektüren haben diese Spannweite als Stärke erkannt: Die Werke sind zugleich Dokumente ihrer Zeit und Prüfsteine des literarischen Realismus, an denen Debatten über Ethik der Darstellung, Orientalismus und die Macht der Sprache bis heute ansetzen.
Synopsis (Auswahl)
Frau Bovary (Madame Bovary)
Im Zentrum steht eine junge Arztgattin auf dem französischen Land, deren Sehnsucht nach einem glanzvolleren Leben mit der alltäglichen Provinz kollidiert. Zwischen romantischen Vorstellungen, gesellschaftlichen Erwartungen und den Begrenzungen ihrer Umgebung entstehen Spannungen, die ihre Entscheidungen prägen. Die Erzählung verbindet kühle, genaue Milieuschilderung mit leiser Ironie und schonungsloser Beobachtung psychologischer Regungen.
Salambo
Ein historischer Roman, der nach einem großen Krieg in Karthago spielt und den Machtkampf zwischen Stadt, Kult und aufständischen Söldnern ausbreitet. Rituale, Opfer und politisches Kalkül verschränken sich mit einer von Pracht und Grausamkeit geprägten Welt. Der Ton ist opulent und bildhaft, getragen von akribischer Detailfreude und einer Faszination für das Fremde.
Die Schule der Empfindsamkeit
Ein junger Mann bewegt sich durch Paris, Beziehungen und Ambitionen, während sich ein Zeitalter gesellschaftlicher Umbrüche abzeichnet. Begegnungen, Wünsche und verpasste Möglichkeiten bilden ein weites Gesellschaftspanorama, in dem Ideale mit Realität kollidieren. Die Prosa wirkt ruhig und analytisch; statt dramatischer Wendungen dominieren Beobachtung, Entzauberung und Zeitbild.
Frühe Prosatexte: Gedanken eines Zweiflers (Erinnerungen eines Verrückten), November, Leidenschaft und Tugend
Gedanken eines Zweiflers (Erinnerungen eines Verrückten) und November sind introspektive Selbstbefragungen eines jungen Bewusstseins, das zwischen Skepsis, Schwärmerei und erster Liebe seine Haltung zur Welt sucht. Leidenschaft und Tugend stellt diese Spannung als moralisch-psychologische Versuchungserzählung dar, in der Begehren, Pflicht und Ideal einander belauern. Der Ton schwankt zwischen emphatischer Rhetorik und nüchterner Selbstdistanz; sichtbar werden bereits Illusion und Ernüchterung sowie der Drang zur stilistischen Präzision.
Späte Erzählungen: Ein einfältig Herz, Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien, Herodias
Ein einfältig Herz zeichnet in ruhigen, genauen Bildern das Leben einer Dienerin nach, deren stille Treue und Glaube dem Alltäglichen eine leise Würde verleihen. Die Legende von Sankt Julian dem Gastfreien gestaltet eine mittelalterliche Vita als archaisches Schicksalsdrama voller Gewalt, Bewährung und Gnade. Herodias verdichtet die biblische Hofwelt in ein Spiel aus Macht, Verführung und religiöser Symbolik; stilistisch wirken Strenge, Rhythmus und ikonische Bildhaftigkeit.
Reiseprosa: Über Feld und Strand; Briefe aus dem Orient
Über Feld und Strand sammelt Eindrücke von Landschaften, Küsten und Städten und beobachtet Sitten, Stimmen sowie geologische und historische Spuren mit sachlichem Blick. Briefe aus dem Orient bieten Reisebilder und Notate aus dem östlichen Mittelmeerraum, in denen Altertum, Gegenwart und sinnliche Wahrnehmung ineinandergreifen. Beide Texte verbinden genaue Beschreibung mit Momentaufnahmen von Stimmungen und zeigen Interesse an Topographie, Kultur und der Arbeit am präzisen Satz.
Wiederkehrende Themen und Stil
Immer wieder stehen Begehren und Ernüchterung, Illusion und soziale Realität sowie Macht und Ritual einander gegenüber. Charakteristisch sind ein zurückhaltender Erzählerstandpunkt, detailreiche Milieu- und Sachbeschreibungen und ein Ton zwischen ironischer Kühle und stiller Empathie. Zwischen Realismus und Exotismus, Recherche und Symbolik sucht die Prosa die treffende Formulierung und Rhythmik, die das Sichtbare wie das Unausgesprochene trägt.
Gesammelte Werke von Gustave Flaubert
Romane:
Erzählungen:
Reisebeschreibungen:
Frau Bovary (Madame Bovary)
Madame Bovary, 1858
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Es war Arbeitsstunde. Da trat der Rektor ein, ihm zur Seite ein »Neuer«, in gewöhnlichem Anzuge. Der Pedell hinter den beiden, Schulstubengerät in den Händen. Alle Schüler erhoben sich von ihren Plätzen, wobei man so tat, als sei man aus seinen Studien aufgescheucht worden. Wer eingenickt war, fuhr mit auf.
Der Rektor winkte ab. Man setzte sich wieder hin. Darauf wandte er sich zu dem die Aufsicht führenden Lehrer.
»Herr Roger!« lispelte er. »Diesen neuen Zögling hier empfehle ich Ihnen besonders. Er kommt zunächst in die Quinta. Bei löblichem Fleiß und Betragen wird er aber in die Quarta versetzt, in die er seinem Alter nach gehört.«
Der Neuling blieb in dem Winkel hinter der Türe stehen. Man konnte ihn nicht ordentlich sehen, aber offenbar war er ein Bauernjunge, so ungefähr fünfzehn Jahre alt und größer als alle andern. Die Haare trug er mit Simpelfransen in die Stirn hinein, wie ein Dorfschulmeister. Sonst sah er gar nicht dumm aus, nur war er höchst verlegen. So schmächtig er war, beengte ihn sein grüner Tuchrock mit schwarzen Knöpfen doch sichtlich, und durch den Schlitz in den Ärmelaufschlägen schimmerten rote Handgelenke hervor, die zweifellos die freie Luft gewöhnt waren. Er hatte gelbbraune, durch die Träger übermäßig hochgezogene Hosen an und blaue Strümpfe. Seine Stiefel waren derb, schlecht gewichst und mit Nägeln beschlagen.
Man begann die fertigen Arbeiten vorzulesen. Der Neuling hörte aufmerksamst zu, mit wahrer Kirchenandacht, wobei er es nicht einmal wagte, die Beine übereinander zu schlagen noch den Ellenbogen aufzustützen. Um zwei Uhr, als die Schulglocke läutete, mußte ihn der Lehrer erst besonders auffordern, ehe er sich den andern anschloß.
Es war in der Klasse Sitte, beim Eintritt in das Unterrichtszimmer die Mützen wegzuschleudern, um die Hände frei zu bekommen. Es kam darauf an, seine Mütze gleich von der Tür aus unter die richtige Bank zu facken, wobei sie unter einer tüchtigen Staubwolke laut aufklatschte. Das war so Schuljungenart.
Sei es nun, daß ihm dieses Verfahren entgangen war oder daß er nicht gewagt hatte, es ebenso zu machen, kurz und gut: als das Gebet zu Ende war, hatte der Neuling seine Mütze noch immer vor sich auf den Knien. Das war ein wahrer Wechselbalg von Kopfbedeckung. Bestandteile von ihr erinnerten an eine Bärenmütze, andre an eine Tschapka, wieder andre an einen runden Filzhut, an ein Pelzbarett, an ein wollnes Käppi, mit einem Worte: an allerlei armselige Dinge, deren stumme Häßlichkeit tiefsinnig stimmt wie das Gesicht eines Blödsinnigen. Sie war eiförmig, und Fischbeinstäbchen verliehen ihr den inneren Halt; zu unterst sah man drei runde Wülste, darüber (voneinander durch ein rotes Band getrennt) Rauten aus Samt und Kaninchenfell und zuoberst eine Art Sack, den ein vieleckiger Pappdeckel mit kunterbunter Schnurenstickerei krönte und von dem herab an einem ziemlich dünnen Faden eine kleine goldne Troddel hing. Diese Kopfbedeckung war neu, was man am Glanze des Schirmes erkennen konnte.
»Steh auf!« befahl der Lehrer.
Der Junge erhob sich. Dabei entglitt ihm sein Turban, und die ganze Klasse fing an zu kichern. Er bückte sich, das Mützenungetüm aufzuheben. Ein Nachbar stieß mit dem Ellenbogen daran, so daß es wiederum zu Boden fiel. Ein abermaliges Sich-darnach-bücken.
»Leg doch deinen Helm weg!« sagte der Lehrer, ein Witzbold.
Das schallende Gelächter der Schüler brachte den armen Jungen gänzlich aus der Fassung, und nun wußte er gleich gar nicht, ob er seinen »Helm« in der Hand behalten oder auf dem Boden liegen lassen oder aufsetzen sollte. Er nahm Platz und legte die Mütze über seine Knie.
»Steh auf!« wiederholte der Lehrer, »und sag mir deinen Namen!«
Der Neuling stotterte einen unverständlichen Namen her.
»Noch mal!«
Dasselbe Silbengestammel machte sich hörbar, von dem Gelächter der Klasse übertönt.
»Lauter!« rief der Lehrer. »Lauter!«
Nunmehr nahm sich der Neuling fest zusammen, riß den Mund weit auf und gab mit voller Lungenkraft, als ob er jemanden rufen wollte, das Wort von sich: »Kabovary!«
Höllenlärm erhob sich und wurde immer stärker; dazwischen gellten Rufe. Man brüllte, heulte, grölte wieder und wieder: »Kabovary! Kabovary!« Nach und nach verlor sich der Spektakel in vereinzeltes Brummen, kam mühsam zur Ruhe, lebte aber in den Bankreihen heimlich weiter, um da und dort plötzlich als halbersticktes Gekicher wieder aufzukommen, wie eine Rakete, die im Verlöschen immer wieder noch ein paar Funken sprüht.
Währenddem ward unter einem Hagel von Strafarbeiten die Ordnung in der Klasse allmählich wiedergewonnen, und es gelang dem Lehrer, den Namen »Karl Bovary« festzustellen, nachdem er sich ihn hatte diktieren, buchstabieren und dann noch einmal im ganzen wiederholen lassen. Alsdann befahl er dem armen Schelm, sich auf die Strafbank dicht vor dem Katheder zu setzen. Der Junge wollte den Befehl ausführen, aber kaum hatte er sich in Gang gesetzt, als er bereits wieder stehen blieb.
»Was suchst du?« fragte der Lehrer.
»Meine Mü…«, sagte er schüchtern, indem er mit scheuen Blicken Umschau hielt.
»Fünfhundert Verse die ganze Klasse!«
Wie das Quos ego bändigte die Stimme, die diese Worte wütend ausrief, einen neuen Sturm im Entstehen.
»Ich bitte mir Ruhe aus!« fuhr der empörte Schulmeister fort, während er sich mit seinem Taschentuche den Schweiß von der Stirne trocknete. »Und du, du Rekrut du, du schreibst mir zwanzigmal den Satz auf: Ridiculus sum!« Sein Zorn ließ nach. »Na, und deine Mütze wirst du schon wiederfinden. Die har dir niemand gestohlen.«
Alles ward wieder ruhig. Die Köpfe versanken in den Heften, und der Neuling verharrte zwei Stunden lang in musterhafter Haltung, obgleich ihm von Zeit zu Zeit mit einem Federhalter abgeschwuppte kleine Papierkugeln ins Gesicht flogen. Erwischte sich jedesmal mit der Hand ab, ohne sich weiter zu bewegen noch die Augen aufzuschlagen.
Abends, im Arbeitssaal, holte er seine Ärmelschoner aus seinem Pult, brachte seine Habseligkeiten in Ordnung und liniierte sich sorgsam sein Schreibpapier. Die andern beobachteten, wie er gewissenhaft arbeitete; er schlug alle Wörter im Wörterbuche nach und gab sich viel Mühe. Zweifellos verdankte er es dem großen Fleiße, den er an den Tag legte, daß man ihn nicht in der Quinta zurückbehielt; denn wenn er auch die Regeln ganz leidlich wußte, so verstand er sich doch nicht gewandt auszudrücken. Der Pfarrer seines Heimatdorfes hatte ihm kaum ein bißchen Latein beigebracht, und aus Sparsamkeit war er von seinen Eltern so spät wie nur möglich auf das Gymnasium geschickt worden.
Sein Vater, Karl Dionys Barthel Bovary, war Stabsarzt a.D.; er hatte sich um 1812 bei den Aushebungen etwas zuschulden kommen lassen, worauf er den Abschied nehmen mußte. Er setzte nunmehr seine körperlichen Vorzüge in bare Münze um und ergatterte sich im Handumdrehen eine Mitgift von sechzigtausend Franken, die ihm in der Person der Tochter eines Hutfabrikanten in den Weg kam. Das Mädchen hatte sich in den hübschen Mann verliebt. Er war ein Schwerenöter und Prahlhans, der sporenklingend einherstolzierte, Schnurr-und Backenbart trug, die Hände voller Ringe hatte und in seiner Kleidung auffällige Farben liebte. Neben seinem Haudegentum besaß er das gewandte Getue eines Ellenreiters. Sobald er verheiratet war, begann er zwei, drei Jahre auf Kosten seiner Frau zu leben, aß und trank gut, schlief bis in den halben Tag hinein und rauchte aus langen Porzellanpfeifen. Nachts pflegte er sehr spät heimzukommen, nachdem er sich in Kaffeehäusern herumgetrieben hatte. Als sein Schwiegervater starb und nur wenig hinterließ, war Bovary empört darüber. Er übernahm die Fabrik, büßte aber Geld dabei ein, und so zog er sich schließlich auf das Land zurück, wovon er sich goldne Berge erträumte. Aber er verstand von der Landwirtschaft auch nicht mehr als von der Hutmacherei, ritt lieber spazieren, als daß er seine Pferde zur Arbeit einspannen ließ, trank seinen Apfelwein flaschenweise selber, anstatt ihn in Fässern zu verkaufen, ließ das fetteste Geflügel in den eignen Magen gelangen und schmierte sich mit dem Speck seiner Schweine seine Jagdstiefel. Auf diesem Wege sah er zu guter Letzt ein, daß es am tunlichsten für ihn sei, sich in keinerlei Geschäfte mehr einzulassen.
Für zweihundert Franken Jahrespacht mietete er nun in einem Dorfe im Grenzgebiete von Caux und der Pikardie ein Grundstück, halb Bauernhof, halb Herrenhaus. Dahin zog er sich zurück fünfundvierzig Jahre alt, mit Gott und der Welt zerfallen, gallig und mißgünstig zu jedermann. Von den Menschen angeekelt, wie er sagte, wollte er in Frieden für sich hinleben.
Seine Frau war dereinst toll verliebt in ihn gewesen. Aber unter tausend Demütigungen starb ihre Liebe doch rettungslos.
Ehedem heiter, mitteilsam und herzlich, war sie allmählich (just wie sich abgestandner Wein zu Essig wandelt) mürrisch, zänkisch und nervös geworden. Ohne zu klagen, hatte sie viel gelitten, wenn sie immer wieder sah, wie ihr Mann hinter allen Dorfdirnen her war und abends müde und nach Fusel stinkend aus irgendwelcher Spelunke zu ihr nach Haus kam. Ihr Stolz hatte sich zunächst mächtig geregt, aber schließlich schwieg sie, würgte ihren Grimm in stummem Stoizismus hinunter und beherrschte sich bis zu ihrem letzten Stündlein. Sie war unablässig tätig und immer auf dem Posten. Sie war es, die zu den Anwälten und Behörden ging. Sie wußte, wenn Wechsel fällig waren; sie erwirkte ihre Verlängerung. Sie machte alle Hausarbeiten, nähte, wusch, beaufsichtigte die Arbeiter und führte die Bücher, während der Herr und Gebieter sich um nichts kümmerte, aus seinem Zustande griesgrämlicher Schläfrigkeit nicht herauskam und sich höchstens dazu ermannte, seiner Frau garstige Dinge zu sagen. Meist hockte er am Kamin, qualmte und spuckte ab und zu in die Asche.
Als ein Kind zur Welt kam, mußte es einer Amme gegeben werden; und als es wieder zu Hause war, wurde das schwächliche Geschöpf grenzenlos verwöhnt. Die Mutter nährte es mit Zuckerzeug. Der Vater ließ es barfuß herumlaufen und meinte höchst weise obendrein, der Kleine könne eigentlich ganz nackt gehen wie die Jungen der Tiere. Im Gegensatz zu den Bestrebungen der Mutter hatte er sich ein bestimmtes männliches Erziehungsideal in den Kopf gesetzt, nach welchem er seinen Sohn zu modeln sich Mühe gab. Er sollte rauh angefaßt werden wie ein junger Spartaner, damit er sich tüchtig abhärte. Er mußte in einem ungeheizten Zimmer schlafen, einen ordentlichen Schluck Rum vertragen und auf den »kirchlichen Klimbim« schimpfen. Aber der Kleine war von friedfertiger Natur und widerstrebte allen diesen Bemühungen. Die Mutter schleppte ihn immer mit sich herum. Sie schnitt ihm Pappfiguren aus und erzählte ihm Märchen; sie unterhielt sich mit ihm in endlosen Selbstgesprächen, die von schwermütiger Fröhlichkeit und wortreicher Zärtlichkeit überquollen. In ihrer Verlassenheit pflanzte sie in das Herz ihres Jungen alle ihre eigenen unerfüllten und verlorenen Sehnsüchte. Im Traume sah sie ihn erwachsen, hochangesehen, schön, klug, als Beamten beim Straßen-und Brückenbau oder in einer Ratsstellung. Sie lehrte ihn Lesen und brachte ihm sogar an dem alten Klavier, das sie besaß, das Singen von ein paar Liedchen bei. Ihr Mann, der von gelehrten Dingen nicht viel hielt, bemerkte zu alledem, es sei bloß schade um die Mühe; sie hätten doch niemals die Mittel, den Jungen auf eine höhere Schule zu schicken oder ihm ein Amt oder ein Geschäft zu kaufen. Zu was auch? Dem Kecken gehöre die Welt! Frau Bovary schwieg still, und der Kleine trieb sich im Dorfe herum. Er lief mit den Feldarbeitern hinaus, scheuchte die Krähen auf, schmauste Beeren an den Rainen, hütete mit einer Gerte die Truthähne und durchstreifte Wald und Flur. Wenn es regnete, spielte er unter dem Kirchenportal mit kleinen Steinchen, und an den Feiertagen bestürmte er den Kirchendiener, die Glocken läuten zu dürfen. Dann hängte er sich mit seinem ganzen Gewicht an den Strang der großen Glocke und ließ sich mit emporziehen. So wuchs er auf wie eine Lilie auf dem Felde, bekam kräftige Glieder und frische Farben.
Als er zwölf Jahre alt geworden war, setzte es seine Mutter durch, daß er endlich etwas Gescheites lerne. Er bekam Unterricht beim Pfarrer, aber die Stunden waren so kurz und so unregelmäßig, daß sie nicht viel Erfolg hatten. Sie fanden statt, wenn der Geistliche einmal gar nichts anders zu tun hatte, in der Sakristei, im Stehen, in aller Hast in den Pausen zwischen den Taufen und Begräbnissen. Mitunter, wenn er keine Lust hatte auszugehen, ließ der Pfarrer seinen Schüler nach dem Ave-Maria zu sich holen. Die beiden saßen dann oben im Stübchen. Mücken und Nachtfalter tanzten um die Kerze; aber es war so warm drin, daß der Junge schläfrig wurde, und es dauerte nicht lange, da schnarchte der biedere Pfarrer, die Hände über dem Schmerbauche gefaltet. Es kam auch vor, daß der Seelensorger auf dem Heimwege von irgendeinem Kranken in der Umgegend, dem er das Abendmahl gereicht hatte, den kleinen Vagabunden im Freien erwischte; dann rief er ihn heran, hielt ihm eine viertelstündige Strafpredigt und benutzte die Gelegenheit, ihn im Schatten eines Baumes seine Lektion hersagen zu lassen. Entweder war es der Regen, der den Unterricht störte, oder irgendein Bekannter, der vorüberging. Übrigens war der Lehrer durchweg mit seinem Schüler zufrieden, ja er meinte sogar, der »junge Mann« habe ein gar treffliches Gedächtnis.
So konnte es nicht weitergehen. Frau Bovary ward energisch, und ihr Mann gab widerstandslos nach, vielleicht weil er sich selber schämte, wahrscheinlicher aber aus Ohnmacht. Man wollte nur noch ein Jahr warten; der Junge sollte erst gefirmelt werden.
Darüber hinaus verstrich abermals ein halbes Jahr, dann aber wurde Karl wirklich auf das Gymnasium nach Rouen geschickt. Sein Vater brachte ihn selber hin. Das war Ende Oktober.
Die meisten seiner damaligen Kameraden werden sich kaum noch deutlich an ihn erinnern. Er war ein ziemlich phlegmatischer Junge, der in der Freizeit wie ein Kind spielte, in den Arbeitsstunden eifrig lernte, während des Unterrichts aufmerksam dasaß, im Schlafsaal vorschriftsmäßig schlief und bei den Mahlzeiten ordentlich zulangte. Sein Verkehr außerhalb der Schule war ein Eisengroßhändler in der Handschuhmachergasse, der aller vier Wochen einmal mit ihm ausging, an Sonntagen nach Ladenschluß. Er lief mit ihm am Hafen spazieren, zeigte ihm die Schiffe und brachte ihn abends um sieben Uhr vor dem Abendessen wieder in das Gymnasium. Jeden Donnerstag abend schrieb Karl mit roter Tinte an seine Mutter einen langen Brief, den er immer mit drei Oblaten zuklebte. Hernach vertiefte er sich wieder in seine Geschichtshefte, oder er las in einem alten Exemplar von Barthelemys »Reise des jungen Anacharsis«, das im Arbeitssaal herumlag. Bei Ausflügen plauderte er mit dem Pedell, der ebenfalls vom Lande war.
Durch seinen Fleiß gelang es ihm, sich immer in der Mitte der Klasse zu halten; einmal errang er sich sogar einen Preis in der Naturkunde. Aber gegen Ende des dritten Schuljahres nahmen ihn seine Eltern vom Gymnasium fort und ließen ihn Medizin studieren. Sie waren der festen Zuversicht, daß er sich bis zum Staatsexamen schon durchwürgen würde.
Die Mutter mietete ihm ein Stübchen, vier Stock hoch, nach der Eau-de-Robec zu gelegen, im Hause eines Färbers, eines alten Bekannten von ihr. Sie traf Vereinbarungen über die Verpflegung ihres Sohnes, besorgte ein paar Möbelstücke, einen Tisch und zwei Stühle, wozu sie von zu Hause noch eine Bettstelle aus Kirschbaumholz kommen ließ. Des weiteren kaufte sie ein Kanonenöfchen und einen kleinen Vorrat von Holz, damit ihr armer Junge nicht frieren sollte. Acht Tage darnach reiste sie wieder heim, nachdem sie ihn tausend-und abertausendmal ermahnt hatte, ja hübsch fleißig und solid zu bleiben, sintemal er nun ganz allein auf sich selbst angewiesen sei.
Vor dem Verzeichnis der Vorlesungen auf dem schwarzen Brette der medizinischen Hochschule vergingen dem neubackenen Studenten Augen und Ohren. Er las da von anatomischen und pathologischen Kursen, von Kollegien über Physiologie, Pharmazie, Chemie, Botanik, Therapeutik und Hygiene, von Kursen in der Klinik, von praktischen Übungen usw. Alle diese vielen Namen, über deren Herkunft er sich nicht einmal klar war, standen so recht vor ihm wie geheimnisvolle Pforten in das Heiligtum der Wissenschaft.
Er lernte gar nichts. So aufmerksam er auch in den Vorlesungen war, er begriff nichts. Um so mehr büffelte er. Er schrieb fleißig nach, versäumte kein Kolleg und fehlte in keiner Übung. Er erfüllte sein tägliches Arbeitspensum wie ein Gaul im Hippodrom, der in einem fort den Hufschlag hintrottet, ohne zu wissen, was für ein Geschäft er eigentlich verrichtet.
Zu seiner pekuniären Unterstützung schickte ihm seine Mutter allwöchentlich durch den Botenmann ein Stück Kalbsbraten. Das war sein Frühstück, wenn er aus dem Krankenhause auf einen Husch nach Hause kam. Sich erst hinzusetzen, dazu langte die Zeit nicht, denn er mußte alsbald wieder in ein Kolleg oder zur Anatomie oder Klinik eilen, durch eine Unmenge von Straßen hindurch. Abends nahm er an der kargen Hauptmahlzeit seiner Wirtsleute teil. Hinterher ging er hinauf in seine Stube und setzte sich an seine Lehrbücher, oft in nassen Kleidern, die ihm dann am Leibe bei der Rotglut des kleinen Ofens zu dampfen begannen.
An schönen Sommerabenden, wenn die schwülen Gassen leer wurden und die Dienstmädchen vor den Haustüren Ball spielten, öffnete er sein Fenster und sah hinaus. Unten floß der Fluß vorüber, der aus diesem Viertel von Rouen ein häßliches Klein-Venedig machte. Seine gelben, violett und blau schimmernden Wasser krochen träg zu den Wehren und Brücken. Arbeiter kauerten am Ufer und wuschen sich die Arme in der Flut. An Stangen, die aus Speichergiebeln lang hervorragten, trockneten Bündel von Baumwolle in der Luft. Gegenüber, hinter den Dächern, leuchtete der weite klare Himmel mit der sinkenden roten Sonne. Wie herrlich mußte es da draußen im Freien sein! Und dort im Buchenwald wie frisch! Karl holte tief Atem, um den köstlichen Duft der Felder einzusaugen, der doch gar nicht bis zu ihm drang.
Er magerte ab und sah sehr schmächtig aus. Sein Gesicht bekam einen leidvollen Zug, der es beinahe interessant machte. Er ward träge, was gar nicht zu verwundern war, und seinen guten Vorsätzen mehr und mehr untreu. Heute versäumte er die Klinik, morgen ein Kolleg, und allmählich fand er Genuß am Faulenzen und ging gar nicht mehr hin. Er wurde Stammgast in einer Winkelkneipe und ein passionierter Dominospieler. Alle Abende in einer schmutzigen Spelunke zu hocken und mit den beinernen Spielsteinen auf einem Marmortische zu klappern, das dünkte ihn der höchste Grad von Freiheit zu sein, und das stärkte ihm sein Selbstbewußtsein. Es war ihm das so etwas wie der Anfang eines weltmännischen Lebens, dieses Kosten verbotener Freuden. Wenn er hinkam, legte er seine Hand mit geradezu sinnlichem Vergnügen auf die Türklinke. Eine Menge Dinge, die bis dahin in ihm unterdrückt worden waren, gewannen nunmehr Leben und Gestalt. Er lernte Gassenhauer auswendig, die er gelegentlich zum besten gab. Béranger, der Freiheitssänger, begeisterte ihn. Er lernte eine gute Bowle brauen, und zu guter Letzt entdeckte er die Liebe. Dank diesen Vorbereitungen fiel er im medizinischen Staatseramen glänzend durch.
Man erwartete ihn am nämlichen Abend zu Haus, wo sein Erfolg bei einem Schmaus gefeiert werden sollte. Er machte sich zu Fuß auf den Weg und erreichte gegen Abend seine Heimat. Dort ließ er seine Mutter an den Dorfeingang bitten und beichtete ihr alles. Sie entschuldigte ihn, schob den Mißerfolg der Ungerechtigkeit der Examinatoren in die Schuhe und richtete ihn ein wenig auf, indem sie ihm versprach, die Sache ins Lot zu bringen. Erst volle fünf Jahre darnach erfuhr Herr Bovary die Wahrheit. Da war die Geschichte verjährt, und so fügte er sich drein. Übrigens hätte er es niemals zugegeben, daß sein leiblicher Sohn ein Dummkopf sei.
Karl widmete sich von neuem seinem Studium und bereitete sich hartnäckigst auf eine nochmalige Prüfung vor. Alles, was er gefragt werden konnte, lernte er einfach auswendig. In der Tat bestand er das Examen nunmehr mit einer ziemlich guten Note. Seine Mutter erlebte einen Freudentag. Es fand ein großes Festmahl statt.
Wo sollte er seine ärztliche Praxis nun ausüben? In Tostes. Dort gab es nur einen und zwar sehr alten Arzt. Mutter Bovary wartete schon lange auf sein Hinscheiden, und kaum hatte der alte Herr das Zeitliche gesegnet, da ließ sich Karl Bovary auch bereits als sein Nachfolger daselbst nieder.
Aber nicht genug, daß die Mutter ihren Sohn erzogen, ihn Medizin studieren lassen und ihm eine Praxis ausfindig gemacht hatte: nun mußte er auch eine Frau haben. Selbige fand sie in der Witwe des Gerichtsvollziehers von Dieppe, die neben fünfundvierzig Jährlein zwölfhundert Franken Rente ihr eigen nannte. Obgleich sie häßlich war, dürr wie eine Hopfenstange und im Gesicht so viel Pickel wie ein Kirschbaum Blüten hatte, fehlte es der Witwe Dubuc keineswegs an Bewerbern. Um zu ihrem Ziele zu gelangen, mußte Mutter Bovary erst alle diese Nebenbuhler aus dem Felde schlagen, was sie sehr geschickt fertig brachte. Sie triumphierte sogar über einen Fleischermeister, dessen Anwartschaft durch die Geistlichkeit unterstützt wurde.
Karl hatte in die Heirat eingewilligt in der Erwartung, sich dadurch günstiger zu stellen. Er hoffte, persönlich wie pekuniär unabhängiger zu werden. Aber Heloise nahm die Zügel in ihre Hände. Sie drillte ihm ein, was er vor den Leuten zu sagen habe und was nicht. Alle Freitage wurde gefastet. Er durfte sich nur nach ihrem Geschmacke kleiden, und die Patienten, die nicht bezahlten, mußte er auf ihren Befehl hin kujonieren. Sie erbrach seine Briefe, überwachte jeden Schritt, den er tat, und horchte an der Türe, wenn weibliche Wesen in seiner Sprechstunde waren. Jeden Morgen mußte sie ihre Schokolade haben, und die Rücksichten, die sie erheischte, nahmen kein Ende. Unaufhörlich klagte sie über Migräne, Brustschmerzen oder Verdauungsstörungen. Wenn viel Leute durch den Hausflur liefen, ging es ihr auf die Nerven. War Karl auswärts, dann fand sie die Einsamkeit gräßlich; kehrte er heim, so war es zweifellos bloß, weil er gedacht habe, sie liege im Sterben. Wenn er nachts in das Schlafzimmer kam, streckte sie ihm ihre mageren langen Arme aus ihren Decken entgegen, umschlang seinen Hals und zog ihn auf den Rand ihres Bettes. Und nun ging die Jeremiade los. Er vernachlässige sie, er liebe eine andre! Man habe es ihr ja gleich gesagt, diese Heirat sei ihr Unglück. Schließlich bat sie ihn um einen Löffel Arznei, damit sie gesund werde, und um ein bißchen mehr Liebe.
Zweites Kapitel
Einmal nachts gegen elf Uhr wurde das Ehepaar durch das Getrappel eines Pferdes geweckt, das gerade vor der Haustüre zum Stehen kam. Anastasia, das Dienstmädchen, klappte ihr Bodenfenster auf und verhandelte eine Weile mit einem Manne, der unten auf der Straße stand. Er wolle den Arzt holen. Er habe einen Brief an ihn.
Anastasia stieg frierend die Treppen hinunter und schob die Riegel auf, einen und dann den andern. Der Bote ließ sein Pferd stehen, folgte dem Mädchen und betrat ohne weiteres das Schlafgemach. Er entnahm seinem wollnen Käppi, an dem eine graue Troddel hing, einen Brief, der in einen Lappen eingewickelt war, und überreicht ihn dem Arzt mit höflicher Gebärde. Der richtete sich im Bett auf, um den Brief zu lesen. Anastasia stand dicht daneben und hielt den Leuchter. Die Frau Doktor kehrte sich verschämt der Wand zu und zeigte den Rücken.
In dem Briefe, den ein niedliches blaues Siegel verschloß, wurde Herr Bovary dringend gebeten, unverzüglich nach dem Pachtgut Les Bertaur zu kommen, ein gebrochenes Bein zu behandeln. Nun braucht man von Tostes über Longueville und Sankt Victor bis Bertaur zu Fuß sechs gute Stunden. Die Nacht war stockfinster. Frau Bovary sprach die Befürchtung aus, es könne ihrem Manne etwas zustoßen. Infolgedessen ward beschlossen, daß der Stallknecht vorausreiten, Karl aber erst drei Stunden später, nach Mondaufgang, folgen solle. Man würde ihm einen Jungen entgegenschicken, der ihm den Weg zum Gute zeige und ihm den Hof aufschlösse.
Früh gegen vier Uhr machte sich Karl, fest in feinen Mantel gehüllt, auf den Weg nach Bertaur. Noch ganz verschlafen überließ er sich dem Zotteltrab seines Gaules. Wenn dieser von selber vor irgendeinem im Wege liegenden Hindernis zum Halten parierte, wurde der Reiter jedesmal wach, erinnerte sich des gebrochnen Beines und begann in seinem Gedächtnisse alles auszukramen, was er von Knochenbrüchen wußte.
Der Regen hörte auf. Es dämmerte. Auf den laublosen Ästen der Apfelbäume hockten regungslose Vögel, das Gefieder ob des kühlen Morgenwindes gesträubt. So weit das Auge sah, dehnte sich flaches Land. Auf dieser endlosen grauen Fläche hoben sich hie und da in großen Zwischenräumen tiefviolette Flecken ab, die am Horizonte mit des Himmels trüben Farben zusammenflossen; das waren Baumgruppen um Güter und Meiereien herum. Von Zeit zu Zeit riß Karl seine Augen auf, bis ihn die Müdigkeit von neuem überwältigte und der Schlaf von selber wiederkam. Er geriet in einen traumartigen Zustand, in dem sich frische Empfindungen mit alten Erinnerungen paarten, so daß er ein Doppelleben führte. Er war noch Student und gleichzeitig schon Arzt und Ehemann. Im nämlichen Moment glaubte er in seinem Ehebette zu liegen und wie einst durch den Operationssaal zu schreiten. Der Geruch von heißen Umschlägen mischte sich in seiner Phantasie mit dem frischen Dufte des Morgentaus. Dazu hörte er, wie die Messingringe an den Stangen der Bettvorhänge klirrten und wie seine Frau im Schlafe atmete…
Als er durch das Dorf Vassonville ritt, bemerkte er einen Jungen, der am Rande des Straßengrabens im Grase saß.
»Sind Sie der Herr Doktor?«
Als Karl diese Frage bejahte, nahm der Kleine seine Holzpantoffeln in die Hände und begann vor dem Pferde herzurennen. Unterwegs hörte Bovary aus den Reden seines Führers heraus, daß Herr Rouault, der Patient, der ihn erwartete, einer der wohlhabendsten Landwirte sei. Er hatte sich am vergangenen Abend auf dem Heimwege von einem Nachbar, wo man das Dreikönigsfest gefeiert hatte, ein Bein gebrochen. Seine Frau war schon zwei Jahre tot. Er lebte ganz allein mit »dem gnädigen Fräulein«, das ihm den Haushalt führte.
Die Radfurchen wurden tiefer. Man näherte sich dem Gute. Plötzlich verschwand der Junge in der Lücke einer Gartenhecke, um hinter der Mauer eines Vorhofes wieder aufzutauchen, wo er ein großes Tor öffnete. Das Pferd trat in nasses rutschiges Gras, und Karl mußte sich ducken, um nicht vom Baumgezweig aus dem Sattel gerissen zu werden. Hofhunde fuhren aus ihren Hütten, schlugen an und rasselten an den Ketten. Als der Arzt in den eigentlichen Gutshof einritt, scheute der Gaul und machte einen großen Satz zur Seite.
Das Pachtgut Bertaur war ein ansehnliches Besitztum. Durch die offenstehenden Türen konnte man in die Ställe blicken, wo kräftige Ackergäule gemächlich aus blanken Raufen ihr Heu kauten. Längs der Wirtschaftsgebäude zog sich ein dampfender Misthaufen hin. Unter den Hühnern und Truthähnen machten sich fünf bis sechs Pfauen mausig, der Stolz der Güter jener Gegend. Der Schafstall war lang, die Scheune hoch und ihre Mauern spiegelglatt. Im Schuppen standen zwei große Leiterwagen und vier Pflüge, dazu die nötigen Pferdegeschirre, Kumte und Peitschen; auf den blauen Woilachs aus Schafwolle hatte sich feiner Staub gelagert, der von den Kornböden heruntersickerte. Der Hof, der nach dem Wohnhause zu etwas anstieg, war auf beiden Seiten mit einer Reihe Bäume bepflanzt. Vom Tümpel her erscholl das fröhliche Geschnatter der Gänse.
An der Schwelle des Hauses erschien ein junges Frauenzimmer in einem mit drei Volants besetzten blauen Merinokleide und begrüßte den Arzt. Er wurde nach der Küche geführt, wo ein tüchtiges Feuer brannte. Auf dem Herde kochte in kleinen Töpfen von verschiedener Form das Frühstück des Gesindes. Oben im Rauchfang hingen naßgewordene Kleidungsstücke zum Trocknen. Kohlenschaufel, Feuerzange und Blasebalg, alle miteinander von riesiger Größe, funkelten wie von blankem Stahl, während längs der Wände eine Unmenge Küchengerät hing, über dem die helle Herdflamme um die Wette mit den ersten Strahlen der durch die Fenster huschenden Morgensonne spielte und glitzerte.
Karl stieg in den ersten Stock hinauf, um den Kranken aufzusuchen. Er fand ihn in seinem Bett, schwitzend unter seinen Decken. Seine Nachtmütze hatte er in die Stube geschleudert. Es war ein stämmiger kleiner Mann, ein Fünfziger, mit weißem Haar, blauen Augen und kahler Stirn. Er trug Ohrringe. Neben ihm auf einem Stuhle stand eine große Karaffe voll Branntwein, aus der er sich von Zeit zu Zeit ein Gläschen einschenkte, um »Mumm in die Knochen zu kriegen«. Angesichts des Arztes legte sich seine Erregung. Statt zu fluchen und zu wettern – was er seit zwölf Stunden getan hatte – fing er nunmehr an zu ächzen und zu stöhnen.
Der Bruch war einfach, ohne jedwede Komplikation. Karl hätte sich einen leichteren Fall nicht zu wünschen gewagt. Alsbald erinnerte er sich der Allüren, die seine Lehrmeister an den Krankenlagern zur Schau gerragen harten, und spendete dem Patienten ein reichliches Maß der üblichen guten Worte, jenes Chirurgenbalsams, der an das Öl gemahnt, mit dem die Seziermesser eingefetter werden. Er ließ sich aus dem Holzschuppen ein paar Latten holen, um Holz zu Schienen zu bekommen. Von den gebrachten Stücken wählte er eins aus, schnitt die Schienen daraus zurecht und glättete sie mit einer Glasscherbe. Währenddem stellte die Magd Leinwandbinden her, und Fräulein Emma, die Tochter des Hauses, versuchte Polster anzufertigen. Als sie ihren Nähkasten nicht gleich fand, polterte der Vater los. Sie sagte kein Wort. Aber beim Nähen stach sie sich in den Finger, nahm ihn in den Mund und sog das Blut aus.
Karl war erstaunt, was für blendendweiße Nägel sie hatte. Sie waren mandelförmig geschnitten und sorglich gepflegt, und so schimmerten sie wie das feinste Elfenbein. Ihre Hände freilich waren nicht gerade schön, vielleicht nicht weiß genug und ein wenig zu mager in den Fingern; dabei waren sie allzu schlank, nicht besonders weich und in ihren Linien ungraziös. Was jedoch schön an ihr war, das waren ihre Augen. Sie waren braun, aber im Schatten der Wimpern sahen sie schwarz aus, und ihr offener Blick traf die Menschen mit der Kühnheit der Unschuld.
Als der Verband fertig war, lud Herr Rouault den Arzt feierlich »einen Bissen zu essen«, ehe er wieder aufbräche. Karl ward in das Esszimmer geführt, das zu ebener Erde lag. Auf einem kleinen Tische war für zwei Personen gedeckt; neben den Gedecken blinkten silberne Becher. Aus dem großen Eichenschranke, gegenüber dem Fenster, strömte Geruch von Iris und feuchtem Leinen. In einer Ecke standen aufrecht in Reih und Glied mehrere Säcke mit Getreide; sie hatten auf der Kornkammer nebenan keinen Platz gefunden, zu der drei Steinstufen hinaufführten. In der Mitte der Wand, deren grüner Anstrich sich stellenweise abblätterte, hing in einem vergoldeten Rahmen eine Bleistiftzeichnung: der Kopf einer Minerva. In schnörkeliger Schrift stand darunter geschrieben. »Meinem lieben Vater!«
Sie sprachen zuerst von dem Unfall, dann vom Wetter, vom starken Frost, von den Wölfen, die nachts die Umgegend unsicher machen. Fraulein Rouault schwärmte gar nicht besonders von dem Leben auf dem Lande, zumal jetzt nicht, wo die ganze Last der Gutswirtschaft fast allein auf ihr ruhe. Da es im Zimmer kalt war, fröstelte sie während der ganzen Mahlzeit. Beim Essen fielen ihre vollen Lippen etwas auf. Wenn das Gespräch stockte, pflegte sie mit den Oberzähnen auf die Unterlippe zu beißen.
Ihr Hals wuchs aus einem weißen Umlegekragen heraus. Ihr schwarzes, hinten zu einem reichen Knoten vereintes Haar war in der Mitte gescheitelt; beide Hälften lagen so glatt auf dem Kopfe, daß sie wie zwei Flügel aus je einem Stücke aussahen und kaum die Ohrläppchen blicken ließen. Über den Schläfen war das Haar gewellt, was der Landarzt noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Ihre Wangen waren rosig. Zwischen zwei Knöpfen ihrer Taille lugte – wie bei einem Herrn – ein Lorgnon aus Schildpatt hervor.
Nachdem sich Karl oben beim alten Rouault verabschiedet hatte, trat er nochmals in das Eßzimmer. Er fand Emma am Fenster stehend, die Stirn an die Scheiben gedrückt. Sie schaute in den Garten hinaus, wo der Wind die Bohnenstangen umgeworfen hatte. Sich umwendend, fragte sie:
»Suchen Sie etwas?«
»Meinen Reitstock, wenn Sie gestatten!«
Er fing an zu suchen, hinter den Türen und unter den Stühlen. Der Stock war auf den Fußboden gefallen, gerade zwischen die Säcke und die Wand. Emma entdeckte ihn. Als sie sich über die Säcke beugte, wollte Karl ihr galant zuvorkommen. Wie er seinen Arm in der nämlichen Absicht wie sie ausstreckte, berührte seine Brust den gebückten Rücken des jungen Mädchens. Sie fühlten es beide. Emma fuhr rasch in die Höhe. Ganz rot geworden, sah sie ihn über die Schulter weg an, indem sie ihm seinen Reitstock reichte.
Er hatte versprochen, in drei Tagen wieder nachzusehen; statt dessen war er bereits am nächsten Tag zur Stelle, und von da ab kam er regelmäßig zweimal in der Woche, ungerechnet die gelegentlichen Besuche, die er hin und wieder machte, wenn er »zufällig in der Gegend« war. Übrigens ging alles vorzüglich; die Heilung verlief regelrecht, und als man nach sechs und einer halben Woche Vater Rouault ohne Stock wieder in Haus und Hof herumstiefeln sah, hatte sich Bovary in der ganzen Gegend den Ruf einer Kapazität erworben. Der alte Herr meinte, besser hätten ihn die ersten Ärzte von Yvetot oder selbst von Rouen auch nicht kurieren können.
Karl dachte gar nicht daran, sich zu befragen, warum er so gern nach dem Rouaultschen Gute kam. Und wenn er auch darüber nachgesonnen hätte, so würde er den Beweggrund seines Eifers zweifellos in die Wichtigkeit des Falles oder vielleicht in das in Aussicht stehende hohe Honorar gelegt haben. Waren dies aber wirklich die Gründe, die ihm seine Besuche des Pachthofes zu köstlichen Abwechselungen in dem armseligen Einerlei seines tätigen Lebens machten? An solchen Tagen stand er zeitig auf, ritt im Galopp ab und ließ den Gaul die ganze Strecke lang kaum zu Atem kommen. Kurz vor seinem Ziele aber pflegte er abzusitzen und sich die Stiefel mit Gras zu reinigen; dann zog er sich die braunen Reithandschuhe an, und so ritt er kreuzvergnügt in den Gutshof ein. Es war ihm ein Wonnegefühl, mit der Schulter gegen den nachgebenden Flügel des Hoftores anzureiten, den Hahn auf der Mauer krähen zu hören und sich von der Dorfjugend umringt zu sehen. Er liebte die Scheune und die Ställe; er liebte den Papa Rouault, der ihm so treuherzig die Hand schüttelte und ihn seinen Lebensretter nannte; er liebte die niedlichen Holzpantoffeln des Gutsfräuleins, die auf den immer sauber gescheuerten Fliesen der Küche so allerliebst schlürften und klapperten. In diesen Schuhen sah Emma viel größer aus denn sonst. Wenn Karl wieder ging, gab sie ihm jedesmal das Geleit bis zur ersten Stufe der Freitreppe. War sein Pferd noch nicht vorgeführt, dann wartete sie mit. Sie hatten schon Abschied voneinander genommen, und so sprachen sie nicht mehr. Wenn es sehr windig war, kam ihr flaumiges Haar im Nacken in wehenden Wirrwarr, oder die Schürzenbänder begannen ihr um die Hüften zu flattern. Einmal war Tauwetter. An den Rinden der Bäume rann Wasser in den Hof hinab, und auf den Dächern der Gebäude schmolz aller Schnee. Emma war bereits auf der Schwelle, da ging sie wieder ins Haus, holte ihren Sonnenschirm und spannte ihn auf. Die Sonnenlichter stahlen sich durch die taubengraue Seide und tupften tanzende Reflexe auf die weiße Haut ihres Gesichts. Das gab ein so warmes und wohliges Gefühl, daß Emma lächelte. Einzelne Wassertropfen prallten auf das Schirmdach, laut vernehmbar, einer, wieder einer, noch einer …
Im Anfang hatte Frau Bovary häufig nach Herrn Rouault und seiner Krankheit gefragt, auch hatte sie nicht verfehlt, für ihn in ihrer doppelten Buchführung ein besondres Konto einzurichten. Als sie aber vernahm, daß er eine Tochter hatte, zog sie nähere Erkundigungen ein, und da erfuhr sie, daß Fräulein Rouault im Kloster, bei den Ursulinerinnen, erzogen worden war, sozusagen also »eine feine Erziehung genossen« hatte, daß sie infolgedessen Kenntnisse im Tanzen, in der Erdkunde, im Zeichnen, Sticken und Klavierspielen haben mußte. Das ging ihr über die Hutschnur, wie man zu sagen pflegt.
»Also darum!« sagte sie sich. »Darum also lacht ihm das ganze Gesicht, wenn er zu ihr hinreitet! Darum zieht er die neue Weste an, gleichgültig, ob sie ihm vom Regen verdorben wird! Oh dieses Weib, dieses Weib!«
Instinktiv haßte sie Emma. Zuerst tat sie sich eine Güte in allerhand Anspielungen. Karl verstand das nicht. Darauf versuchte sie es mit anzüglichen Bemerkungen, die er aus Angst vor einer häuslichen Szene über sich ergehen ließ. Schließlich aber ging sie im Sturm vor. Karl wußte nicht, was er sagen sollte. Weshalb renne er denn ewig nach Bertaur, wo doch der Alte längst geheilt sei, wenn die Rasselbande auch noch nicht berappt habe? Na freilich, weil es da ›eine Person‹ gäbe, die fein zu schwatzen verstünde, ein Weibsbild, das sticken könne und weiter nichts, ein Blaustrumpf! In die sei er verschossen! Ein Stadtdämchen, das sei ihm ein gefundenes Fressen.
»Blödsinn!« polterte sie weiter. »Die Tochter des alten Rouault, die und eine feine Dame! O jeh! Ihr Großvater hat noch die Schafe gehütet, und ein Vetter von ihr ist beinahe vor den Staatsanwalt gekommen, weil er bei einem Streite jemanden halbtot gedroschen hat! So was hat gar keinen Anlaß, sich was Besonders einzubilden und Sonntags aufgedonnert in die Kirche zu schwänzeln, in seidnen Kleidern wie eine Prinzessin. Und der Alte, der arme Schluder! Wenn im vergangenen Jahre die Rapsernte nicht so unverschämt gut ausgefallen wäre, hätte er seinen lumpigen Pacht nicht mal blechen können!«