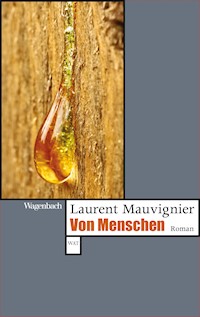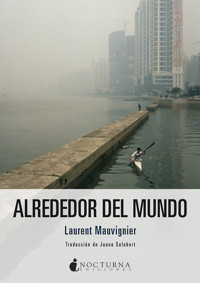Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem abgelegenen Weiler irgendwo in der französischen Provinz wohnen vier Menschen eng beieinander und erleben trotzdem ganz unterschiedliche Realitäten. Das eine Haus bewohnen Marion und Patrice gemeinsam mit ihrer Tochter Ida, im anderen wohnt Christine, die fast schon wie eine Verwandte zur Kleinfamilie gehört. Sie alle hüten ihr eigenes Geheimnis, zu Marions vierzigsten Geburtstag aber überwinden sie ihre Differenzen und kommen zum Feiern zusammen. Doch schnell wird die seltene Eintracht getrübt, als drei fremde Männer auf dem Hof auftauchen und die Bewohner gefangen nehmen. Was als geselliger Abend geplant war, entwickelt sich zu einer Nacht des Schreckens und eine Spirale der Gewalt setzt sich in Gang. Mit geschärften Sinnen nimmt jede der Geiseln die beängstigenden Geschehnisse auf ganz eigene Weise wahr und wird auf essenzielle Fragen zurückgeworfen: Kann man jemandem vertrauen, ohne seine Vergangenheit zu kennen? Was macht eine Familie wirklich aus und kann nur eine einzige Wahrheit das gesamte Leben verändern? Ein sprachmächtiger Roman, der die Vielschichtigkeit der Zeiten auffächert, aus denen das Leben der Protagonisten besteht, und sich in die biografischen Abgründe jedes Einzelnen stürzt, um mit scharfem Blick fürs Detail die Spannung beim Lesen auf die Spitze zu treiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laurent Mauvignier
Geschichten der Nacht
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
»Aber es gibt eben Geheimnissein Geheimnissen – immer.«
D. F. WallaceDer bleiche König*
1
Sie betrachtet ihn durchs Fenster, und was sie trotz der Sonne, die sie blendet und daran hindert, ihn so zu sehen, wie sie es gern täte, auf dem Parkplatz sieht, ihn, wie er an den alten Kangoo gelehnt dasteht, den er wohl oder übel bald einmal wird wechseln müssen – als könnte sie, indem sie ihn beobachtet, erraten, was er denkt, während er vielleicht einfach nur darauf wartet, dass sie aus dieser Gendarmerie herauskommt, zu der er sie wie oft schon gefahren hat, zwei oder drei Mal in den letzten vierzehn Tagen, sie weiß es nicht mehr –, was sie also über das Gebüsch hinweg auf dem Parkplatz sieht, der leicht abschüssig wirkt von ihrem etwas erhöhten Standpunkt neben den Stühlen des Wartezimmers aus, zwischen einer mickrigen Pflanze und einer gelb gestrichenen Säule, auf der sie Zeugenaufrufe lesen könnte, wenn sie sich die Zeit nähme, sich dafür zu interessieren, ist eine kompakte, aber große, stämmige Gestalt, etwas verzerrt durch den Umstand, dass sie von oben darauf schaut, sie leicht überragt, etwas gedrungener, als sie es tatsächlich ist, die Gestalt des Mannes, von dem sie sich jetzt sagt, dass sie ihn wahrscheinlich schon zu lange ansieht, als wäre er noch ein Kind – nicht ihr Kind, sie hat keine und hat sich nie welche gewünscht, sondern eines von denen, um die man sich gelegentlich kümmert, ein Patenkind oder ein Neffe, und an denen man sich ganz egoistisch erfreuen kann, deren Kindheit man genießen darf, ohne sich mit den ganzen Scherereien herumschlagen zu müssen, die dazugehören, die ihre Erziehung mit sich bringt wie lauter unvermeidliche Kollateralschäden.
Der Mann auf dem Parkplatz hat die Arme verschränkt – robuste Arme, kräftige Schultern, breiter Hals, vorstehender Bauch und ein Wust von sehr steifem, braunem Haar, der ihn immer unfrisiert oder verwahrlost wirken lässt. Er hat sich den Bart wachsen lassen, keinen besonders dichten Bart, nein, aber er steht ihm überhaupt nicht, denkt sie, er betont seine bärbeißige Seite noch, diesen Eindruck, den er unweigerlich auf jeden macht, der ihn nicht kennt, und verleiht ihm auch etwas Bäuerliches – sie wäre unfähig zu sagen, was etwas Bäuerliches bedeutet –, das Inbild eines Mannes, der seinen Hof nicht verlassen will, der sich buchstäblich darin vergräbt, verdrießlich wie ein Exilant oder ein Heiliger oder letztlich wie sie selbst in ihrem Haus. Aber bei ihr ist es nicht schlimm, sie ist neunundsechzig und ihr Leben läuft allmählich auf sein Ende zu, während seines, da er erst siebenundvierzig ist, noch einen langen Weg vor sich hat. Sie weiß auch, dass er hinter dem bärbeißigen Gesicht, das er zur Schau trägt, tatsächlich sanft und aufmerksam ist, geduldig – manchmal wahrscheinlich zu sehr –, er ist ihr und auch den anderen Nachbarn gegenüber immer hilfsbereit, er geht allen bei jeder Gelegenheit zur Hand, ja, ohne lange nachzudenken, jedem, der ihn darum bittet, auch wenn sie es ist, der er gerne die meisten Gefälligkeiten erweist, wie heute, indem er sie mit dem Auto zur Gendarmerie gefahren hat und nun auf sie wartet, um sie in den Weiler zurückzubringen, damit sie die etwa sieben Kilometer hin und ebenso viele zurück nicht mit dem Fahrrad fahren muss.
Bergogne, ja.
Schon als er klein war, sagte sie Bergogne. Das hatte sich ganz einfach, fast natürlicherweise ergeben: Eines Tages hatte sie ihn bei seinem Nachnamen gerufen, um ihn zu necken; das hatte der Junge lustig gefunden und sie selbst auch, denn er ahmte oft seinen Vater nach, mit diesem ernsten, gewichtigen Ausdruck, den Kinder manchmal annehmen, wenn sie einen verantwortungsvollen Erwachsenen spielen. Er war geschmeichelt gewesen, er hatte die Spur von Ironie und Härte nicht wirklich bemerkt, die sie in ihre Stimme legte, wenn sie seinen Vater bei seinem Nachnamen rief, denn oft tat sie das nicht, um ihm ein Kompliment zu machen, sondern um ihm eine scharfe Bemerkung an den Kopf zu werfen oder ihn zu behandeln wie ein Schulkind, das von einer Lehrerin gemaßregelt wird, indem sie es so schroff wie möglich beim Namen ruft. Bergogne Vater und sie stritten sich gern, aus Gewohnheit, wie man es unter Freunden oder guten Kameraden tut, aber das alles zählt jetzt sowieso nicht mehr – dreißig? vierzig Jahre vielleicht, die sich im Nebel der vergangenen Zeit aufgelöst haben –, das alles hat im Übrigen nie wirklich gezählt, denn sie haben sich immer nah genug gestanden, um einander die Meinung zu sagen, fast wie das alte Ehepaar, das sie nie gebildet haben, das sie in gewisser Weise aber doch gewesen sind – eine platonische Liebe, die vielleicht keinen Raum gefunden hat, um ausgelebt zu werden, nicht einmal im Traum, weder für sie noch für ihn – trotz allem, was böse Zungen und Neider haben unterstellen mögen.
Nach dem Tod des Vaters war es dabei geblieben: Bergogne. Ihr Name, um sich an den Sohn zu wenden, an diesen Sohn und nicht an die beiden anderen. Seitdem rief sie ihn immer so, ohne jede Ironie, aus reiner Gewohnheit, mit einer gewissen Härte und einem unbewussten Anflug von Überlegenheit und Autorität in der Stimme, wenn sie ihn etwa bat, ihr zwei, drei Sachen aus dem Super U mitzubringen, wenn er in der Stadt vorbeikam, oder sie mitzunehmen, wenn er hinfuhr – eine Stadt nannten sie das, dieses Kaff mit dreitausend Einwohnern –, aber für ihn schwang darin auch diese Süße der Kindheit mit,
Bergogne, nimmst du mich mit,
als habe sie ihm mein Kleiner, mein Kätzchen, mein Junge, mein Schatz ins Ohr geflüstert, in einer verborgenen Falte seines rauen Namens oder ihrer Stimme, in der Art, wie sie ihn aussprach. Früher kam sie in den Ferien in ein sehr schickes altes Haus am Fluss, und alle betrachteten sie als eine feine Dame, irgendwie aristokratisch und vor allem irgendwie verrückt – eine exaltierte, durchgeknallte Pariser Künstlerin –, und fragten sich, was sie hier in La Bassée wohl für eine Erholung suchte, denn sie tauchte immer öfter auf, blieb jedes Mal länger, bis sie eines Tages ganz herzog, diesmal ohne Mann im Gepäck – wo sie ihren Bankerehemann gelassen hatte, würde man nicht erfahren –, und sich mit einem Teil seines Geldes, das war sicher, hier einrichtete, auch wenn niemand wusste, warum sie beschlossen hatte, sich in einem solchen Kaff zu begraben, wo sie sich doch an der Sonne, am Meer, in freundlicheren, angenehmeren, weniger gewöhnlichen Gefilden hätte niederlassen können, nein, das würde niemand erfahren, das würde man sich lange fragen, denn auch wenn sie ihre Gegend lieben, sind die Leute doch nicht so blöd, dass sie nicht sehen, wie banal und gewöhnlich sie ist, wenn sie so ist wie hier, flach und regnerisch, mit null Touristen, die mit der Ödnis ihrer durchnässten Wege, Straßen, Gemäuer vorliebnehmen wollten – warum sonst hätten sie alle eines Tages davon geträumt, von hier abzuhauen?
Sie hatte gesagt, sie wolle hier und nirgendwo sonst leben, alt werden und sterben – sollten die anderen die Sonne und die Toskana, das Mittelmeer und Miami behalten, vielen Dank. Sie war so verrückt, sich lieber in La Bassée niederzulassen, und sie hatte nicht einmal eines der drei schönen Häuser der Innenstadt kaufen oder auch nur besichtigen wollen, auch wenn diese wie gar nicht so schlecht imitierte Schlösschen im feudalen Stil aussahen, mit Türmchen, sichtbaren Balken, Fachwerk, Taubenhaus und Nebengebäuden. Nein, sie hatte es vorgezogen, am Ende der Welt zu leben, und sie sagte immer wieder, für sie gebe es nichts Besseres als dieses Ende der Welt, stellen Sie sich das mal vor, das Ende der Welt, mitten in der Pampa, ein Ort, von dem niemand je redet und wo es nichts zu sehen oder zu tun gibt, den sie jedoch liebte, sagte sie, so sehr, dass sie ihr früheres Leben schließlich ganz aufgegeben hatte, das Pariser Leben und die Kunstgalerien und die ganze Hektik, die Hysterie, das Geld und die Feste, die sich die Leute ausmalten, um sich hier wirklich an die Arbeit zu machen, erzählte sie, und sich an einem Ort, an dem man sie in Ruhe lassen würde, wirklich ihrer Kunst zu widmen. Sie war Malerin, und dass der alte Bergogne Vater, der ihr Eier und Milch verkaufte, der Schweine schlachtete und sie in seinem Hof bis auf den letzten Tropfen ausbluten ließ, der sein Leben in Gummistiefeln voller Mist und Tierblut zubrachte, mit Erde im Sommer und in den elf übrigen Monaten des Jahres mit Matsch verdreckt, dass er also, dem der Weiler gehörte, ihr Freund geworden war, das hatte für Überraschung gesorgt, und so seltsam es all denen auch erscheinen mochte, die darin eine Bettgeschichte sehen wollten, um die Beziehung überhaupt denkbar und nachvollziehbar zu machen, nein, es war nie dazu gekommen, weder er noch sie hatten je die geringste Anziehung füreinander gezeigt, nicht die geringste amouröse oder erotische Zweideutigkeit, bis er ihr eines Tages eines der Häuser des Weilers verkaufte und sie zu seiner Nachbarin machte, was den Gerüchten und Mutmaßungen neue Nahrung lieferte.
Dabei hatte er ihr das Haus neben seinem eigenem weder aus Freundschaft noch aus dem Wunsch heraus verkauft, sie tagtäglich an seiner Seite zu haben; nachdem er sich jahrelang geweigert und das Offenkundige stur geleugnet hatte, hatte er sich nur schließlich damit abgefunden, die beiden Häuser zu verkaufen, aus denen seine letzten Mieter ausgezogen waren, um sich in den Schlund der Massenarbeitslosigkeit und der Sozialbauten in den Vororten einer mittelgroßen Stadt zu werfen, was ihn mit dem Augenscheinlichen zurückgelassen hatte, mit der Vorstellung oder vielmehr der Feststellung, die ihm den Magen und das Hirn umdrehte, dass die jungen Leute alle wegzogen, dass sie einer nach dem anderen die Weiler, die Höfe, die Häuser und die landwirtschaftlichen Betriebe verließen und die Gegend tatsächlich ausblutete, was, soweit er sehen konnte, allen egal war; so war es, niemand würde bleiben, La Bassée war sowieso nicht zu retten, das stimmte, aber zwischen nicht retten können und sich nicht darum scheren gab es einen kleinen Unterschied, den niemand zu sehen schien, weil niemand ihn sehen wollte. Bergogne Vater hatte sich damit abfinden müssen, dass auch seine Söhne nicht bleiben würden, dass sie in keinem der Häuser des Weilers mit ihm leben würden, um den Hof weiterzuführen, wie er es gern gehabt hätte oder bis zuletzt glauben wollte, so wie er es vor ihnen getan hatte und wie sein Vater vor ihm selbst.
Seine Frau war schon lange tot und hatte ihn mit drei Jungen zurückgelassen; Bergogne Vater hatte gehofft, zu dritt würden seine Söhne stärker sein und könnten den Hof vergrößern und florieren lassen, aber er hatte begreifen müssen, dass nur Patrice bleiben würde, denn die beiden Jüngeren hatten sich schnell dafür entschieden, wie einer der beiden gesagt hatte, ihn in seinem Mist zurückzulassen. Sie waren beide abgehauen, sobald sie alt genug gewesen waren, und daran war leider nichts Erstaunliches, denn ganz La Bassée war seit Langem dazu verurteilt zu verkümmern, zu zerfallen, eine Welt – die seine –, die keine andere Bestimmung hatte, als zu schwinden, sich zu vermindern, sich aufzulösen, bis sie schließlich ganz aus der Landschaft gelöscht wäre, und das können sie Verödung nennen, wenn sie wollen, murrte er, als wäre es eine natürliche Entwicklung, die man weder bremsen noch eindämmen könnte, aber die Wahrheit ist, dass sie einfach wollen, dass wir sang- und klanglos krepieren, Geifer vor dem Mund, aber Finger an der Hosennaht, brave kleine Soldaten bis zum bitteren Ende; La Bassée wird verschwinden, so ist das, und es wird nicht das einzige Kaff sein, von dem nur ein Name übrig bleiben wird – ein Gespenst auf einer IGN-Karte –, nur dass La Bassée auch noch einen derart gewöhnlichen Namen hat, dass es vier oder fünf Orte gibt, die den gleichen haben, dieses La Bassée hier ist nicht das im Norden, zwischen Arras, Béthune und Lille, das eine echte Stadt ist und kein Dorf wie dieses hier, wie auch immer, das alles wird vom modernen Leben geschluckt, gefressen, verdaut und ausgeschissen werden, und vielleicht ist das sogar besser so. Der Vater Bergogne schäumte vor Wut, alles würde verschwinden, nicht nur die Höfe und damit sämtliche Weiler, sondern auch die Neubausiedlungen aus den Sechzigerjahren, die aus dem Boden geschossen waren, um zu vertrocknen und zu verwelken, noch bevor sie erblühen konnten, mit der Metallverarbeitungsfabrik, die nach jahrelangem Siechtum schließlich ihre Tore geschlossen hatte wie alles andere, genauso wie die Sozialwohnungsbauten, die wie Pickel auf einer ungesunden Haut aus der Erde gesprossen waren, als Geisterschiffe geendet hatten, als man gerade dachte, dass La Bassée sich vergrößern würde mit seinen nagelneuen Fabriken, deren Namen klangen wie die eines Terminators und die es der Konkurrenz zeigen würden, Fabriken, von denen man noch nicht wusste, dass sie mit Asbest verseucht waren und diesen elenden Tod in sich trugen, der am Ende alle, denen sie ein schönes Leben versprochen hatten, umbringen würde.
So waren die beiden Brüder von Patrice den Ratschlägen gefolgt, die ihre Mutter ihnen mitgegeben hatte, bevor sie starb, sie waren geschlossen abgehauen, der eine in die Nähe von Besançon, um Schuhe zu verkaufen, der andere, wahrscheinlich der Schlaueste, aber auch der Aufgeblasenste von den Dreien, um auf der Bank zu arbeiten, wie er es mit der nötigen Herablassung sagte, um den anderen zu spüren zu geben, dass er nicht vorhatte, sein Leben lang wie ein Hinterwäldler zu leben, während er in irgendeinem Crédit Agricole am Schalter oder in der Buchhaltung saß – wenn es nur weit genug weg war, hatte er wohl das Gefühl, sein Schicksal zu erfüllen –, wobei er wahrscheinlich nicht in einer Stadt lebte und arbeitete, sondern irgendwo im endlosen Saum der Vororte. Die drei Brüder verstanden sich nicht und hatten sich beim Tod von Bergogne Vater vollends zerstritten, als kämen sie endlich zum hasserfüllten Ende all dessen, was sie seit ihrer Kindheit geteilt hatten: erst die Spiele, dann die Langeweile und die Gleichgültigkeit, dann die Gereiztheit und schließlich der Drang, jeder für sich auf eigenen Beinen zu stehen, möglichst weit von den anderen entfernt. Aber er, ob man ihn Pat oder Bergogne Sohn nennt, ob man ihn bei seinem Vornamen Patrice ruft oder einfach nur bei seinem Nachnamen, Bergogne, hatte mit seiner gewohnten Ruhe und Langsamkeit, mit seiner gemächlichen, schroffen, nüchternen Entschlossenheit gesagt, er wolle nicht verkaufen, er würde den Betrieb behalten und koste es, was es wolle, bis zum Ende da bleiben, im geografischen Zentrum ihrer Geschichte, wodurch er ihre Missbilligung, ihren Ärger, ihren Zorn erregte, aber auch ihr Unverständnis – na gut, dann sieh zu, wie du uns auszahlst, hatten sie gefordert. Was er dann auch getan hatte, indem er sich verschuldete bis ans Ende aller Zeiten und wahrscheinlich weit über jedes vernünftige Maß hinaus – aber er hatte es durchgezogen, der Hof war im Besitz eines Bergogne geblieben, wie sein Vater es gewollt hatte.
Von dem Weiler gehört den Bergognes also noch das Haus, in dem sie wohnen, ein paar Felder, das Dutzend Kühe, die Milch, die Patrice zu Butter und Käse verarbeitet – zu wenig zum Leben, aber genug, um nicht zu sterben.
Und sie hat damals das Haus direkt daneben gekauft und lebt seit fünfundzwanzig Jahren darin. Patrice kennt sie seit mindestens vierzig Jahren, sie ist ein Gesicht aus seiner Kindheit, und wahrscheinlich ist das der Grund, warum er jeden Tag bei ihr vorbeischaut, warum er so an ihr hängt, nicht wie an einer Mutter, die seine eigene, zu früh an Krebs gestorbene, ersetzt hätte, sondern einfach nur, weil sie da ist und zu seinem Leben gehört, seine ganze Jugend und sein Erwachsenenleben lang, und mit den Jahren nicht nur zu einer Vertrauten oder zu einer bloßen beruhigenden Gegenwart geworden ist, auf die er sich stützen könnte, sondern sozusagen zu seiner besten Freundin, denn ohne dass er sie um irgendetwas bitten müsste, einfach wenn er bei ihr vorbeischaut, egal zu welcher Tageszeit, wenn er den Kaffee annimmt und den Schnaps, den sie ihm in ein fingerhutgroßes Glas oder direkt in die Kaffeetasse einschenkt, weiß er, dass er ihr vertrauen kann und dass sie nicht über ihn urteilt, dass sie immer für ihn da sein wird.
An all das denkt sie – oder vielmehr geht es ihr durch den Sinn, Bergognes Geschichte, während sie ihn betrachtet und die Pfützen auf dem vom morgendlichen Regen noch nassen Parkplatz beobachtet, trotz des grellen Lichts auf dem löchrigen, ramponierten Asphalt, das in den Augen brennt, und in den Pfützen die sich spiegelnden weißen und grau-blauen Wolken, das Funkeln der Sonne auf dem weißen Lack des Kangoos, ein blendendes Weiß, wenn die Sonne durch die stahlgrauen Wolken sticht; Bergogne geht ein paar Schritte, während er da auf sie wartet, und sie betrachtet ihn weiter und macht sich ein bisschen Vorwürfe, weil sie ihn seine Zeit verlieren lässt, er hat anderes zu tun, als auf sie zu warten, das weiß sie, sie ärgert sich über all die verlorene Zeit wegen ein paar Deppen, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen oder wie sie das der anderen vermiesen können. Aber sie kann nicht so tun, als wäre nichts passiert, diesmal ist es ein bisschen anders und sie möchte nicht, dass es schlimmer wird, und außerdem ist er es, der ihr angeboten hat, sie herzufahren – sie weiß nicht, warum er von klein auf oft die Initiative ergreift und Wünschen zuvorkommt, die sie noch gar keine Zeit hatte auszusprechen. Er war ihr gegenüber schon immer so, nicht weil er nicht gewagt hätte, sie zu enttäuschen, oder weil er eingeschüchtert gewesen wäre von ihr, die immer etwas ganz anderes ausgestrahlt hatte als alles, was er kannte, vielleicht auch etwas Beunruhigendes, etwas Wildes, denn mit ihren langen, seit jeher orangerot gefärbten Haaren, mit ihrem Make-up und ihren manchmal zu bunten Kleidern, ihrer dicken, mit einer Reihe Brillanten besetzten Kunststoffbrille hätte sie in dieser Gegend, wo es für niemanden in Frage kam, allzu sehr aufzufallen, ein empfindsames Kind durchaus erschrecken können. Doch auch wenn sie immer exzentrisch gewesen war, hatte ihn das nie verängstigt oder beunruhigt, ganz im Gegenteil, und er hatte ihr sofort einen Respekt, eine Liebe entgegengebracht, die sie rückhaltlos erwiderte; und wie sie ihn da sieht, trotz des Gegenlichts, das ihm nicht gerade schmeichelt – er hat stark zugenommen, seit er verheiratet ist –, verspürt sie plötzlich Zärtlichkeit für ihn und für seine Geduld; sie hofft nur, dass sie nicht stundenlang wird warten müssen oder vielmehr, dass sie ihn nicht stundenlang wird warten lassen.
Aber nein, nein, sie weiß, dass es nicht lang dauern wird. Man hat ihr am Telefon versprochen, es würde schnell gehen. Und da ist es auch schon so weit, sie hört Schritte, eine Bewegung hinter sich, eine Tür, die sich quietschend öffnet, das Tippen von Fingern auf einer Tastatur, ein Telefonklingeln, auf einmal verstärkt sich der Ton der Gendarmerie in ihr, für sie, als würde sie ihn schließlich wahrnehmen, da sein, als würde sie, indem sie das Knirschen eines Bürostuhls auf dem Fliesenboden hört im Vorraum der Gendarmerie ankommen und könnte endlich die etwas wärmere Luft des Heizkörpers neben der Grünpflanze spüren, den Staub darin riechen, und plötzlich die Stimme des Gendarmen, der sie ruft.
Sie dreht sich um und es ist wieder der ergrauende Lulatsch, der da vor ihr steht, der gleiche wie beim letzten Mal, der ihr seinen Namen und Dienstgrad genannt hatte, die sie jedoch vergaß, sobald sie aus der Gendarmerie draußen war, noch bevor sie wieder in Bergognes Auto saß.
Jetzt versucht sie sich wenigstens an den Namen zu erinnern, wenn schon nicht an den Dienstgrad, es war ein Name, der polnisch oder russisch klang, etwas wie Jukievik oder Julievitch, aber es will ihr nicht gleich wieder einfallen, egal, sie ist schon in sein Büro getreten und der Gendarm bittet sie, Platz zu nehmen.
Er hat den Arm ausgestreckt, die weit offene Hand zeigt ihr den nicht mehr ganz neuen schwarzen Kunstledersessel – sie bemerkt die Risse, es sieht aus wie sehr dünne Hautfetzen oder vielmehr wie Zeitungspapierasche, die über einem Kaminfeuer auffliegt –, die Hand des Gendarmen, kräftig und lang, dunkle und weiße Haare darauf, silberner Ehering, und während sie sich hinsetzt, noch bevor sie ihren Rücken gegen die Lehne stützen und den Hintern auf der Sitzfläche zurückschieben kann, während sie sich gerade erst auf die Stuhlkante gesetzt, ihre Handtasche auf den Schoß gestellt und angefangen hat, sie zu öffnen – ihre Finger suchen nach dem Reißverschluss –, hat der Gendarm Zeit, um seinen Schreibtisch herumzugehen und sich mit einer raschen, entschiedenen Bewegung zu setzen, seinen Hintern ganz nach hinten zu schieben und mechanisch, ohne es auch nur zu merken, denn er macht diese Bewegung jeden Tag Dutzende Male, seinen Stuhl mit einem knappen Fersenstoß an den Schreibtisch heranzurücken, indem er beide Arme symmetrisch ausstreckt, den Schreibtisch an beiden Enden fasst und sich zu ihm heranzieht, hopp, fast nichts, er sieht sich nicht einmal dabei, was er hingegen sieht, ist diese Frau mit den orangeroten Haaren, er hat Zeit, sich zu erinnern, dass er bei den letzten beiden Malen gedacht hat, dass sie früher schön gewesen sein muss, Zeit zu registrieren, wie ihm das erneut ins Auge springt, sie muss sehr schön gewesen sein, was bedeutet, dass sie es trotz ihres Alters noch ist, sie strahlt eine Kraft, eine Eleganz aus, die er schon bei den ersten beiden Malen, als sie gekommen ist, bemerkt hat, ja, so etwas sieht man selten, eine solche Energie, etwas so Waches und Intelligentes im Körper und im Blick. Jetzt betrachtet er ihre Hände, die aus der tiefroten, fast schwarzen Tasche, blutfarben, denkt er noch, einen Umschlag hervorgezogen haben, und da streckt sie schon den Arm über den Schreibtisch zu ihm hinüber und reicht ihm den Umschlag mit dem anonymen Brief, den sie gerade bekommen hat.
Anonyme Briefe, ja, darüber kann man ironisieren oder verständnisinnig tun und sich sagen, das sei wohl leider eine französische Spezialität, man denke nur an die ganzen Geschichten aus dem zweiten Weltkrieg, eine ländliche Tradition wie in manchen Gegenden Rillettes und Foie gras, eine abscheuliche, erbärmliche und zum Glück oft folgenlose Tradition, die man aber trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, erklärt der Gendarm, wie er es schon beim letzten Mal getan hat, fatalistisch und etwas matt oder niedergeschlagen, denn, so wiederholt er, hinter anonymen Briefen stecken fast immer verbitterte oder eifersüchtige Menschen, Neidhammel, die nichts anderes zu tun haben, als ihre Häme wiederzukäuen, und glauben, sie könnten sie loswerden, indem sie einen mehr oder weniger fiktiven Feind beschimpfen, ihn bedrohen und beleidigen, indem sie mittels eines Blatts Papier ihren wieder und wieder aufgekochten Hass über ihn ausschütten; dagegen kann man nichts machen, und als er den Brief liest, den sie ihm gegeben hat, oder ihn vielmehr überfliegt – er hat seine Lesebrille genommen und sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie sich auf die Nase zu setzen, sondern hält sie nur zehn Zentimeter vor sein Gesicht, während er mit der anderen Hand das Blatt hält, auch wenn der zweimal gefaltete Brief dazu neigt, zuzuklappen, als würde er seinen Inhalt nur widerwillig preisgeben, diese in einer ganz banalen 16-Punkt-Schrift, etwa Courier New fett, auf einem Computer geschriebenen Worte, das Ganze zentriert und auf gewöhnlichem weißem 80-Gramm-Papier ausgedruckt – blickt er kurz auf, atmet lang aus, zuckt leicht mit den Schultern und murmelt,
Das ist natürlich nicht sehr angenehm.
Und da hat er seine Brille schon wieder hingelegt und lässt den Brief mit einer knappen Bewegung, wie man es mit etwas Unbedeutendem tut, auf seinen Schreibtisch zurückfallen – er bleibt erst auf der Kante stehen, ehe er sich neigt und zur Seite fällt –, na gut, wir werden ihn untersuchen lassen, aber da bei den anderen nichts dabei herausgekommen ist, wüsste ich nicht, warum dieser hier uns mehr Aufschluss geben sollte. Die Leute sind durchgeknallt, aber wenn es um die Details geht, sind sie sehr geschickt, es wird sicher keine Fingerabdrücke oder sonst etwas Verwertbares geben.
Er lächelt, während er das sagt, und begleitet das Ende seines Satzes mit einer skeptischen oder fatalistischen, vielleicht auch bedauernden Miene, und fühlt sich dann gezwungen weiterzureden, weil die Frau wartet und sich auf ihrem Stuhl vorgebeugt hat, sie erwartet, dass er etwas sagt, also fährt er fort,
In der Regel reicht es ihnen, sich schriftlich abzureagieren, ihre ganze Energie geht dafür drauf, dass sie ihren Brief aufgeben, und dann belassen sie es dabei.
Außer dass der Brief nicht aufgegeben worden ist, sagt sie, man hat ihn mir unter der Tür durchgeschoben. Jemand ist dafür bis zu mir nach Hause gekommen.
Der Gendarm bleibt stumm, er ist gerade über seine Gewissheiten gestolpert oder über die Argumente, die er vorbringen wollte, damit die Frau die Sache weniger schlimm fand, denn tatsächlich begnügt man sich nicht damit, sie zu beschimpfen, sie als Irre zu bezeichnen, diesmal bedroht man sie. Sie hat bemerkt, wie der Gendarm verstummt ist, hat einen Zweifel über sein Gesicht ziehen sehen, Mundfalte, Augen, Augenbrauen, na gut, na gut, lenkt er ein, wie viele Häuser gibt es bei Ihnen?
Nur den Weiler.
Ja, und wie viele sind Sie in dem Weiler?
Drei Häuser. Bergogne mit seiner Frau und seiner Tochter. Das zweite Haus ist zu verkaufen, und ich.
Sie schweigt eine Weile, und bevor er antworten kann, denn sie weiß, dass er antworten muss, dass er ihr eine Antwort schuldig ist, dass er im Namen der Gendarmerie, des Staates oder von wem auch immer etwas Beruhigendes sagen muss, richtet er sich auf seinem Stuhl auf, dreht ihn vielleicht etwas, fasst sich in Sekundenschnelle, aber bevor er spricht, bevor er zu dem ansetzt, was er sagen möchte, ergreift sie schon wieder das Wort,
Aber ich kann mich sehr gut verteidigen, wissen Sie,
ruft sie beinahe und antwortet im Voraus auf das, was er ihr mit Sicherheit sagen wird, wenn sie nicht schnell genug den Mund aufmacht,
Ich habe meinen Hund, wissen Sie. Ich habe meinen Hund.
2
Dieses Blau, dieses Rot, dieses Orangegelb, die Fließspuren, die deckenden oder durchscheinenden grünen Flecken und die verworrenen, brodelnden Formen, diese Körper und Gesichter, die aus einem dunklen, tiefbraunen Grund auftauchen, aus einem gleichsam strahlenden lila Lichtkreis oder im Gegenteil aus einer gebürsteten, rauen, holprigen Finsternis, diese durch farbige Blitze dem Dunkel entrissenen Formen; Landschaften und Körper, Körper, die Landschaften sind, Landschaften, die nicht nur Landschaften sind, sondern organische, mineralische Lebewesen, die wuchern und den Raum ausfüllen, sich über die sehr großen Leinwände ausbreiten, die sie bemalt – meistens quadratische Formate von zwei Metern, manchmal weniger, oder rechteckige, dann aber im Hochformat, niemals quer. Als sie jung war, hat sie Kirkeby und Pincemin sehr bewundert, ihre erdverbundenen, farbenreichen Gemälde, aber das ist so lange her, dass ihr ist, als wäre sie diese junge Frau, an die sie sich erinnert, nie gewesen.
In La Bassée sagen die Namen der zeitgenössischen Maler niemandem etwas. Ja, die Malerei, die sie liebt oder geliebt hat, sagt hier niemandem etwas und sie kann mit niemandem darüber reden, aber umso besser, denn sie will nicht über das reden, was sie macht, sie redet nicht gern über Malerei oder Kunst, es ist immer sehr ermüdend und fruchtlos, über Kunst zu reden, immer die gleichen hohlen und austauschbaren Betrachtungen zu wiederholen, Dinge, die ein schlechter und ein guter Maler gleichermaßen sagen könnten, weil sie beide gleicherweise aufrichtig und intelligent sind, auch wenn nur einer von beiden Talent hat, eine Kraft, eine Form, einen Sinn für Material und Ideen, eine Vision, denn für sie sind Künstler dazu da, Visionen zu haben, weshalb sie einmal eine Kassandra-Serie gemacht hat, gemalt, als wäre sie die Zerbrechlichkeit und die Wahrheit, die sich in eine Welt verirrt hätte, in der Brutalität und Lüge die Regel sind, mit dem Gedanken, dass Künstler die Wahrheit sagen oder eben schweigen, und dass sie sie sagen, solange sie nicht wissen, dass sie sie sagen, während niemand ihnen glaubt und weil niemand ihnen glaubt. Nicht reden, sondern malen, keine kostbaren Kräfte damit vergeuden zu räsonieren, um die gleichen Banalitäten von sich zu geben wie die anderen, sondern malen, was Worte an Versprechen nicht halten können; eine Vision dessen haben, was noch nicht ist, beim Anblick des blühenden Apfelbaums den Apfel malen, den Vogel anstelle des Eis, sich der Zukunft zuwenden und diese um ihres Geheimnisses willen begrüßen, statt so zu tun, als wisse man vor den anderen und besser als die anderen Bescheid, bloß nicht, nicht so, wie sie es allzu lange getan hat, als sie jung war und über alles, was ihr am Herzen lag, philosophierte und palaverte, und alles, was sie tat, mit mehr Worten zukleisterte, als es braucht, um zehn Generationen Künstler zu ersticken – daher also nein, kein Wort mehr, genug, seit vierzig Jahren hobelt sie die Sprache ab, um ihre Wahrnehmung zu öffnen, um sich selbst ihrer Vision zu öffnen, um ihren Blick zu zwingen, tiefer zu dringen, so wie man versucht, in der Nacht zu sehen, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Sie hat das Glück, eine Kunst zu haben, die sprechen kann, ohne das Maul aufzureißen, das nutzt sie aus, sie hat den richtigen Ort dafür gefunden, als sie dieses Haus gekauft hat, das sich keineswegs dafür anbot, ein Malatelier zu beherbergen. Sie hätte ein geeigneteres Haus aussuchen können, aber dieses hier hatte ihr gefallen, Bergogne Vater als Nachbarn zu haben beruhigte sie, die Entfernung vom Dorf ebenso, und sie hatte genug Geld gehabt, um die Wand zwischen Wohn- und Esszimmer einreißen zu lassen und das Ganze in einen riesigen Raum zu verwandeln, die Wände glattspachteln und Leisten und Platten anbringen zu lassen, um die Fläche zu vergrößern, wo sie Leinwände aufstellen konnte, und den Raum optimal zu nutzen, sie ließ auch spezielle Lampen anbringen, ein ganzes System, um ein perfektes weißes, natürliches Licht zu erhalten, das weder aggressiv war noch die Farben verfälschte, um sich die böse Überraschung zu ersparen, ein Gelb zu entdecken, wo sie meinte, ein Weiß aufgetragen zu haben, sobald sie ein Bild aus ihrem Atelier herausholte. Es war ihr völlig egal, ihr Esszimmer und ihr Wohnzimmer zu demolieren, alles auseinanderzunehmen, was Bergogne Vater für die früheren Mieter aus dem Haus gemacht hatte; sie hatte für das Recht bezahlt, diese Räume zu zerstören, die dafür gedacht waren, Gäste zu empfangen, Essenseinladungen und Feste zu beherbergen oder ein Familienleben zu führen, um Beziehungen zu pflegen, alles, was sie nicht mehr hatte, was sie nicht mehr wollte oder nicht hatte haben wollen, ja genau dafür hatte sie in klingender Münze bezahlt: ein Haus zu haben, das ihr Atelier war, denn es ging ihr gerade darum, dass das Atelier im Haus war und nicht daneben.
So kann sie ihre Zeit im Atelier verbringen und durch einen Durchgang von der Größe eines Tischs in die Diele und die Küche hinübergehen; im oberen Stock hat sie ihr Schlafzimmer eingerichtet und eines der beiden Gästezimmer behalten, denn manchmal kommen noch alte Weggefährten aus ihrer Jugend vorbei, die sie nicht vergessen haben, die ihre Gemälde anschauen kommen, die sich nach ihr erkundigen oder ihr Neuigkeiten erzählen, die Bilder mitnehmen und sie für sie verkaufen, auch wenn sie nicht mehr viel verkauft – man sagt ihr, sie sei nicht kompromissbereit oder gefügig genug gegenüber dem Markt, sie sollte sich ein bisschen öfter auf den Kunstmessen zeigen, das heißt zumindest hin und wieder einmal, da sie es nie tue, da sie nicht einmal auf Anfragen von Galeristen antworte, denen ihre Arbeit doch gefallen habe, ebenso wenig wie auf Briefe von ihren früheren Käufern oder Mäzenen, es sei schade, dass sie sich keine Mühe gebe und allen den Rücken kehre, schade für sie und ihre Malerei, vor allem aber schade für ihr Publikum, sie sei es ihrem Publikum schuldig, denn sie habe eines gehabt, das sie durch ihre Nachlässigkeit schließlich verloren habe, wirklich ein Jammer – ja, wahrscheinlich, antwortet sie, wahrscheinlich, aber was soll’s, es geht ihr gut und sie denkt einfach nicht daran, sie ist gewiss etwas unbeugsam und nimmt sich ihre Malerei zu sehr zu Herzen, sicher. Tatsächlich ist es einfach so, dass sie beim Malen vergisst, dass sie die Rolle der Malerin spielen sollte, die ihre Arbeit sehr gut verkauft – was sie machen könnte, denn sie weiß, was sie tut, was sie malt, auch wenn sie sich mitreißen und überraschen lässt von den Bildern, die unter ihren Fingern entstehen, sie weiß auch, dass die Inspiration niemanden aus heiterem Himmel überfällt und dass man arbeiten, lesen, sehen, nachdenken, seine Arbeit reflektieren muss, und wenn die intellektuelle Arbeit vollzogen ist, muss man diese vergessen können, sie auslöschen, loslassen und in diese konzeptuelle, reflektierte Welt etwas einbrechen lassen, das aus der Tiefe kommt oder von der Seite und bewirkt, dass das Bild über das Programm hinausgeht, das man ihm zugedacht hat, bis das Gemälde plötzlich intelligenter, lebendiger, oft auch grausamer ist als der- oder diejenige, die es gemalt hat.
Sie weiß das, sie strebt nach dem Moment, in dem das Gemälde zurückschaut und sie sieht, diesen Moment, in dem die Begegnung stattfindet zwischen ihr und dem, was sie malt, zwischen dem, was sie malt, und ihr, und das ist natürlich etwas, worüber sie nicht redet. Es ist ihr lieber, dass Bergogne ihr jeden Tag, wenn er zum Mittagessen bei ihr auftaucht, berichtet, was er auf den Feldern macht, ihr von den Kälbern erzählt, von der laufenden Arbeit oder von seiner Frau Marion und von Ida – vor allem von Ida, mit der sie viel Zeit verbringt, denn sie kommt fast jeden Tag nach der Schule zu ihr, um eine Kleinigkeit zu essen und auf ihre Eltern zu warten, die oft spät heimkommen.
Heute wird Ida gegen siebzehn Uhr da sein; sie wird erzählen, was sie in der Schule gemacht hat, sie selbst wird ihr hingegen nicht sagen, dass ihr Vater sie an diesem Morgen zur Gendarmerie gefahren hat, genauso wie sie die Worte des Gendarmen Filipkowski für sich behalten wird – dieser Name, Filipkowski, ist ihr nicht etwa wieder eingefallen, sie hat ihn einfach von der Visitenkarte abgelesen, die er ihr am Ende ihrer Unterredung gereicht hat und auf die er unter seinen Namen mit Kugelschreiber seine Handynummer geschrieben hatte, wobei er zwei- oder dreimal sagte,
Beim kleinsten Problem rufen Sie mich an,
und nachdrücklich betonte, dass sie ihn anrufen müsse, sollte sie einen weiteren anonymen Brief bekommen, vor allem, wenn dieser unter der Tür durchgeschoben wurde, ja, so wie der braune Umschlag, den sie am Tag zuvor gefunden hatte, spätabends, und von dem sie Bergogne am Morgen nicht ängstlich, sondern gereizt berichtet hatte, mit einem Zorn, den sie immer weniger zügeln konnte,
Diese Idioten gehen mir langsam echt auf den Senkel.
Der Gendarm Filipkowski hatte klar und deutlich gesagt, dass es sich fraglos um Drohungen handelte, auch wenn sie unklar, plemplem und wenig glaubwürdig klangen, und diesmal war man einen Schritt weitergegangen, nicht nur durch die gebrauchten Worte, sondern auch weil man gekommen war, weil man gezeigt hatte, dass man sich bis zu ihr nach Hause vorwagte. Es war immerhin davon die Rede, rothaarige Hexen zu verbrennen und die Welt von Irren zu säubern, die besser zu Hause bleiben sollten – warf man ihr vor, Pariserin zu sein, nicht von hier zu stammen? Wo sie doch schon so lange hier lebte?
Sie vermutete eher, dass man ihr vorwarf, mit einem oder zwei verheirateten Männern geschlafen zu haben – war das herausgekommen, gesagt oder erahnt worden? Oder hatten die Männer es selbst gestanden? –, Männern, mit denen sie wohl ein paarmal im Bett gewesen war, ohne dass je davon die Rede gewesen wäre, sie zu Dauerliebhabern zu machen oder gar zu Ehemännern – vielen Dank, das hatte sie durch –, aber vielleicht wollte eine Frau sich rächen, oder ein Mann nahm es ihr übel, dass sie nicht seine »offizielle« Geliebte werden wollte? Der Gendarm hatte noch einmal versucht ihr zu entlocken, ob sie vielleicht eine Idee hätte, wer hinter diesen Briefen, diesen Drohungen stecken könnte, hinter den Beschimpfungen, die sich derart in ihren Gedanken festgesetzt hatten, dass sie sie manchmal am Einschlafen hinderten, aber sie hatte geantwortet, nein, sie wisse es nicht, und sie hatte den Blick weder senken noch abwenden müssen, um den Gendarmen anzulügen, sie hatte ihm dabei in die Augen sehen können – was meinen Sie denn? Eine alte Frau wie ich, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Feinde und kenne niemanden. Der Gendarm hatte ratlos gewirkt, er hatte eine skeptische kleine Pause gemacht, als habe er verstanden, dass sie nicht alles sagte und auch nicht die Absicht hatte, es zu tun, dass etwas in ihr sich sträubte, eine Liste von möglichen Schuldigen zu erstellen, zur Denunziantin zu werden, im Wissen, dass man sowieso niemandem etwas nachweisen könnte.
Das alles würde sie Ida natürlich nicht erzählen, wenn sie zu ihr hereinkäme. Ida würde ihren Schulranzen in der Diele abstellen, das heißt quasi in der Küche, und dann zur Spüle gehen, um sich die Hände zu waschen. Und sie würde so tun, als wäre nichts, genau wie sie es gegenüber Bergogne getan hatte, als sie aus der Gendarmerie herausgekommen war, sie würde dezent lächeln, mit leichter Stimme reden,
Alles in Ordnung, mein Schatz?
im gleichen Ton wie dem, in dem sie Bergogne zumindest zwei oder drei Details erzählt hatte, um ihm für die Zeit zu danken, die er wegen ihr verloren hatte. Sie war ihm eine Zusammenfassung dessen, was man ihr gesagt hatte, schuldig, na ja, nichts Besonderes, die Cops sind wie die Ärzte, die dir mit Grabesmiene schlimme Nachrichten verkünden, und wenn du hinterher darüber nachdenkst, was du gehört hast, kapierst du, dass sie auch nicht mehr wissen als du. Sie hatte erzählt, dass sie die Briefe untersuchen würden, um sich zu vergewissern, dass sie von der gleichen Person stammten, und dann halb gereizt, halb amüsiert hinzugefügt: Als hätte ich genug Feinde, dass es jedes Mal ein anderer Irrer sein könnte – ich bin mir sicher, dass es eher eine Irre ist, eine Frau, ganz sicher, letztes Mal auf dem Dorfball habe ich viel Zeit mit Dings verbracht, du weißt schon, wen ich meine, oder?
Bergogne hatte lediglich gelächelt; er hatte seine Vermutung, würde sie aber nicht fragen, ob er richtig lag. Während der Kangoo sich dem Weiler näherte, hatte sie weitergeredet, schließlich war eine Pause entstanden, und um das Thema zu wechseln – denn das alles ist die Zeit nicht wert, die man damit zubringt, davon zu erzählen, findest du nicht? –, hatte sie gesagt, Bergogne, mein Guter, dein Bart ist absolut lächerlich und steht dir überhaupt nicht. Du siehst damit zehn Jahre älter aus, willst du mir nicht den Gefallen tun, ihn abzurasieren? Und wenn du es nicht für mich tust, dann tu es wenigstens für deine Frau, ich erinnere dich daran, dass sie morgen Geburtstag hat, und wenn du ihr nur dieses eine Geschenk machen würdest, wäre sie dir schon dankbar bis in alle Ewigkeit.
Jetzt sitzt sie in ihrem Atelier und betrachtet inmitten des Durcheinanders all ihrer Gemälde – zwischen denen, die an den Wänden hängen, denen, die auf dem Boden stehen, die sich auf den Treppenstufen zu den Zimmern hinauf häufen, denen, die noch nicht aufgespannt sind und wie Spruchbänder eingerollt herumliegen – das Bild, das ihr gegenüber an die Wand getackert ist, an der sie gern arbeitet: Das Porträt der roten Frau.
Sie weiß, dass es fertig ist, es ist so weit – es fehlt nur noch ein bisschen Blau um die Augen. Sie zögert, noch weiter daran zu arbeiten, sagt sich, was sie auch tun mag, es wird nichts Wesentliches mehr an dem Gemälde ändern oder vertiefen, und weiterzumachen würde das Risiko bergen, es zu zerstören; die rote Frau ist nackt, ihr Körper vollständig rot – ein fast ins Orange gehendes Rot, aber die Schatten sind von einem sehr reinen, leuchtenden Zinnoberrot, Schatten, die ein farbiges Licht sind und nicht eine dunkle Farbnuance, was alles ändert, es hat sie die größte Mühe gekostet, diese Wirkung zu erzielen. Die rote Frau durchbohrt mit ihrem Starren jeden und jede, die den Blick auf sie richten; ihr Porträt ähnelt vielleicht dem des Mädchens, das am Anfang ihres Wunschs zu malen stand, denn als sie damit angefangen hat, vor sehr langer Zeit, wollte sie sich von einem Foto von David Seymour befreien, das sie lange verfolgt hatte, es war das Porträt einer kleinen Polin, die in einem Heim das Haus ihrer Kindheit auf eine Tafel zeichnet. Das Kind zeichnet mit Kreide einen Feuerkreis, die Zerstörung ergreift die gesamte Zeichnung; man sieht vor allem den Schrecken in den Augen des kleinen Mädchens in Schwarz – das fängt der Fotograf ein. Sie hatte dieses Bild gesehen, und die einzige Art, es zu vergessen oder zumindest damit leben zu können, hatte darin bestanden, es zu malen, und dieses Gemälde war das erste ihrer Bilder in Schwarz-Weiß gewesen, ein großes Gemälde, das kleine Mädchen verloren im strahlenden Weiß der Leinwand – ihr irrer, starrer Blick. Heute, über vierzig Jahre später, sagt sie sich, dass die rote Frau, die sie gerade fertiggestellt hat, fast den gleichen entgeisterten Ausdruck hat – sie trägt das Feuer eines zerstörten, vernichteten Hauses in sich, als würden die Bomben, die über der Stadt explodieren, ihr den Atem verschlagen. Daran denkt sie, während sie mitten in ihrem Atelier vor der roten Frau sitzt, und sie hört ihren Schäferhund nicht, der zwei Minuten zuvor noch neben ihr lag und schlief. Sie wartet darauf, dass etwas auf ihr Lauern antwortet, ein Lebenszeichen, denn das Leben muss von dem Gemälde kommen.
Jetzt steht ihr Hund auf, weil er gehört hat, dass jemand kommt, oder weil noch niemand angekommen ist, aber er weiß, dass es Zeit ist, zwischen sechzehn Uhr fünfundvierzig und sechzehn Uhr fünfundfünfzig, je nach Verkehrslage. Am Ende des steinigen Weges, der vom Weiler zur schlecht geteerten Straße geht, an der die Mülltonnen stehen und die zur Landstraße führt, über die man La Bassée erreicht, wird der Schulbus halten, die Tür wird aufgehen und Ida aussteigen lassen, mit zwei anderen Kindern aus den Nachbarweilern. Kaum wird sich die Tür mit ihrem hydraulischen Zischen wieder geschlossen haben, werden die drei Kinder sich trennen oder noch zwei, drei Minuten lang miteinander kichern, noch zwei, drei Worte wechseln, dann werden sie losgehen, eines nach Westen, eines nach Osten, das dritte nach Norden; Ida wird beim Gehen die Schulterriemen ihres Ranzens festhalten, ohne sich für die vor ihr liegende Straße zu interessieren – zu gut kennt sie den Moment, in dem die schlecht geteerte, müde, vom Wechsel von Sommer und Winter, von Kälte und Regen, Hitze und Traktorreifen gezeichnete Straße eine Linkskurve beschreibt und das dunkle Band in einen weißen Schotterweg übergeht, im Sommer blendend hell, aber meistens matschig und dann fast rötlich, oder vielmehr ockerfarben, gelb, wie jetzt gerade, vollgesogen mit dem Regen, der die ganze Nacht und noch heute Morgen gefallen ist, voll mit tiefen, breiten bräunlichen Pfützen, die sie umgehen muss und über die sie zum Spaß manchmal hinüberspringt, und am Ende des Weges der Weiler, die Dächer der drei Häuser, der Scheunen und des Stalls, ihr Zuhause, die Dächer stellenweise grün wegen des Moosbewuchses und der Pflanzen, die an den Wänden emporwuchern bis auf die Dächer hinauf; da ist der Weiler, wie eine geschlossene Faust inmitten der Maisfelder und der Weiden, auf denen die Kühe den ganzen Tag grasen; da sind auch die Bäume entlang des Flusses, der die Gegend in zwei Départements trennt; auf der anderen Seite eine Kirche aus weißem Tuffstein, und hier, auf unserer Seite, die Pappeln, wie eine Armee in Habachtstellung, in Reih und Glied, am Fluss entlang, den sie beschatten. Aber das alles ist weit weg, zu Fuß braucht es eine Weile, um dort hinzukommen, man muss dazu auch dieses kleine wilde Wäldchen durchqueren, das von den Feldern eingepfercht ist, Bäume, deren Blätter und Äste man rauschen hört, wenn der Wind aus der richtigen Richtung weht und auch den Gesang der Vögel herüberträgt, und wo die Füchse leben, die manchmal etwas zu nah herankommen – einmal wurde einer im Hof gesehen, sehr früh morgens, bevor sie in die Schule ging.
Aber an diesem Abend interessiert Ida sich nur für ihre Fußspitzen: wie sie die Sohle ihrer gelben Turnschuhe über die Steine abrollen lässt und diese mal umgeht, mal im Gegenteil weg kickt, weit vor sich schießt und davonrollen lässt. Ida weiß, während sie über die Pfützen steigt, über die größeren hinwegspringt und den Schulranzen auf ihrem Rücken hüpfen lässt, dass bei ihrer Ankunft, wenn sie durch das große Gittertor gehen wird, das sicher offen steht, ihr Vater links im Stall bei den Kühen sein wird oder in der Scheune oder im Hof, um an irgendetwas herumzubasteln, das sie nie recht versteht, immer in seinem petrolblauen Anzug; er wird sie nicht sehen und sie wird nicht versuchen, ihn zu stören. Nein, sie wird gleich nach rechts gehen, in das erste Haus mit der verglasten Tür, hinter der Radjah auf sie warten wird, weil der Schäferhund das jeden Tag tut.
Sie wird die Tür aufmachen und den Kopf des Hundes in beide Hände nehmen, ihm über die Ohren streichen, während er versuchen wird, sie abzuschlecken, die Schnauze zu ihr emporgereckt, vor Freude jaulend, und sie wird ihn streicheln und sagen,
Na, mein Hund, wie geht’s dir, mein Hund?,
und dann wird sie weitergehen, durch die Eingangstür direkt in die Küche, wo sie ihren Schulranzen fallen lassen wird, ohne darüber nachzudenken, immer am gleichen Platz, links neben der Tür. Sie wird zur Spüle gehen und sich die Hände waschen, sie abtrocknen, und durch die Küche hindurch sofort ins Atelier hinüber; sie wird keine Fragen stellen, auch wenn sie bei sich überlegen wird, welches Bild sie wohl heute erwartet, ob es immer noch diese scheußliche rote Frau ist, die aussieht, als würde sie die Leute anstieren und sie wer weiß womit bedrohen, mit ihren großen Brüsten und ihren obszön geöffneten Schenkeln, die schamlos ihr Geschlecht entblößen, die rote Frau stellt sich völlig ungerührt, ohne jede Provokation zur Schau, einfach so, mit diesem Körper, den Ida nicht mag, weil die Frau streng aussieht und sie vor allem herauszufordern scheint, als habe sie ihr etwas vorzuwerfen – warum malst du diese Frau? Sag? Ich mag die Tiere und die Landschaften gerne, die du machst, und auch die anderen Frauen, aber die da, die macht mir Angst – das könnte sie sagen, wenn sie sich trauen würde, aber sie wird sich nicht trauen und nichts sagen.
Sie werden in die Küche gehen, Tatie wird ihr etwas zu essen geben und im Stehen, an die Edelstahlspüle gelehnt, ihren Tee trinken und sich anhören, wie es in der Schule war. Danach werden sie zeichnen können: Ida hat versprochen, als Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter Zeichnungen zu machen, und Tatie hat versprochen, ihr zu helfen.
Ida hofft, dass ihre Zeichnungen Tatie gefallen werden, denn Taties Meinung ist für sie fast genauso wichtig wie die ihrer Mutter.
3
Wirst du Mama etwas schenken?,
fragt Ida, während ihre Zähne die Rosinen, die Mandeln, die Haferflocken kauen, denn wie jeden Tag isst sie gierig, was Tatie ihr hinstellt, obwohl sie, wie fast jeden Nachmittag, erst so tut, als würde sie das Müslischälchen wegschieben, und behauptet, sie habe keinen Hunger, nein, keinen großen Hunger, und dann braucht man sie nur ein bisschen zu drängen oder im Gegenteil so tun, als würde man sie überhaupt nicht drängen, und sagen, dann räume man das Müslischälchen eben wieder weg, damit sie es festhält und sagt, warte, ich nehme doch ein bisschen, um dann etwas darin zu picken, wie jedes Mal, bis sie schließlich alles verschlungen hat; aber heute ist ein besonderer Tag, sie hat zwar Hunger, aber keine Lust, ihre Zeit mit Essen zu verschwenden, nein, sie hat es sehr eilig, heute Nachmittag werden Tatie und sie Bilder malen für den Geburtstag ihrer Mutter, denn morgen – und das ist schon was, ja, es ist ein kleines Ereignis –, morgen wird Marion vierzig.
Ida hat noch nichts vorbereitet, sie schiebt den Moment, etwas Selbstgemachtes hervorzubringen, seit Wochen vor sich her, denn sie hat kein Geschenk gekauft, wie ihr Vater es ihr vorgeschlagen hatte, und zwar deshalb nicht, weil ihr keine überzeugende Idee gekommen ist, wodurch sie sich selbst dazu verurteilt hat, mit eigenen Händen etwas zu erschaffen. Vor zwei Tagen hat Tatie vorgeschlagen, Bilder zu zeichnen oder zu malen, und Ida hat darauf mit eher ergebener als begeisterter Stimme geantwortet, einverstanden, ja, warum nicht. Aber nachdem sie sich an die Idee gewöhnt hat, findet sie sie jetzt so aufregend, als wäre sie ihr selbst eingefallen. Tatie hat versprochen, dass sie ihr Gouache- oder Aquarellfarben geben würde, und Papier, wie sie es selbst manchmal verwendet, mit einem besonderen Korn, an dem die Farbe gut haftet, oder sogar einen Malkarton oder eine kleine Leinwand auf einem Keilrahmen – ein Quadrat oder ein Querformat. Aber Ida hat gut nachgedacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie sich nicht in der Lage fühlt, auf Leinwand zu malen, nein, sie will lieber Bilder anfertigen, wie sie sie macht, seit sie ganz klein ist, auf bescheidenen A4-Blättern wie denen, auf denen sie immer geschrieben, gezeichnet, ausgemalt hat, bis auf die paar Mal, als sie mit fünf oder sechs Jahren an langen Sitzungen teilgenommen hat, bei denen Tatie und sie eine mehrere Quadratmeter große Leinwand auf den Boden gelegt hatten, größer als ein Bettlaken, weiß, etwas klebrig – sie erinnert sich noch genau, wie es schlock machte, wenn sie ihre nackten Knie davon löste, und auch daran, wie viel sie gelacht und wie sie sich in den Acrylfarben gesuhlt haben, mit denen sie malten – mit vollen Händen, mit den Füßen und am Ende mit dem ganzen Körper, sie hatten sich darin gewälzt und das Gefühl gehabt, in einem sumpfigen, klebrigen Wasser zu schwimmen.
Jetzt möchte Ida lieber mit Gouache malen und Worte hinzufügen, die sie mit Filzstift schreiben wird, jeden Buchstaben in einer anderen Farbe. Sie ist ungeduldig anzufangen, deshalb isst sie schnell und beeilt sich, ihr Schälchen ins Spülbecken zu stellen und die Hände kurz unter fließendes Wasser zu halten – schnell und schlecht abgetrocknet mit dem zu feuchten Geschirrtuch, das am Unterschrank hängt, hopp, erledigt –, ob Tatie wohl auch ein Bild für ihre Mutter malen wird, das fragt sie sich, so wie sie sich manchmal fragt, ob es Tatie etwas ausmachen würde, wenn sie sie beim Vornamen nennen würde, wie ihre Eltern es tun, Christine, wobei sie sich sagt, dass Tatie wahrscheinlich nichts dagegen hätte, fast sicher.
Ida hat es nur einfach nie geschafft, in diesem Punkt etwas zu ändern oder es ihren Eltern nachzumachen, sie kann sich den Namen Christine in ihrem Mund nicht vorstellen, als würde er in ihrem Mund falsch klingen, als könnte er nicht ihre Tatie meinen, sondern zwangsläufig jemand anderen, denn dieser Vorname erscheint ihr zu weit von ihnen entfernt, von ihrer Beziehung zueinander, von dem, was sie einander in ihrer Vertrautheit erzählen. Sie hat den Eindruck, dass es Christine lieber ist, Tatie genannt zu werden – von ihr jedenfalls –, also ist alles in Ordnung, im Übrigen könnte Ida sie bei jedem beliebigen Namen nennen und es würde letztlich nichts ändern an diesem Rätsel, dass Tatie jedes Mal, wenn Ida anfängt, von ihrer Mutter zu reden, ausweicht oder manchmal sogar so tut, als habe sie sie nicht gehört. Ida traut sich nicht, sie zu fragen, ob es einen Grund gibt, warum sie es vermeidet, über Marion zu reden, ob sie sich das nur einbildet oder ob es irgendetwas gibt, das zwischen ihnen steht, ob Tatie das, was sie über Mama denkt, nicht sagen kann, um Ida nicht zu verletzen, als würde Tatie Ida für zu zartbesaitet halten, um ihr unangenehme, vielleicht grausame Wahrheiten oder Gedanken zuzumuten, beschämende oder unwürdige Gedanken, als wäre es möglich, dass Tatie schlechte Gedanken gegen irgendjemanden und insbesondere gegen einen ihrer Elternteile haben könnte, gegen jemanden, den sie liebt, ja als wäre es möglich – denkbar –, dass sie etwas Schlechtes über ihre Mutter denken könnte, denn Ida kann sich nicht vorstellen, was man ihrer Mutter Schlechtes nachsagen sollte.
Sie hat immer gespürt, dass sie einander belauern, dass sie verstummen, sich zusammennehmen, damit alles gut läuft, auch wenn man doch spürt, dass sie sich ein bisschen verstellen, aber Ida versteht nicht recht, was Tatie Christine Marion vorwerfen könnte, und auch wenn sie merkt, dass zwischen den beiden etwas nicht stimmt – aber was? –, kann es nichts Schlimmes sein, es ist zwar in diesem Frieden, den sie beide bewahren, etwas Künstliches zu spüren, vielleicht etwas Angestrengtes oder Gespieltes, eine Art Widerstreben oder Zurückhaltung, auch wenn Ida wirklich keine Ahnung hat, was Tatie so Spezielles über Mama denken sollte, dass sie es ihr nicht sagen könnte. Und doch ist es so, ja, Christine wird plötzlich schroffer, kühler, wenn sie über Marion redet. Fast scharf. Oder sie fängt an, Fragen zu stellen, sie tut wie jemand, der ein Problem zu lösen hat und laut nachdenkt, sie möchte wissen, was zu Hause geredet wird, ohne sich ganz zu trauen, danach zu fragen, sie möchte ihre Neugier befriedigen und sie gleichzeitig verbergen, nicht zeigen, dass sie sich für Dinge interessiert, die sie nichts angehen, die nicht ihre Angelegenheit sind, intime Dinge, die Papa und Mama einander sagen, oder die sie einander nicht sagen. Sie stellt manchmal komische Fragen und senkt dabei fast die Stimme, wie nebenbei, obenhin, aber da sie die Stimme senkt, wirkt es, als habe sie Angst, gehört zu werden – von wem? –, als würde sie nach seltsamen und vielleicht verbotenen Dingen fragen, die man eigentlich für sich behalten sollte.
Und jetzt, während sie auf dem Küchentisch Farben und Papier zurechtlegen, hakt Ida noch einmal nach, Tatie, wirst du Mama etwas schenken? Nach einer Weile antwortet Christine schließlich, aber nicht sofort, zuerst wischt sie mit dem Schwamm den Tisch ab, trocknet mit dem Geschirrtuch nach und wirkt dabei so konzentriert auf das, was sie tut, oder auf die Antwort, über die sie nachdenken muss, dass eine ganze Weile nur das Ticken der Wanduhr zu hören ist – weil sie nicht weiß, was sie antworten soll, weil sie keine Lust hat, weil sie lieber über etwas anderes sprechen möchte, oder gar nicht sprechen? Ida weiß es nicht, sie spürt, dass Christine sich zurückhält, und gerade, als sie noch einmal fragen will, beginnt Christine zu stottern, sie verliert sich in Ähs, die für sie beide unangenehm sind, in Zaudereien, die ihr nicht ähnlichsehen, denn normalerweise zögert sie beim Reden nicht, ganz im Gegenteil, bis sie sich schließlich zusammennimmt, um dieser Peinlichkeit ein Ende zu bereiten, und endlich herausbringt, ja, ein Geschenk, natürlich, man müsste, ich, um dann mittendrin abzubrechen, als wäre sie selbst überrascht, keine Antwort parat zu haben, sie schüttelt den Kopf, zuckt mit den Schultern, ohnmächtig oder als würde sie aufgeben, du hast gewonnen, na gut, es stimmt, ich habe kein Geschenk.
Aber das sagt sie nicht, während Ida schon weiterfragt, nachhakt, aber nicht plump, fast spielerisch, als könne sie sich nicht vorstellen, dass diese Frage peinlich werden könnte oder dass die Verlegenheit, in die sie Christine bringt, etwas anderes ausdrücken könnte als nur die Unannehmlichkeit, es versäumt zu haben, an ein Geschenk zu denken, nämlich die Wahrheit, die sich hinter diesem Versäumnis verbirgt: ihr Desinteresse am Geburtstag der Mutter der Kleinen, oder vielmehr nicht nur an ihrem Geburtstag, sondern an Idas Mutter selbst.
Wirst du Mama etwas schenken?
Ich weiß nicht. Ich müsste mir Zeit nehmen, ich habe keine rechte Idee. Und mit einer etwas zu raschen Bewegung geht Christine sich noch etwas Tee holen. Ida sieht, wie sie sich abwendet und ihre Tasse nachfüllen geht; sie beobachtet sie von hinten, wie sie sich vorbeugt, und wartet. Christine dreht sich wieder um und sagt, ja, ich müsste, es stimmt, dass ich nicht daran gedacht habe, mir nicht die Zeit genommen habe … Sie beobachtet das Mädchen, die gespreizten Ellbogen auf dem Tisch, fest aufgestützt auf dem Wachstuch mit dem alten Wiesenblumenmuster, das von Messerspuren gezeichnet und von Schwamm- und Scheuerpulverspuren ganz weiß ist, die Hände in Gesichtshöhe, den Oberkörper so tief über den Tisch und über das Blatt gebeugt, auf dem sie zeichnen wird, die dünnen Arme und die langen, zarten Finger, ihr so zarter Kopf, ihre sehr dunklen, lebhaften, intelligenten und fast streitlustigen Augen, und dann die Haare mit den Schmetterlingen und Herzen darin, die die längsten Strähnen zurückhalten, damit sie ihr nicht in die Stirn und die Augen fallen, ihr Christine zugewandtes Gesicht – ihr Gesicht, das Antworten erwartet, das ihr Bedürfnis zeigt, die Gründe zu verstehen für dieses Zögern und dieses Schweigen, diese Unschlüssigkeit zu antworten, obwohl es doch so einfach sein müsste, ihre Frage ist einfach, man muss nur darauf antworten, sie kann sich nicht vorstellen, dass Christine nicht antworten könnte, sie habe selbstverständlich ein Geschenk, das Ida morgen mit ihrer Mutter zusammen entdecken wird, während der Geburtstagsfeier; sie versteht dieses Unbehagen nicht, und Christine spürt es in der sehr kurzen Pause, die entstanden ist; Ida wird fast böse, ich schenke ihr ein Bild, dann kannst du ihr doch ein Gemälde schenken, oder?
Da stürzt sich Christine in eine Erklärung, die einfach und klar klingen sollte, die jedoch verworren herauskommt, ohne dass sie es merkt, ja, du hast recht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr meine Gemälde besonders gefallen. Weißt du … sie gefallen nicht allen Leuten. Es gibt Leute, denen sie nicht gefallen, wirklich überhaupt nicht … Oft sagen die Leute nichts, weil sie dich nicht verletzen wollen oder weil sie nicht wissen, wie sie es dir sagen sollen … und deine Mutter, die sieht meine Gemälde schon so lange, da sage ich mir, dass sie ihr wohl nicht besonders gefallen müssen … Und Christine wird Ida nicht sagen, wie verletzend dieses Schweigen der Leute ist, auch wenn es schonend gemeint ist, dass es einen stärker negiert, als wenn man gar nicht existieren würde, denn man nimmt das Risiko auf sich, diesen Leuten etwas zu geben, und diese Gabe sollte sie im Gegenzug verpflichten, so denkt Christine, die früher bei ihren Vernissagen unter dieser Gleichgültigkeit gelitten hat, wenn manche vorgeblichen »Freunde« lieber über die Qualität des Champagners oder ihre neue Frisur mit ihr reden wollten als über ihre Bilder, ja, die hätte sie umbringen können, und heute kann Christine Ida nicht erklären, dass das einer der Gründe war, warum sie sich schließlich hierher verkrochen hat, in diesen Weiler, vor so langer Zeit schon, um den Messerstichen der verletzenden Sätze, der herablassend lächelnden Gesichter, des vernichtenden Schweigens zu entgehen.