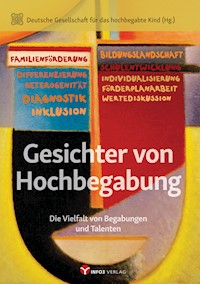
Gesichter von Hochbegabung E-Book
0,0
14,99 €
14,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
Im Rahmen des 40jährigen Jubiläums der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind wurde in einem Kongress März 2018 in Bergisch Gladbach der Stand der Forschung zur Hochbegabung sowie zur Talentforschung eruiert. Dieser Band rückt mit den Beiträgen der Vortragenden die vielfältigen und unterschiedlichen „Gesichter der Hochbegabung“ in den Fokus der Wahrnehmung und fragt nach den Möglichkeiten unseres Bildungssystems, Hochbegabungen differenziert wahrzunehmen und angemessen zu fördern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2019
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Gesichter von
Hochbegabung
Beiträge aus Forschung und Praxis vom Kongress
zum 40-jährigen Bestehen der Deutschen Gesellschaft
für das hochbegabte Kind (DGhK)
Herausgegeben von der DGhK
durch Martina Rosenboom
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-924391-92-8
Erste Auflage 2019
© 2019 Info3-Verlagsgesellschaft Brüll & Heisterkamp KG,
Frankfurt am Main und
© 2019 Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK), Berlin
E-Book-Konvertierung: Ulrich Schmid, de·te·pe, Aalen
Umschlag: Frank Schubert, Frankfurt am Main; unter Verwendung eines Gemäldes von Alexej Jawlensky (Abstrakter Kopf Sonne-Farbe-Leben, 1926).
Inhalt
Vorwort
Grußwort zum vierzigjährigen DGhK-Jubiläum
Miriam Vock, Anne Jurczok
Hochbegabte Kinder erkennen und fördern – Was sagt die Forschung?
Svenja Matheis, Hendrik Eulberg, Marie-Luise Hagelauer und Franzis Preckel
Akzeptanz, Erwartungen, Vorurteile – Vorstellungen von Lehrkräften zu Hochbegabten
Brigitte Sindelar
Teilleistungsschwächen als Hindernis in der Realisierung des kognitiven Hochleistungspotenzials
Martina Rosenboom, Albert Ziegler
Begabtenförderung und Lernumwelten
Lern- und Leistungsbedingungen für hochbegabte Kinder
Alexa Kreitlow
Kita – der frühe Ort der Begabungsförderung?!
Erfahrungen und Perspektiven
Dietrich Arnold & Iris Großgasteiger
„Reden wir über Hochbegabung – bloß wie?“
Ressourcenorientierte Ideen für (vermeintlich) schwierige Gespräche
Ursula Hellert
Gutachten lesen leicht gemacht
Annette Heinbokel
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind – Entstehung und Geschichte
Anhang
Kurzbiografien der BeiträgerInnen
Regionalvereine der DGhK
Vorwort
Gerne sind die Thomas-Morus-Akademie Bensberg und das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) in Braunschweig auf die Anfrage der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) eingegangen, sich an einem Kongress zum 40-jährigen Bestehen der DGhK inhaltlich und organisatorisch zu beteiligen. Beide Partner haben inhaltliche Anknüpfungspunkte zum Thema.
Pädagogische und bildungspolitische Fragestellungen gehören seit der Gründung der Thomas-Morus-Akademie in den 1950er Jahren zum festen Bestandteil des Akademieprogramms. Das Thema „Hochbegabung“ selbst ist schon seit den 1990er Jahren in Akademieveranstaltungen präsent, so erstmals bei einer Tagung mit der Deutschen Montessori-Vereinigung. Eine längere Tradition bei diesem Themenfeld hat es durch die langjährige Zusammenarbeit mit Bildung und Begabung ab dem Jahr 2000 gegeben. Bei diesen jährlich stattfindenden Tagungen wurden verschiedene Themen zum Bereich Hochbegabung diskutiert, ob die Thematik der hochbegabten Mädchen und Frauen, der Frühförderung, der Lehrerbildung, der Begabungstests, der Underachiever … – um nur einiges zu nennen.
Das CJD als weiterer Partner versteht sich selbst als „Chancengeber“. Auf der Basis eines christlichen Menschenbildes geht es in den Einrichtungen des CJD darum, die individuelle Förderung junger Menschen voranzubringen. Dabei steht die Vision einer inklusiven Gesellschaft im Mittelpunkt, bei der keiner verloren gehen darf, ob es die Menschen mit Behinderungen sind oder auch die Menschen mit besonderen Talenten und Begabungen. Die Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher ist daher schon seit Jahrzehnten ein wichtiger Baustein des CJD. Das Netzwerk des CJD war bei der Vorbereitung der Fachtagung eine wichtige Hilfe.
Aufgrund dieser inhaltlichen Nähe gab es von Seiten der Thomas-Morus-Akademie und dem CJD in Braunschweig eine hohe Bereitschaft, zusammen mit der DGhK den Kongress zu ihrem 40-jährigen Bestehen auszurichten. Mit Vorbereitungstreffen, Telefonkonferenzen und bilateralen Abstimmungen wurde der Kongress geplant, der auf eine große Resonanz traf. Eine bunte Mischung aus Mitgliedern der DGhK, Lehrerinnen und Lehrern, Pädagogen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie weiteren Interessierten ermöglichte spannende Diskussionen auf dem Kongress.
Der dreitägige Kongress mit weit mehr als 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zog Bilanz der bisherigen Arbeit der DGhK, warf einen Blick in die aktuelle Forschungslandschaft und wagte einen Ausblick in die Zukunft. Vorträge, Diskussionsrunden und praxisbezogene Seminare beleuchteten die Vielfalt der Fragestellungen und Themen zu Begabungen und zur Talentförderung auf ganz unterschiedliche Weise. Zu einem großen Teil werden die Beiträge in der vorliegenden Veröffentlichung nun publiziert und erlauben auch weiteren Interessierten einen Einblick in diesen Kongress.
Wir danken der Kirmser Stiftung für die finanzielle Unterstützung beim Kongress und bei der Erstellung dieser Publikation.
Ursula Hellert
Gesamtleiterin CJD Braunschweig
Martina Rosenboom
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind
Andreas Würbel
Thomas-Morus-Akademie Bensberg
Grußwort zum vierzigjährigen DGhK-Jubiläum
Themen wie Hochbegabung oder Hochbegabtenförderung waren in der Bundesrepublik Deutschland bis Mitte der 1980er Jahre weithin tabu, trotz einer über hundertjährigen Vorgeschichte (vgl. Heller & Mönks, 2014). Mit der sechsten Weltkonferenz über Hochbegabung – des World Council for Gifted and Talented Children (WCGT/C) – in Hamburg, die 1985 von den Kollegen Wieczerkowski, Cropley et al. organisiert wurde, ging ein „Ruck“ durch die bundesrepublikanische Öffentlichkeit. Wie schon auf der Hamburger WCGT/C-Tagung löst das Reizwort „Hochbegabung“ nicht selten auch heute noch oft kontroverse Diskussionen – sowohl in der öffentlichen Meinung als auch in der aktuellen Bildungspolitik – aus. Während im Ausland, vor allem in den USA sowie in osteuropäischen und ostasiatischen Ländern mit Einheitsschulsystemen die Notwendigkeit einer speziellen Hochbegabtenförderung (aus schulstrukturellen Gründen verständlicherweise) viel früher als hierzulande erkannt und diese dann bereits in den 1970er Jahren auch praktisch umgesetzt worden war, vertraute man in der Bundesrepublik Deutschland allzu lange auf die ausreichende Wirksamkeit der gymnasialen Begabtenförderung. Beispielhaft sei hier auf das Statement des Hamburger Bildungssenators auf der sechsten WCGT/C-Konferenz verwiesen, wo er die Verweigerung der Teilnahme seines Hauses an der (beantragten) Münchner Hochbegabten-Längsschnittstudie in aller Öffentlichkeit damit begründete, dass in Hamburg besonders Begabte schon immer optimal gefördert werden würden und somit hierzu auch keine wissenschaftlichen Untersuchungen erforderlich seien. Diese provokative Behauptung löste nicht nur auf dem (nationalen und internationalen) Experten-Podium und im Auditorium, sondern auch in den Medien – teilweise mit viel Häme kommentierte – heftige Reaktionen aus. Nachfolgende Schulstudien wie TIMSS und PISA haben diese hanseatische Hybris eindrucksvoll Lügen gestraft. Eine der Folgen war dann auch die Ablösung des für die Hamburger Schulen zuständigen Bildungssenators (wenige Monate nach der 1985er Tagung). Spätestens mit der zunehmenden Liberalisierung des gymnasialen Zugangs in immer mehr Bundesländern sowie der damit einhergehenden Noteninflation auch im Gymnasium waren die herkömmlichen unterrichtlichen und schulischen Maßnahmen der Begabten- bzw. Hochbegabtenförderung vielfach obsolet geworden.
Dem vom Verfasser auf Anregung des WCGT/C-Präsidiums auf der sechsten Weltkonferenz in Hamburg organisierten internationalen SymposiumIdentifying and Nurturing the Gifted, an dem sich 21 Referenten bzw. Autoren (vgl. Heller & Feldhusen, 1986) aktiv beteiligten, folgte nur ein Jahr später (1986) auf dem 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) an der Universität Heidelberg ein ganztägiges Symposium (mit insgesamt 13 Beiträgen plus 1 Key Note Referat von A. & K. Stapf) zum Thema „Probleme und Ergebnisse aktueller Hochbegabungsforschung: Theoretische Konzepte – Methoden – Empirische Befunde“. Die zusammen mit meinem Freund und Kollegen Franz Mönks organisierte Heidelberger Veranstaltung war die erste dieser Art zum Thema Hochbegabung auf einer DGPs-Konferenz. Jahre später folgten weitere. In rascher Folge wurden Themen zur Hochbegabtenförderung dann auf den ECHA-Konferenzen in Zürich (1988), Budapest (1990), München (1992), Nijmegen (1994) usw. sowie erneut auf europäischem Boden auf dem neunten WCGT/C-Kongress in Den Haag (1991) behandelt.
Diese rasante Entwicklung war Mitte der 1980er Jahre kaum abzusehen. In diese Zeit der Aufbruchstimmung fällt auch die Initiative zur Gründung der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) vor 40 Jahren.
Mit der DGhK sollte vor allem eine Brücke zwischen den neueren Befunden der Hochbegabungsforschung einerseits und den konkreten Beratungsbedürfnissen hochbegabter Kinder und Jugendlicher sowie deren Eltern bzw. Sozialisationsagenten andererseits geschlagen werden. Die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse der nationalen und internationalen Exzellenzforschung in adäquates praktisches Handeln wie eine gezielte Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher ist meines Erachtens bis heute die zentrale Beratungs- bzw. Aufgabenfunktion der DGhK. Mit der fortschreitenden Wissensakkumulierung der Hochbegabungs- und Expertiseforschung sowie verwandter Paradigmen wächst auch die zunehmende Aufgabenvielfalt der DGhK. Hiervon zeugen nicht zuletzt die fast 140 Ausgaben der MitgliederzeitungLabyrinth im Laufe der Jahrzehnte sehr eindrucksvoll.
Der Wissenschaftliche Beirat der DGhK, dem ich von Anfang an (mit einer kurzen Unterbrechung) bis heute angehöre, sollte neben Anregungen vor allem „Wächter- und Vermittler-Funktionen“ zwischen Experten bzw. Semi-Experten und Praktikern übernehmen: einerseits um desiderablen Forschungsbedarf „in the field“ anzumahnen, andererseits um Missverständnissen oder Fehlentwicklungen in der Hochbegabtenförderung vorzubeugen und diese gegebenenfalls rasch zu korrigieren. Hierbei hat die DGhK über vier Dekaden lang einen beachtenswerten substantiellen Beitrag geleistet. Für ihr unermüdliches Engagement um das Wohl hochbegabter Kinder und Jugendlicher sowie deren Bezugspersonen verdient sie allseits unseren anerkennenden Dank. Dem Vorstand und allen aktiven Mitgliedern der DGhK wünsche ich – für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus – weiterhin erfolgreiches Wirken. Good luck ad multos annos!
Prof. em. Dr. Kurt A. Heller,
Direktor des Zentrums für Begabungsforschung
der LMU München und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der DGhK
Literatur
Heller, K.A. & Feldhusen, J.F. (Eds.).(1986).Identifying and Nurturing the Gifted. An International Perspective. Toronto: Hans Huber Publ.
Heller, K.A. & Mönks, F.J. (Eds.).(2014).Begabungsforschung und Begabtenförderung: der lange Weg zur Anerkennung. Schlüsseltexte 1916–2013.Berlin: LIT.
Miriam Vock, Anne Jurczok
Hochbegabte Kinder erkennen und fördern – Was sagt die Forschung?
1. Hochbegabung und Potenzial zu hoher Leistung
Hochbegabte Kinder und Jugendliche zu erkennen, ihre Potenziale und Leistungen zu erklären und sie angemessen zu fördern, steht seit jeher im Fokus pädagogisch-psychologischer Forschung (Ziegler, 2018). Seit einigen Jahren hat sich in Deutschland auch über die Forschung hinaus weitgehend die Erkenntnis durchgesetzt, dass hochbegabte Kinder angemessene Förderung und Unterstützung benötigen, um sich gut zu entwickeln und ihre Potenziale zu entfalten. In jüngster Zeit hat das Thema Hochbegabung verstärkt Konjunktur und der Anstieg in der finanziellen Ausstattung der Begabtenförderprogramme im Studium (Böker & Horvath, 2018) sowie die aktuelle Bund-Länder-Initiative zur Förderung von (potenziell) leistungsstarken Schülerinnen und Schülern (BMBF & KMK, 2016) zeugen von diesem gestiegenen öffentlichen Bewusstsein und Interesse.
Die Begründungen für die adäquate Förderung von Leistungspotenzialen von Hochbegabten fallen unterschiedlich aus: Zum einen bedeutet eine solche Förderung, Spitzenleistungen und gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es in der Logik der vielseitig geforderten individuellen Förderung in der Schule essentiell, Kinder und Jugendliche jeden Leistungsniveaus zu berücksichtigen. Ein weiterer Beweggrund ist die Prävention, denn eine nicht erkannte oder falsch geförderte Begabung kann mit geringerem Wohlbefinden, Motivationsverlust und Leistungsabfall der Schülerinnen und Schüler einhergehen (Gronostaj, Werner, Bochow & Vock, 2016).
Die medialen Darstellungen von Hochbegabung liefern einen vielfältigen Eindruck von besonders begabten Kindern und Jugendlichen, bedienen sich aber nicht selten stereotyper Bilder, die zwischen den hochbegabten „Überfliegern“ und den sozial unangepassten „Außenseitern“ schwanken. Die WochenzeitungDie Zeit porträtierte beispielsweise Nathalia (Wiarda, 2010), deren Hochbegabung früh erkannt und gefördert wurde. Sie besitzt einen IQ von 130, hat bereits drei Klassen übersprungen und studiert mit 15 Jahren Jura in Hamburg. Erst nach dem Überspringen mehrerer Klassenstufen fand sie Freunde, die ihre vielfältigen intellektuellen Interessen teilten und durch die sie sich endlich sozial eingebunden fühlte. Anders erging es Patrick, der in einem Dokumentarfilm des Medienprojekts Wuppertal (2010) porträtiert wurde: Auch seine Hochbegabung wurde früh erkannt, wegen seiner Tollpatschigkeit und seines für sein Alter ungewöhnlichen Wissens wurde er aber zum Außenseiter, von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt und häufig tätlich angegriffen. Unterstützung von den Lehrkräften bekam er nicht. Er kam in der Schule zunehmend schlecht zurecht, musste mehrfach die Schule wechseln und Klassenstufen wiederholen. Am Ende der Mittelstufe waren seine Noten schlecht und seine Motivation sehr gering. Patrick und Nathalia sind beide intellektuell hochbegabt, aber nur Nathalia gelingt es, diese Begabung in schulische Leistungen zu übersetzen. Beide haben aufgrund ihrer Begabung sehr unterschiedliche – teils auch sehr extreme – Erfahrungen gemacht. Für die Entwicklung außergewöhnlicher Leistungen ist Intelligenz zwar ein wichtiger, aber bei Weitem nicht der einzige Faktor. Verschiedene Persönlichkeits- und Umweltmerkmale können die Leistungsentwicklung stark beeinflussen und führen im ungünstigsten Fall zu Underachievement, also erwartungswidrig schlechten Leistungen bei einer hohen Begabung. Um das Wohlergehen von hochbegabten Kindern und Jugendlichen zu erhalten und zu fördern, sind Identifikation und richtige Förderung entscheidend.
In diesem Beitrag möchten wir grundlegend klären, wie sich erstens aus einer Begabung beziehungsweise einem hohen Potenzial eine besondere Leistung entwickelt und welche Rolle die Intelligenz dabei spielt, zweitens, welche Persönlichkeits- und Umweltfaktoren diese Entwicklung begünstigen oder sie erschweren. Und drittens, welche Förderung von hochbegabten Kindern in der Schule durchgeführt wird und möglich ist.
1.1 Modellvorstellungen zu Hochbegabung
Hochbegabung wurde in der Vergangenheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ganz unterschiedlich beschrieben, es gab immer wieder verschiedene Versuche, das Konstrukt Hochbegabung (also ein theoretischer Begriff zur Erklärung bestimmter Phänomene) zu definieren und anhand von Modellvorstellungen handhabbar zu machen. Ursprünglich wurde der Begriff „Hochbegabung“ geprägt, um außergewöhnliche geistige Leistungen erklären zu können (Preckel & Vock, 2013).
Subotnik, Olszewski-Kubilius und Worrell (2011, S. 7) liefern die aktuell umfassendste Definition darüber, was unter Hochbegabung verstanden wird. Danach manifestiert sich Hochbegabung in einer Leistung oder einem Erzeugnis, welche(s) innerhalb eines Bereiches aber auch im Vergleich zu anderen Leistungen und Erzeugnissen von anderen Personen innerhalb desselben Bereiches als außergewöhnlich gilt. Hochbegabung ist eine entwickelbare Fähigkeit, bei der in jüngeren Jahren das Potenzial und mit zunehmenden Alter die Leistungseminenz als Grundlage der Zuschreibung verwendet wird. Psychosoziale Faktoren beeinflussen neben den kognitiven die Entwicklung von Hochbegabung. Hochbegabung gilt diesen neueren Vorstellungen zufolge als prinzipiell form- und veränderbar und bedarf einer kontinuierlichen Förderung (Subotnik et al., 2011).
Derzeit existieren unterschiedliche Modelle von Hochbegabung und sie werden beständig weiterentwickelt. Die Modelle unterscheiden sich unter anderem darin, ob sie Hochbegabung ein- oder mehrdimensional konzipieren.EindimensionaleModelle basieren typischerweise allein auf einer hohen Ausprägung von Intelligenz (siehe Abschnitt 1.2). Ein einflussreiches und aktuellesmehrdimensionales Modell stammt von dem kanadischen Wissenschaftler Françoys Gagné (2010), das in Abbildung 1 dargestellt ist.
GagnésDifferenziertes Begabungs- und Talentmodell(2010) beschreibt zunächst verschiedeneBegabungen(als hoch ausgeprägte „natürliche Fähigkeiten“, die sich in verschiedenen Domänen zeigen können) und verschiedeneTalente (als hoch ausgeprägte Kompetenzen in verschiedenen Bereichen). Während diesem Modell zufolge die Begabungen weitgehend angeborene, aber noch nicht entwickelte Fähigkeiten sind, werden Talente als systematisch über längere Zeit entwickelte Fähigkeiten verstanden, die sich in Form besonderer Leistungen zeigen. Welche Talente jemand ausbildet, steht auch in Wechselwirkung mit bestimmten arbeitsbezogenen Interessenbereichen, wie sie etwa im RIASEC-Modell von Holland (1997) beschrieben wurden. Der Entwicklungsprozess von den Begabungen hin zu Talenten wird im Modell ebenfalls beschrieben. Dieser Prozess wird durch verschiedene interpersonale und Umweltkatalysatoren, also förderliche Bedingungen, beeinflusst. Zudem wirkt letztlich auch der Zufall auf die Entstehung von Begabungen und auf den Talententwicklungsprozess ein.
Abb. 1: Differenziertes Begabungs- und Talentmodell von Gagné 2.0 (in der Fassung von 2008; Übersetzung durch die Verfasserinnen)
a RIASEC: R=Realistisch, I=Investigativ, A=Künstlerisch (engl. artistic), S=Sozial, E=Unternehmerisch (engl. enterprising), C=Konventionell (engl. conventional)
1.2 Intelligenz
Intelligenz ist ein wesentlicher Bestandteil in Modellen der Hochbegabung und ein zentrales Merkmal, das mit darüber bestimmt, wie schnell ein Mensch Neues lernt und wie gut er mit komplexen neuen Informationen zurechtkommt. Bereits seit über hundert Jahren erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr produktiv die Beschaffenheit und Struktur von Intelligenz und ihren Stellenwert beim Lernen. Dies hat sich in immer differenzierteren Modellvorstellungen und Testverfahren niedergeschlagen, sodass man Intelligenz heute gut beschreiben und das Intelligenzniveau einer Person relativ zuverlässig messen kann (Holling, Preckel & Vock, 2004).
Wie lässt sich Intelligenz definieren? In der Literatur finden sich unterschiedliche Definitionen, ein Beispiel stammt von amerikanischen Intelligenzforscherin Linda Gottfredson (1997, S. 13): „Intelligenz ist eine sehr allgemeine geistige Kapazität, die – unter anderem – die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken, zum Planen, zur Problemlösung, zum abstrakten Denken, zum Verständnis komplexer Ideen, zum schnellen Lernen und zum Lernen aus Erfahrung umfasst. Es ist kein reines Bücherwissen, keine enge akademische Spezialbegabung, keine Testerfahrung. Vielmehr reflektiert Intelligenz ein breiteres und tieferes Vermögen, unsere Umwelt zu verstehen, ‚zu kapieren‘, ‚Sinn in den Dingen zu erkennen‘ oder ‚herauszubekommen‘, was zu tun ist“.
Intelligenz setzt sich aus verschiedenen Teilfähigkeiten zusammen. In so genannten Intelligenzstrukturmodellen beschreiben Intelligenzforscherinnen und -forscher die einzelnen Intelligenzfacetten und ihre Zusammenhänge miteinander, wie sie sie in empirischen Studien mit Testaufgaben, die sie großen Stichproben von Probandinnen und Probanden vorgelegt haben, entdecken konnten. Man geht davon aus, dass diese verschiedenen Intelligenzfacetten hierarchisch in zwei bis drei Ebenen organisiert sind. Während auf der unteren Ebenen recht spezifische Denkfähigkeiten angesiedelt sind, befinden sich auf höheren Ebenen allgemeinere Fähigkeiten, die die Leistungsfähigkeit eines Menschen in sehr verschiedenen intellektuellen Bereichen bestimmen.
Das aktuellste Modell ist dasCattell-Horn-Carroll-Modell der Intelligenz (CHC-Modell; siehe zum Beispiel Flanagan & Kaufman, 2009), das empirisch gut abgesichert ist, ältere Modelle zusammenführt und – anders als einige prominente Vorgängermodelle – nicht mehr von einer einzigen generellen Intelligenzfähigkeit, die sämtliche Denkleistungen einer Person (mit-)beeinflusst, auf der obersten Ebene ausgeht. Das CHC-Modell beschreibt zwei Ebenen: Die obere Ebene bilden sechzehn generellere Faktoren (unter anderem fluide und kristalline Intelligenz, visuell-räumliche Fähigkeiten, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, quantitatives Wissen, taktile oder psychomotorische Fähigkeiten), diese untergliedern sich auf der darunter liegenden Ebene in über 80 spezifischere Fähigkeiten. Ein Teil der im CHC-Modell beschriebenen Intelligenzfähigkeiten kann bei Kindern und Jugendlichen mithilfe des Intelligenztests HAWIK-IV (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder – IV; Petermann & Petermann, 2010) gemessen werden.
Intelligenz ist in der Bevölkerung normalverteilt, sodass verschiedene Menschen jeweils über eine unterschiedlich hohe Intelligenz verfügen, wobei die meisten Menschen über eine Intelligenz im Durchschnittsbereich verfügen (also einen IQ zwischen 85 und 115 haben). Die zwei Prozent intelligentesten Menschen werden, der üblichen Konvention entsprechend, als intellektuell hochbegabt bezeichnet; dies ist gleichbedeutend mit einem IQ von mindestens 130. Einige Forscherinnen und Forscher setzen aber auch andere Grenzwerte; so bezeichnet etwa Gagné (2010) die zehn Prozent begabtesten Menschen als „mildly gifted“, die ein Prozent begabtesten als „moderately gifted“ und die 0,1 Prozent begabtesten als „highly gifted“.
Wie intelligent eine Person ist, hängt zwar zunächst von genetischen Faktoren ab, jedoch sind Umweltbedingungen und Lerngelegenheiten entscheidend dafür, wie sich die Intelligenz im Lauf der Kindheit und Jugend entwickelt (Stern & Hardy, 2004). So haben auch die Art der Beschulung und die erhaltene Förderung im Unterricht einen Einfluss auf die Intelligenzentwicklung: Werden Schülerinnen und Schüler durch einen kognitiv anregenden und herausfordernden Unterricht angemessen gefördert, führt dies zu messbaren Intelligenzzuwächsen. Während Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lange Zeit annahmen, die Intelligenz sei im fortgeschrittenen Schulalter ein äußerst stabiles Merkmal einer Person, zeigen neuere Forschungen die Veränderbarkeit von Intelligenz auch im Jugendalter. Tatsächlich stellten mehrere Studien in Deutschland fest, dass sich – bei gleicher Intelligenz zu Beginn der Sekundarstufe – die Intelligenz derjenigen Schülerinnen und Schüler über die Jahre deutlich steigerte, die ein Gymnasium besucht hatten (im Gegensatz zu denjenigen, die eine andere Schulform besucht hatten; Becker, Lüdtke, Trautwein, Köller & Baumert, 2012; Guill, Lüdtke & Köller, 2017). Im Kern geht es hier offenbar darum, dass eine intellektuell besonders fordernde und anregende Lernumwelt (geprägt durch anspruchsvolle Lehrpläne, kognitiv anregenden Unterricht, hohe Leistungsanforderungen) die Intelligenz von Schüler/innen fördert, während eine wenig anregende Lernumwelt die Intelligenz stagnieren lässt. Generell gilt, dass sich das intellektuelle Potenzial von Kindern und Jugendlichen nur dann voll entfalten kann, wenn angemessene Lerngelegenheiten zur Verfügung stehen.
1.3 Praktische Hinweise zur Intelligenztestung
Um hochbegabte Kinder und Jugendliche zu erkennen und dann differenziert zu fördern, bedarf es einer professionellen Hochbegabungsdiagnostik. Wie eben dargestellt, gibt es eine Vielzahl von Modellvorstellungen zu Hochbegabung und Intelligenz, die unterschiedliche Faktoren und Intelligenzfacetten berücksichtigen. Eine professionelle Diagnostik umfasst ein Bündel an diagnostischen Maßnahmen, welches neben einer Intelligenztestung auch weitere Konstrukte beinhaltet, wie Informationen zu psychosozialen Eigenschaften – etwa der Motivation – oder zu kontextuellen-sozialen Merkmalen wie der Lebens- und Lernumwelt des Kindes sowie schulische Leistungen. Im Folgenden stellen wir die Intelligenztestung als eine Maßnahme der Hochbegabungsdiagnostik näher vor.
Bei Intelligenztestungen sind stets zwei Fragen zentral: Erstens,wozu teste ichund zweitens,was wird erfasst(Preckel, 2010; Preckel & Vock, 2013). In der Praxis sollte eine Intelligenztestung dazu dienen, eine diagnostische Frage zu beantworten und aus einem konkreten Anlass heraus erfolgen. Denn nicht jeder Verdacht auf Hochbegabung muss notwendigerweise mithilfe eines Intelligenztests überprüft werden. Der Pädagogische Psychologe Professor Detlef Rost, Leiter des Marburger Hochbegabtenprojektes, sagte dazu in einem Interview einmal ganz treffend, dass „man […] ja auch nicht zum Arzt [gehe], um »nur so« messen zu lassen, wie groß der Fußknöchel vom zweiten Zeh ist“ (Dietrich, 2007). Es gibt jedoch bestimmte Anlässe, bei denen die Testung einer möglichen intellektuellen Hochbegabung sinnvoll oder sogar geboten ist. Solche Anlässe sind beispielsweise, wenn die intellektuelle Begabung des Kindes von den Eltern, der Schule oder dem Betroffenen selbst sehr unterschiedlich eingeschätzt wird. Gerade Mädchen (und oft auch ihr Umfeld) neigen dazu, ihre Intelligenz geringer zu bewerten; ein Test kann hier Sicherheit liefern und eine Quelle für mehr Selbstvertrauen in die eigene Begabung sein (Ziegler, Heller & Stachl, 2010). Die Frage nach der Passung einer bestimmten Fördermaßnahme wäre ein weiterer Anlass.
Eine sorgfältige Auswahl für bestimmte Fördermaßnahmen ist zentral, um mögliche Überforderungen oder Motivationseinbrüche zu vermeiden. Aber auch Nominierungsverfahren für spezielle Fördermaßnahmen durch Lehrkräfte oder pädagogisches Personal können sinnvollerweise von einer Intelligenztestung flankiert werden. Denn Nominierungsverfahren zeigen sich in der Praxis anfällig für soziale und ethnische Selektivität, sodass bestimmte Gruppen von Schülerinnen und Schülern eher unterrepräsentiert bleiben (Baudson, 2010). Ein weiterer Anlass für die Testung können schwankende oder schwache Schulleistungen bei gleichzeitigen Anzeichen für hohe Begabung sein. Besonders im Zusammenhang von Underachievement, der erwartungswidrigen Minderleistung, stellt die Intelligenztestung einen Baustein dar, um mögliche Ursachen für die Minderleistungen zu identifizieren und geeignete Fördermaßnahmen zu initiieren. Die Intelligenztestung sollte also immer Mittel zum Zweck der Beantwortung einer konkreten diagnostischen Frage sein.
Wenn die Intention der Testung klar ist, geht es darum, für diese den passenden Intelligenztest auszuwählen, also zu klären,wasüberhaupterfasst werden soll. Denn den unterschiedlichen Intelligenztests liegen unterschiedliche theoretische Modellvorstellungen von Intelligenz zugrunde, zudem erfassen sie in der Regel nur Ausschnitte aus den in einem Modell spezifizierten Intelligenzfähigkeiten. Welche Art von Intelligenztest am besten geeignet ist, hängt dabei von der konkreten zu beantwortenden diagnostischen Frage ab. So erfordert die Frage nach der Aufnahme in eine allgemeine Hochbegabtenklasse beispielsweise eher solche Intelligenztests, die ein breites Spektrum an Fähigkeiten überprüfen, während bei fachspezifischen Förderprogrammen Testverfahren passender sind, die spezifischere Begabungen testen, wie zum Beispiel numerische und mathematische Fähigkeiten in einem Aufnahmeverfahren für ein mathematisch ausgerichtetes Spezialgymnasium.
Ganz allgemein wird empfohlen, bei der Hochbegabungsdiagnostik einen Intelligenzstrukturtest einzusetzen (Preckel & Vock, 2013), bei dem ein breites Spektrum an Begabungsbereichen abgedeckt wird. Denn in den meisten Fällen haben hochbegabte Personen ein unausgeglichenes Begabungsprofil mit verschiedenen Begabungsschwerpunkten (Preckel & Vock, 2013; Subotnik et al., 2011). Diese sind zentral, um dann dem Anlass entsprechende Empfehlungen auszusprechen oder Fördermaßnahmen einzuleiten. Da Intelligenztests für Kinder meist in erster Linie für eine genaue Messung im unteren oder mittleren Intelligenzbereich konzipiert sind, sind die Messungen im hohen und sehr hohen Intelligenzbereich weniger genau. Manchmal stoßen Kinder, bildlich gesprochen, mit ihrer Leistung auch an die Testdecke (lösen also alle Aufgaben), sodass ihre tatsächliche Intelligenz möglicherweise höher liegt als die im Test gemessene. Einige Tests sind explizit (auch) für den Einsatz im hohen Intelligenzbereich entwickelt worden; dazu gehören der THINK 1-4 für Grundschulkinder (Baudson, Wollschläger & Preckel, 2016), der BIS-HB-Test für Jugendliche ab zwölf Jahren (Jäger et al., 2006) sowie die Tests der Münchner Hochbegabungstestbatterie (MHBT; Heller & Perleth, 2007a, 2007b).
Ganz praktisch gelten folgende Qualitätsmerkmale für Intelligenztestungen (Preckel, 2010; Preckel & Vock, 2013): Die Testverfahren müssen wissenschaftlichen Gütekriterien entsprechen1. Dazu zählt, dass der Test ein bewährter standardisierter Intelligenztest ist und eine aktuelle Norm beinhaltet, die Normierung sollte optimalerweise nicht länger als zehn bis 15 Jahre zurückliegen. Die Durchführung erfolgt durch eine/n fachlich qualifizierte/n Psychologen/in, der/die ein schriftliches Gutachten erstellt. In diesem Gutachten wird die Genauigkeit der Messung angegeben und die Ergebnisse sollen so erläutert werden, dass die Eltern sie verstehen können. Bei jüngeren Kindern sollten für wichtige Entscheidungen (etwa vorzeitige Einschulung, Klassenüberspringen) nur aktuelle Testergebnisse verwendet werden, die nicht älter als ein Jahr sind, da sich die Intelligenz in dieser Entwicklungsphase noch stark verändern kann. Ferner gilt, dass bei wichtigen Entscheidungen oftmals ein einzelner Test nicht ausreichend ist. Es empfiehlt sich – wenn möglich – zur Absicherung der Ergebnisse zwei Tests einzusetzen. Selbst wenn diese Qualitätskriterien eingehalten werden, können Intelligenztests manchmal nicht ausreichen, um die Begabung eines Kindes klar genug zu erkennen, sodass auch immer noch weitere diagnostische Maßnahmen (beispielsweise zur Erfassung von Motivation, Schulleistung) eingesetzt werden sollten.
Bei der Interpretation von Testergebnissen besteht eine typische Herausforderung darin, dass die Testergebnisse eines Kindes in verschiedenen Tests deutlich voneinander abweichen können, sogar dann, wenn sie in gleichem Alter kurz nacheinander durchgeführt wurden. Nach einem Test ist ein Kind möglicherweise hochbegabt, da das Ergebnis über dem Grenzwert von IQ 130 liegt, nach dem anderen nicht. Dies kann verschiedene Gründe haben, unter anderem den, dass die verschiedenen Tests unterschiedliche Intelligenzfacetten erfassen und das Kind hier tatsächlich unterschiedliche Begabungen zeigt, oder dass das Kind zu den beiden Messzeitpunkten unterschiedlich gut in Form war. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass selbst sehr gute Tests – wie alle psychologischen Maße – immer einen gewissen Messfehler aufweisen, und die gemessenen IQ-Werte nie ganz exakt den wahren Intelligenzwert eines Kindes abbilden.
2. Sind hochbegabte Kinder besondere Kinder?
Wie eingangs dargestellt, sind die Gesichter von Hochbegabung vielfältig und auch die unterschiedliche Herangehensweise in der Definition von Hochbegabung und Intelligenz legt den Schluss nahe, dass es „die“ hochbegabten Kinder nicht gibt. Vielmehr werden je nach Intelligenzmaß und -modell unterschiedliche Kinder als hochbegabt definiert und verschiedene Faktoren in der Definition berücksichtigt. Was ist also das Besondere an hochbegabten Kindern und Jugendlichen? Sind sie im Grunde genauso wie alle anderen Kinder, nur eben intelligenter, oder unterscheiden sie sich in ihrer Persönlichkeit, ihrem Sozialverhalten und ihrem schulischen und späteren beruflichen Erfolg von anderen Menschen? Im Folgenden werden wir uns anhand von einschlägigen Längsschnittstudien und systematischen Reviews mit ausgewählten Merkmalen von intellektuell Begabten eingehender befassen. Dabei betrachten wir zunächst leistungsbezogene Merkmale wie Schulerfolg und anschließend persönlichkeitsbezogene Merkmale wie die sozio-emotionale Anpassung oder Motivation.
2.1 Leistungsbezogene Merkmale





























