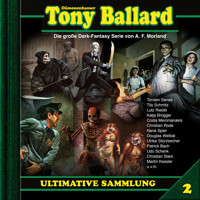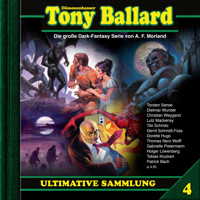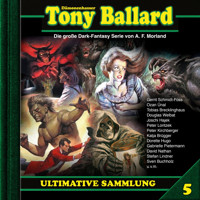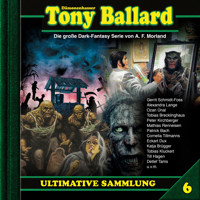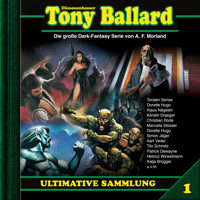1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Die steile Rolltreppe bewegte sich träge und geräuschlos nach oben. Sie war so unglaublich lang, dass man meinen konnte, sie würde geradewegs in den Himmel führen - vom Diesseits ins Jenseits.
Geneviève McGowan stand mutterseelenallein darauf. Ihre Nerven flatterten. Dicke Schweißperlen glänzten auf ihrer Stirn. Sie hatte Angst.
Berechtigte Angst, weil sie mit geradezu beklemmender Sicherheit wusste, dass dort oben jemand auf sie wartete, vor dem sich jeder Mensch fürchtet und dem niemand begegnen will.
Nämlich der Tod!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort
Die schwarze Druidin
Special
Vorschau
Impressum
Hallo, liebe Tony-Ballard-Fans!
Euer Held und seine Kampfgefährten – allen voran Vicky Bonney, Roxane, die Hexe aus dem Jenseits, und der Ex-Dämon Mr. Silver – sind in ihre alte Heimat, den Gespenster-Krimi des Bastei-Verlags, zurückgekehrt. Back to the roots!
Hier hat die Serie begonnen, und hier schließt sich nach sehr langer Zeit wieder ein ganz großer Kreis. So mancher von euch hat in der Vergangenheit seinem Tony Ballard unerschütterlich die Treue gehalten. Das weiß ich aus vielen begeisterten Zuschriften (aus Briefen und aus Social-Media-Postings), die mich immer wieder erreicht haben.
Sie haben ihren mutigen Kämpfer gegen das Böse auf all seinen gefährlichen Wegen begleitet, um die Ballard-Crew gebangt und gezittert und mit ihr in unzähligen Schlachten gegen die schwarze Macht gefiebert.
Lasst mich euch hier und jetzt dafür danken, dass ihr diesen langen Weg mit dem Dämonenhasser und seinen wackeren Mitstreitern gegangen seid.
Ich wünsche euch viel Spaß, ein cooles Grusel-Feeling und spannende Unterhaltung mit dem vorliegenden Abenteuer, in dem sich ganz bestimmt auch jeder Neueinsteiger sofort zurechtfinden wird, und hoffe, mein Held erobert, wie einst,wieder eure und viele neue Herzen.
Beste Grüße
Ihr und euer
A.F. Morland
Die schwarze Druidin
Ein Tony Ballard Roman
von A.F. Morland
Die steile Rolltreppe bewegte sich träge und geräuschlos nach oben. Sie war so unglaublich lang, dass man meinen konnte, sie würde geradewegs in den Himmel führen – vom Diesseits ins Jenseits.
Geneviève McGowan stand mutterseelenallein darauf. Ihre Nerven flatterten. Dicke Schweißperlen glänzten auf ihrer Stirn. Sie hatte Angst.
Berechtigte Angst, weil sie mit geradezu beklemmender Sicherheit wusste, dass dort oben jemand auf sie wartete, vor dem sich jeder Mensch fürchtet und dem niemand begegnen will.
Nämlich der Tod!
Auf halber Strecke blieb die Rolltreppe fast stehen. Geneviève McGowans Herz schlug sofort schneller. Ihr Mund trocknete aus, und Kälte rieselte ihr über den Rücken.
Sie klammerte sich beunruhigt mit beiden Händen an den schwarzen Handlauf und blickte nervös nach oben. Was war los? Was hatte das zu bedeuten? Wieso bewegte sich die Treppe kaum noch? Wer bremste sie? Und warum? Sollte es noch länger dauern, bis sie oben ankam? Quälend lange? Damit die Angst ausreichend Zeit hatte, ihr den Versand zu rauben?
Geneviève wollte sich umdrehen und die Treppe, die kaum noch in Bewegung war, hinunterlaufen. Doch das war ihr nicht möglich. Ihre flachen Schuhe schienen auf der gerippten Stufe, auf der sie stand, festgeleimt zu sein. Seltsamerweise hatte sie auch kein Gefühl mehr in den Füßen. Sie waren taub geworden. Wie abgestorben. Wieso, das wusste sie nicht. Sie wusste lediglich, dass ihre Füße ihr nicht mehr gehorchten.
Das kann nur einer veranlasst haben, ging es der jungen Frau durch den Sinn.
ER!
Das schwarze Kuttenwesen mit den vielen Namen: Knochenmann, Sensenmann, Gevatter Tod, Freund Hein, Schnitter, Thanatos ... Die Menschen waren sehr erfinderisch, wenn es darum ging, ihm einen Namen zu geben.
Obwohl die Rolltreppe sich nur noch im Zeitlupentempo bewegte, kam das obere Ende trotzdem unaufhaltsam näher. Geneviève McGowans Nerven lagen blank. Sie spürte einen schmerzhaften Druck auf ihrer Brust, der permanent stärker wurde. Gleichzeitig hatte sie das entsetzliche Gefühl, eine eiskalte Schlinge hätte sich um ihren Hals gelegt und würde sich nun gnadenlos zusammenziehen.
Sie bekam nicht mehr genug Luft. Die akute Atemnot machte sie konfus. Sie warf den Kopf wild hin und her, riss Augen und Mund weit auf, rang verzweifelt nach Atem – und zu allem Überfluss erschien am oberen Treppenende auch noch der, der sich ihre Seele holen wollte.
Pechschwarz – schwärzer als die schwärzeste Nacht – waren sein weiter, wallender Umhang und die große Kapuze, in deren dunklem Schatten nichts zu erkennen war. Kein Gesicht. Keine Knochenfratze. Gar nichts.
Man hätte meinen können, der Umhang wäre leer. Eine gespenstische Hülle, die von unheimlichen Kräften aufrecht gehalten wurde.
In seiner Rechten, die ebenfalls nicht zu sehen war, weil der lange Kuttenärmel sie verdeckte, hielt der Tod eine riesige Sense, auf deren tödlich scharfem gekrümmten Blatt blitzende Reflexe tanzten.
Gevatter Tods Waffe schien auf eine unerklärbare Weise zu leben und förmlich nach dem Leben der jungen Frau zu gieren. Geneviève McGowan konnte diese nervenzerfetzende Situation nicht länger ertragen, und es wurde für sie in diesem schrecklichen Moment zur absoluten Gewissheit, dass sie hoffnungslos verloren war. Dass nichts und niemand sie mehr retten konnte.
In ihrer abgrundtiefen Verzweiflung stieß sie einen letzten lauten, gellenden Schrei aus, den jedoch nur sie und der grausame Schnitter hörten.
†
Meine Frau Vicky, Roxane, die Hexe aus dem Jenseits, der Ex-Dämon Mr. Silver und ich waren zum Essen eingeladen. Unsere Gastgeber waren die sympathischen Gnome Priyna und Cruv, die zwar schon sehr lange auf der Erde wohnten, aber hier nicht geboren worden waren.
Ihre »Wiege« hatte auf der Prä-Welt Coor gestanden. Da, wo diesen – für unseren Geschmack – eher unansehnlichen, um nicht zu sagen hässlichen kleinen Wesen jede Daseinsberechtigung abgesprochen wurde. Gnome waren in ihrer Heimat minderwertigstes Freiwild, immer auf der Flucht und nirgendwo ihres Lebens sicher. Jeder durfte sie ungestraft jagen, quälen, töten, fressen – was auch immer.
Deshalb wurde auch kaum einer von ihnen alt. Nahezu alle starben keines natürlichen Todes. Sie wurden früher oder später erschlagen, zerrissen, von Lanzen, Schwertern oder Pfeilen durchbohrt, verbrannt, ertränkt ...
Und deshalb hatten wir sie von Coor, einer der feindseligsten und gefährlichsten Welten, die wir jemals kennengelernt hatten, fortgeholt und hier, bei uns, in Sicherheit gebracht.
Auf Coor gab es so gut wie nichts, was es nicht gab. Saurier, Flugdrachen, Zauberer, Höllenschlangen, Hexen, schwarze Ritter, Mord-Magier, Säbelzahntiger, Kannibalen und viele schreckliche Arten von kraftstrotzenden Monstern. Wer sich dorthin begab, konnte niemals sicher sein, dass er auch wieder einigermaßen heil zurückkam.
Wir hatten auf Coor schon die gefährlichsten und unglaublichsten Abenteuer erlebt. Mehr als einmal hatte unser Leben nur noch an einem seidenen Faden, der jeden Moment reißen konnte, gehangen. Und manchmal waren wir nur mit ausgesprochen viel Glück gerade noch mal über die Runden gekommen.
Aber die schwarze Macht und ihre vielen Vasallen machten uns auch hier immer wieder arg zu schaffen. Zuletzt war unser kleiner Freund Cruv haarscharf am Tod vorbeigeschrammt. Ein extrem gefährlicher Gestaltwandler namens Cronnock hatte ihn magisch vergiftet.
Es hatte ganz danach ausgesehen, als könne dem langsam dahinsiechenden Gnom niemand mehr helfen, als wäre er rettungslos verloren.
Und das wäre er auch tatsächlich gewesen, wenn es uns nicht gelungen wäre, den Urheber der hoch ansteckenden magischen Krankheit mit fast übermenschlichem Krafteinsatz zur Strecke zu bringen.
Hätten wir das nicht geschafft, dann hätte die grüne Seuche, die sich, von London ausgehend, mit unglaublicher Rasanz über die ganze Welt ausgebreitet hatte, Millionen Menschenleben gefordert. Ich bin mir dessen völlig bewusst, dass das unglaublich protzig klingt, und ich behaupte es auch nicht gern, weil mir Prahlerei in jeder Form zuwider ist.
Aber es war nun mal eine unwiderlegbare, unleugbare Tatsache und die absolute Wahrheit, dass wir mit unserem bedingungslosen Einsatz die Welt gerettet hatten. Aber wir hängten das nicht an die große Glocke.
Mit der Vernichtung des Gestaltwandlers und Seuchendämons hatte auch seine mysteriöse, todbringende Pandemie geendet, die weltweit bereits viele Opfer gefordert hatte und noch sehr viele mehr gefordert hätte.
Sobald Cronnock tot gewesen war, hatte es schlagartig keine Infizierten mehr gegeben, weil seine vernichtende Kraft sie verlassen musste. Die hohe Ansteckungsgefahr war gebannt gewesen. Und es war noch ein Gutes dazugekommen: Jene, die besessen gewesen waren, konnten sich nicht mehr daran erinnern. Ein Segen für sie.
Epidemiologen, Serologen, Virologen, Psychologen, Ärzte, Fachjournalisten, Wissenschaftler, Seuchenforscher, Politiker, Pharmakonzerne und viele andere standen jetzt allesamt vor einem für sie unlösbaren Rätsel. Niemand konnte sich das abrupte Ende der schrecklichen Bedrohung erklären.
Wir hätten es gekonnt.
Aber wir schwiegen.
†
Sie hatte alles versucht und alles gegeben. Einem Teufel muss man schließlich etwas bieten, wenn man bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen will.
Und genau das war Riganis Absicht gewesen. Es hatte der schwarzen Druidin nicht gereicht, eine von vielen zu sein. Ganz hoch hinauf hatte sie gewollt. An die absolute Spitze. An Loxagons Seite hatte sie herrschen wollen, und sie war bereit gewesen, jedes Opfer zu bringen, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. Aber die Konkurrenz war groß.
Hexen, Hermaphroditen, geschlechtlich nicht exakt einzuordnende Monster und Teufelsweiber buhlten seit jeher genauso wie Rigani um die Gunst des begehrten Teufelssohns. Und alle waren bereit, alles zu geben.
Die schwarze Druidin hatte sich von Anfang an nichts vorgemacht. Ihr war klar gewesen, dass es nicht leicht sein würde, diese vielen, zum Teil recht ernst zu nehmenden Rivalinnen aus dem Feld zu schlagen.
Aber sie hatte es sich zugetraut und war die Sache mit eiserner Disziplin, apodiktischem Willen und entschlossener Zielstrebigkeit angegangen.
Loxagon, der Sohn des Teufels und einer Schakalin, war sehr bald schon auf sie aufmerksam geworden, und die schwarze Druidin hatte nichts unversucht gelassen, um sein Interesse an ihrer Person – und an ihrem makellosen, überaus reizvollen und begehrenswerten Körper – nicht nur aufrecht zu halten, sondern listig und mit großer Raffinesse zu schüren.
Ihr war bewusst gewesen, dass sie im Begriff war, sich zu prostituieren, aber das Ziel, das sie sich gesetzt hatte, war das durchaus wert. Viele Frauen verkauften sich für sehr viel weniger. Es hatte nicht allzu lange gedauert, bis Loxagon sie in seinen Feuerpalast geholt hatte.
Ihre Rivalinnen wären vor Neid beinahe zersprungen, und der Teufelssohn, der zum Teil wie sein Vater und zum Teil wie seine Mutter aussah, war von dem, was die unglaublich schöne, reizvolle, hemmungslos leidenschaftliche Rigani ihm geboten hatte, sichtlich beeindruckt gewesen.
So sehr, dass in ihm der Wunsch erwacht war, mit ihr so viele Bastarde wie möglich zu zeugen. Eine Dynastie hatte er mit der schwarzen Druidin züchten wollen, und sie hatte schon deshalb nichts dagegen gehabt, weil sie gehofft hatte, jedes Kind, das sie ihm schenken würde, würde sie enger an ihn binden.
Doch ...
Was immer sie mit dem Höllenherrscher angestellt hatte, um seinem Wunsch zu entsprechen – es hatte nicht gefruchtet. Dass es nicht an ihm liegen konnte, bewiesen die vielen Nachkommen, die er bereits mit anderen Hexen, Teufelinnen und Dämoninnen gezeugt hatte.
Rigani hatte – ehrgeizig, wie sie war – alle Register ihres großen, umfassenden Druidenwissens gezogen, um ihrer Fruchtbarkeit auf die Sprünge zu helfen. Sie hatte die Kraft ihres Druidenstabs in ihr Becken fließen lassen, im Shadowland während eines geheimen Rituals Teufelsblut getrunken, sich Monsterhirne einverleibt und noch lebenswarme, zuckende Dämonenherzen verspeist.
Doch es war dabei geblieben – sie hatte von Loxagon kein Kind empfangen können. Je mehr sie sich hinter seinem Rücken darum bemüht hatte, fruchtbar zu werden, desto rascher war sein Interesse an ihr geschwunden, und von da an hatte es nicht mehr lange gedauert, bis er sich andere Weiber in den Feuerpalast geholt, sich mit denen vergnügt und sich nicht mehr um Rigani gekümmert hatte.
Die schwarze Druidin war immerhin so klug gewesen, sich nicht länger um ihn zu bemühen, denn wenn sie ihm mit ihrer Aufdringlichkeit auf die Nerven gegangen wäre, hätte er sie mit Sicherheit – so war er nun mal – dem obersten Höllenhenker übergeben, um sie sich ein für alle Mal vom Hals zu schaffen.
Der Teufelssohn hatte sie noch eine Weile im Feuerpalast geduldet, doch irgendwann hatte er sie dann an Taffan, ein widerliches, schleimiges, Speichel leckendes und Ekel erregendes Mitglied des hohen Höllenadels, weitergereicht und ihm gesagt, er könne mit ihr anstellen, was immer er wolle – was Taffan auch prompt getan hatte.
Von da an hatte für Rigani ein unvorstellbarer Leidensweg, ein unbeschreibliches Martyrium, begonnen. Taffan, ihr von Loxagon bestimmter Herr und Besitzer, hatte ihr, seiner Sklavin, nicht nur wiederholt Gewalt angetan.
Er hatte sie zudem pausenlos erniedrigt, gedemütigt, geschlagen, hungern lassen und gefoltert. Die schwarze Druidin hatte hoch hinaus gewollt – und war schmerzhaft tief gefallen. Aus dem erträumten Bündnis mit dem Höllenherrscher war nichts geworden. Und nun war sie gezwungen, die Strafe für ihren übersteigerten Ehrgeiz zu ertragen.
†
Der laute, gellende Schrei – ihr eigener – riss Geneviève McGowan jäh aus ihrem schrecklichen Albtraum. Sie rang hysterisch nach Luft, war in Schweiß gebadet und starrte panisch in die Dunkelheit ihres kleinen Schlafzimmers. Niemand war bei ihr. Sie war allein, wurde nicht bedroht, war nicht in Gefahr, stand auf keiner steilen, endlos langen Rolltreppe, die ins Jenseits führte, wie sie geglaubt hatte.
Dennoch dauerte es eine Weile, bis sie sich beruhigt hatte und ihr Puls in die Normalfrequenz zurückgefunden. Sie warf einen Blick auf den Radio-Funkwecker. Die Digitalanzeige stand auf Mitternacht.
Geneviève schlug die Bettdecke zur Seite und stand auf, ohne Licht zu machen. Sie schwankte kurz. Ihr hauchdünnes Nightie klebte unangenehm kalt und feucht an ihrer Haut. Sie zog es aus, ließ es hinter sich zu Boden flattern und lief nackt ins Bad. Nach einer zehnminütigen Wechseldusche (warm-kalt-warm-kalt) stieg sie einigermaßen »wiederbelebt« aus der Kabine und betrachtete sich im großen Spiegel.
Sie war hübsch. Selbst jetzt, ungeschminkt und mit klatschnassem Kurzhaar, das im Moment fast schwarz wirkte, in trockenem Zustand aber sandfarben war. Ihr Busen war nicht besonders groß, aber immerhin größer als der von Charlize Theron, und die hatte es schließlich zum gefeierten Hollywoodstar gebracht.
Geneviève McGowan hingegen war nur eine kleine Umweltaktivistin. Neunzehn Jahre jung und noch voller Ideale. Sie bekam ein bisschen Geld dafür, dass sie sich im Kampf gegen den drohenden Klimawandel, gegen gewissenlose Landnahme und gegen hemmungslosen Raubbau an der Natur einsetzte.
Das war bisweilen nicht ganz ungefährlich. Allein im vergangenen Jahr hatten 227 Umweltschützer ihr Leben verloren, wobei die meisten Morde – drei Viertel – in Lateinamerika registriert worden waren.
Hier, in London, lebte man als leidenschaftlicher Kämpfer für die Umwelt zum Glück nicht ganz so gefährlich. Geneviève McGowan trocknete ihr Haar, schlüpfte in einen weißen Frotteemantel und verließ das Bad.
Ihr Smartphone lag auf einem kleinen Kirschholz-Schreibtisch. Neben dem Notebook und dem Tintenstrahldrucker. Sie nahm das Handy in die Hand.
Soll ich?, überlegte sie. Soll ich nicht? Es ist schon spät. Aber er hat gesagt, ich kann ihn immer anrufen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Außerdem ist er ein Nachtmensch und liegt bestimmt noch nicht im Bett. Vielleicht guckt er gerade einen Film. Er mag Western. Die alten. Nicht die neuen. Die mit John Wayne, Richard Widmark, Kirk Douglas, Anthony Quinn ...
Geneviève wählte seine gespeicherte Nummer. Ben Zoolander meldete sich fast augenblicklich. Als hätte er auf ihren Anruf gewartet. Es tat ihr gut, seine Stimme zu hören.
»Wobei störe ich?«, erkundigte sie sich.
»Du störst nie und bei gar nichts«, stellte er mit unüberhörbarer Bestimmtheit klar. Im Hintergrund waren Hufschläge zu hören.
»Siehst du fern?«, fragte Geneviève.
»Ja.«
»Was denn?«
»Vera Cruz«, antwortete Ben. »Mit Gary Cooper und Burt Lancaster. Ich liebe die beiden.«
Sie schmunzelte. »Ich dachte, du liebst mich.«
»Dich natürlich auch. Und zuerst. Und natürlich am allermeisten. Du zweifelst doch nicht etwa daran?«
»Kein bisschen«, gab sie leise zurück. Ihr wurde endlich wieder warm ums Herz. Sie spielte mit dem Bindegürtel ihres Bademantels. »Ich liebe dich auch, Ben.«
Er seufzte wohlig. »Das geht runter wie Öl, Liebes.«
Sie senkte ihre Stimme. »Ben ...«
Er merkte sogleich, dass sie ihn nicht ohne Grund angerufen hatte. »Hattest du schon wieder diesen furchtbaren Albtraum, Geneviève?«, fragte er mitfühlend.
»Ja«, kam es trocken über ihre Lippen.
»Die Rolltreppe im Nirgendwo?«, fragte Ben Zoolander.
»Ja.«
»Die nirgendwo hinführt?«
»Ja«, antwortete Geneviève.
»Und oben wartete wieder der Tod auf dich? Groß, schwarz, unheimlich?«
»Ja, Ben.«
»Das träumst du jetzt schon zum sechsten Mal«, sagte Ben Zoolander besorgt.
»Ich komme dem Tod dabei jedes Mal näher«, sagte Geneviève McGowan mit belegter Stimme.
»Und das macht dir Angst«, sagte er dunkel.
»Und wie«, gab Geneviève zu. »Entsetzliche Angst.«
»Ist zu verstehen«, versetzte Ben Zoolander anteilnehmend. »Möchtest du, dass ich zu dir komme?«
»Das brauchst du nicht, Ben.«
»Wenn ich kräftig in die Pedale meines Drahtesels trete, kann ich in zwanzig Minuten bei dir sein.«
»Es genügt mir, mit dir darüber zu reden«, versicherte sie ihm. »Was wird im siebten Traum passieren, Ben?«, fragte sie beklommen. »Was wird mit mir geschehen, wenn ich oben ankomme?«
»Nichts«, antwortete er so entschieden, als wäre er davon absolut überzeugt. »Nichts wird passieren. Nicht das Geringste. Und ich sage dir auch, warum nicht. Weil du das alles nicht wirklich erlebst. Das Ganze ist nichts weiter als ein ganz, ganz böser Traum. Ein gruseliges Hirngespinst. Nichts weiter. Das ist nicht die Realität. Glaube mir, du hast nichts zu befürchten.«
»Es könnte eine Warnung aus dem Jenseits sein«, meinte Geneviève McGowan heiser.
»Ach was.«
»Eine Drohung. Eine Ahnung ...«
Ben Zoolander sagte eindringlich: »Hör zu, Liebes. Falls du in einer der nächsten Nächte zum siebten Mal auf dieser Rolltreppe stehen solltest – was ich dir, ehrlich gesagt, nicht wünsche – und falls du dann tatsächlich in die Reichweite dieses unheimlichen Kuttenträgers gelangen solltest, wird die furchterregende Geschichte wie eine hässliche schwarze Seifenblase zerplatzen. Der gruselige Schnitter wird mit seiner großen Sense zwar noch weit ausholen – und vielleicht wird er auch noch kraftvoll zuschlagen. Aber er wird dich nicht treffen, weil du nämlich im allerletzten Moment aufwachen und unversehrt in die Wirklichkeit zurückkehren wirst. Das haben Albträume so an sich. Sie halten meines Wissens nie bis zur allerletzten Konsequenz durch. Selbst der realistischste Horrortraum kann der Person, die ihn träumt, nicht das Leben nehmen. Das geht einfach nicht. Ist doch klar. Weil's letztendlich nur ein Traum ist. Irreal. Von vorne bis hinten vom menschlichen Gehirn erfunden.«
Geneviève McGowan atmete erleichtert auf. »Mir geht es schon viel besser, Ben«, sagte sie mit weicher Stimme und schmiegte sich im Geist zärtlich an ihn. »Vielen Dank für das Gespräch.«
»Immer wieder gerne.«
»Du hättest Psychoanalytiker werden sollen.«
»Das hatte ich vor«, sagte Ben Zoolander.
»Ich weiß. Du hättest das Studium nicht abbrechen sollen.«
»Ich kann jederzeit weitermachen. Im Moment gibt es andere Prioritäten in meinem Leben.«
»Die da wären?«, fragte sie schmunzelnd.
»Du kennst sie doch.«
»Ich bin nicht sicher.«
Er atmete schwer aus. »Na schön. Du willst es hören. Also gut. Du sollst es hören: An erster Stelle, ganz, ganz weit oben, steht eine junge, wunderschöne Umweltaktivistin, in die ich mich kürzlich unsterblich verliebt habe ...«
Sie kicherte. »Den Rest kannst du dir sparen. Der interessiert mich eigentlich nur noch am Rande.«
†