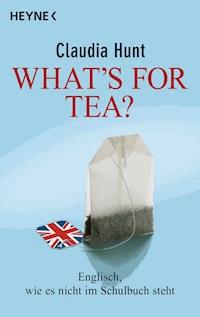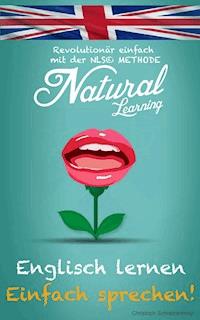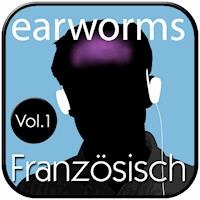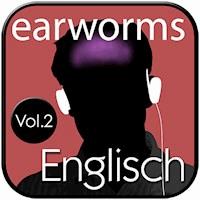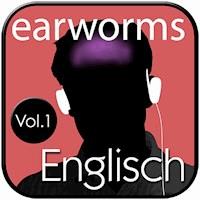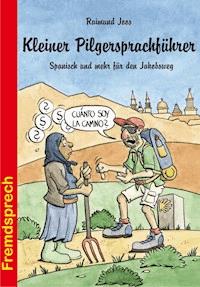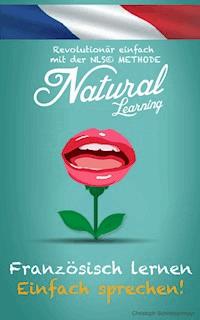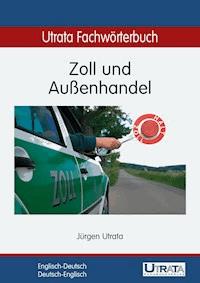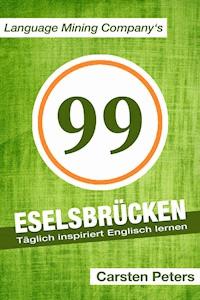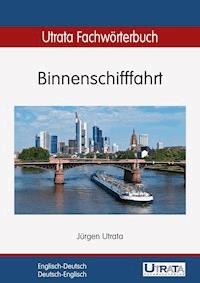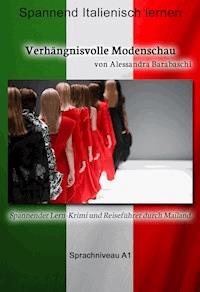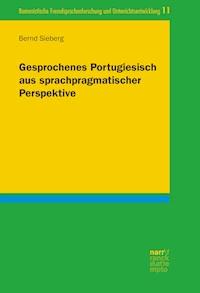
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Romanistische Fremdsprachenforschung und Unterrichtsentwicklung
- Sprache: Deutsch
Diese Einführung in die Grundprinzipien des gesprochenen Portugiesisch richtet sich an Dozenten, die im Bereich der kontrastiven Sprachforschung und Didaktik des Portugiesischen als Fremdsprache forschen und arbeiten. Auch Lehrer und Studenten gehören zur Zielgruppe dieses Buches. Sie sollten bereits über Grundkenntnisse des Portugiesischen (mindestens A 2) verfügen, um die zahlreichen Textbeispiele zu verstehen. Neben einem klaren methodischen Konzept, das aufzeigt, welche sprachlichen Mittel notwendig sind, um sich auf Portugiesisch unterhalten zu können, wird den Lesern zusätzlich ein umfangreiches Inventar von Redemitteln angeboten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Sieberg
Gesprochenes Portugiesisch aus sprachpragmatischer Perspektive
Romanistische Fremdsprachenforschung und Unterrichtsentwicklung 11
Herausgegeben von Daniel Reimann (Duisburg-Essen) und Andrea Rössler (Hannover)
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2018 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8233-0089-2
Inhalt
Danksagung
Zunächst einmal möchte ich dem ‚Conselho Científico‘ der ‚Faculdade de Letras‘ der ‚Universidade de Lisboa‘ danken, der mir das Sabbatjahr zugestanden hat, in dem ich mein Buch schreiben konnte. Dieser Dank schließt auch den damaligen Direktor unserer Abteilung, Herrn Professor Gerd Hammer ein, der sich in diesem Sinn für mich eingesetzt hatte.
Sehr wichtig für meine Arbeit war auch die Unterstützung des ‚Centro de Linguística da Universidade de Lisboa‘ (CLUL). Hier danke ich speziell Frau Professorin Amália Mendes, die mir den Zugang zum ‚C-ORAL-ROM-Korpus‘ ermöglicht hat und mir bei einigen Zweifeln mit ergänzenden Informationen zur Seite gestanden hat.
Ein weiteres „Dankeschön“ gilt Herrn Prof. Hardarik Blühdorn vom IDS Mannheim, ohne dessen Insiderwissen es mir nicht möglich gewesen wäre, das ‚Kapitel 2‘ „Zur Situation der Gesprochenen-Sprache-Forschung in Portugal und Brasilien“ in dieser Ausführlichkeit zu schreiben.
Mein ganz besonderer Dank aber gilt Herrn Conrad Schwarzrock. In einer ganz entscheidenden Phase meiner Arbeit, in der sich die Probleme dermaßen anhäuften, dass ich – auch aus gesundheitlichen Erwägungen – nahe daran war, von meinem Projekt Abstand zu nehmen, hat Herr Schwarzrock es verstanden, mir Mut zu machen und mir neue Motivation für die Weiterführung meiner Arbeit verliehen. Außerdem hat Herr Conrad Schwarzrock meine Texte gegengelesen und sie von sprachlichen Fehlern und stilistischen Unebenheiten befreit. Ohne seine Hilfe würde der Text in der Form, wie er jetzt vorliegt, nicht existieren.
Zum Schluss richtet sich mein Dank noch an Prof. José Pinto de Lima von der Germanistischen Abteilung der ‚Faculdade de Letras de Lisboa‘, der mir mit Ratschlägen und Korrekturen bei der Ausarbeitung des Glossars behilflich war.
Agradecimentos
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Conselho Científico da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa por me ter concedido a licença sabática anual, que me permitiu escrever o meu livro. Agradeço também ao Prof. Doutor Gerd Hammer, Diretor do nosso Departamento de Estudos Germanísticos, pelo seu apoio institucional.
Agradeço ainda o apoio do ‚Centro de Linguística da Universidade de Lisboa‘ (CLUL), que foi decisivo para a realização do meu trabalho. Agradeço em especial à Prof.ª Doutora Amália Mendes, que possibilitou o acesso ao Corpus ‚C-ORAL-ROM‘ e me ajudou com as suas informações.
Agradeço ainda ao Prof. Doutor Hardarik Blühdorn do IDS de Mannheim; sem o seu contributo de especialista não me teria sido possível escrever com tanto detalhe o ‚capítulo 2‘ „Sobre a situação do estudo da língua falada em Portugal e no Brasil“.
Ao Dr. Conrad Schwarzrock cabe um agradecimento muito especial. Numa fase decisiva do meu trabalho, em que os problemas se acumularam de tal forma que, também por razões de saúde, estive perto de abandonar o meu projeto, o Dr. Schwarzrock soube dar-me coragem e uma nova motivação para continuar o meu trabalho. Além disso, o Dr. Schwarzrock reviu os meus textos, eliminando falhas na grafia e no estilo. Sem a sua ajuda, o texto não teria a forma final, que agora apresenta.
Agradeço ainda ao Prof. Doutor José Pinto de Lima do Departamento de Estudos Germanísticos da ‚Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que me ajudou na elaboração e revisão do ‚glossário‘.
Vorworte von Herausgeber und Autor
War die linguistische Pragmatik für die „kommunikative Methode“ des Fremdsprachenunterrichts der 1970er Jahre eine zentrale Bezugsdisziplin, so verlor sie in den folgenden Jahrzehnten nicht nur innerhalb der linguistischen Forschung, sondern auch in der Fremdsprachenforschung zunächst an Bedeutung. Trotz grundlegender Beibehaltung des kommunikativen Grundanliegens, das freilich nicht mit letzter Konsequenz verfolgt wurde, wurden andere Handlungs- und Forschungsfelder wie Lernerorientierung und Interkulturalität zentral für die Theoriebildung und Erforschung fremdsprachlicher Lehr-/Lernprozesse der 1980er und 1990er Jahre.
Erst in den vergangenen fünfzehn Jahren wurde der Fremdsprachenunterricht, man mag ihn in einem Versuch der Historisierung als neokommunikativ bezeichnen, in der Folge der Veröffentlichung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, unter den Vorzeichen von Bildungsstandards und „Mündlichkeit“ wieder gezielt und beinahe vorrangig an den funktionalen kommunikativen Kompetenzen ausgerichtet. Der linguistischen Pragmatik kommt daher als wesentlicher Bezugsdisziplin der Fremdsprachendidaktik seit etwa der Jahrtausendwende in zunehmendem Maße wieder an neuerlicher Bedeutung zu. Dieser Bedarf wird indes derzeit weder von der Linguistik in ausreichendem Maße bedient noch von der Fremdsprachenforschung in dem eigentlich wünschenswerten Maße nachgefragt.
Die portugiesische Sprache scheint ihrerseits in den deutschsprachigen Bildungssystemen eine vollkommen vernachlässigte Größe zu sein: Portugiesisch spielt an den Schulen nur eine marginale Rolle – die Zahl der Schulen, an denen Portugiesisch als Fremdsprache als Leistungskurs belegt werden kann, beläuft sich in der gesamten Bundesrepublik Deutschland auf unter zehn. An den Universitäten gestaltet sich die Situation nicht merklich besser, hier wurde das Ausbildungsangebot seit den 1990er Jahren, als es nicht zuletzt in der Folge des EU-Beitritts Portugals zunächst eine Ausweitung erfahren hatte, tendenziell eher reduziert. Unabhängig von der kulturellen Bedeutung Portugals für Europa, Brasiliens, Angolas und weiterer lusophoner Regionen müssten gerade auch heute so häufig angeführte ökonomische Argumente eigentlich eine stärkere Berücksichtigung des Portugiesischen im deutsch(sprachig)en Bildungswesen anregen: zwar ist das Spanische als Weltsprache unumstritten, das Französische scheint als bevorzugte Partnersprache innerhalb Europas gerade angesichts der Krise(n) Europas unbedingt auch politisch wieder zu stärken, und das Italienische als Landessprache eines der bedeutendsten Wirtschaftspartners Deutschlands (wiederum ungeachtet der essentiellen kulturellen Bedeutung Italiens für Europa) verdient ebenfalls mehr Beachtung als es derzeit erhält. Dennoch: Portugiesisch ist mit Abstand die am zweit meisten gesprochene romanische Sprache – deutlich vor dem Französischen und Italienischen –, Brasilien ist beinahe hälftig am deutschen Außenhandelsvolumen mit Lateinamerika beteiligt, Angola ist eine schillernde, aber unübersehbare Größe innerhalb Afrikas. Bei allem Respekt für das Französische, Spanische und Italienische: Das Portugiesische sollte im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall mehr Augenmerk erfahren, mehr erlernt und beforscht werden, als dies im Moment der Fall ist.
Vor diesem Hintergrund ist es äußerst begrüßenswert, dass sich mit Bernd Sieberg ein seit über drei Jahrzehnten an der Universität Lissabon tätiger germanistischer Linguist der Aufgabe verschrieben hat, beide aufgezeigte Desiderata miteinander zu verbinden: das vorliegende Werk stellt letztlich den Entwurf einer linguistischen Pragmatik am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Portugiesisch mit einer Perspektivierung auch auf die Sprachvermittlung dar. Es bereichert die Pragmatik des Portugiesischen und den Portugiesischunterricht um ein beeindruckendes Kompendium.
Dass Bernd Sieberg sein Werk der Reihe Romanistische Fremdsprachenforschung und Unterrichtsentwicklung zur Verfügung gestellt hat, freut mich sehr. Ich wünsche dem Band die breite Rezeption innerhalb der linguistischen Pragmatik, der Lusitanistik und der Fremdsprachenforschung, die er verdient!
Essen, im Januar 2018 Daniel Reimann
Das Interesse an der gesprochenen Sprache und ihrer Erforschung begann zur Zeit meiner akademischen Ausbildung als Germanist mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaft, die ich in Deutschland an der Universität Bonn in den Jahren von 1973 bis 1983 erfahren habe. Dort nahm ich bereits in den späten 70er Jahren an einem Projekt zur Erforschung der gesprochenen deutschen Sprache teil1. Sowohl die schriftliche Arbeit zu meinem Ersten Staatsexamen von 1980 als auch meine Dissertation von 1983 hatten die gesprochene Sprache und den Gebrauch der Vergangenheitstempora ‚Perfekt und Imperfekt‘ zum Thema. Dann begann ich 1984 meine Arbeit als DAAD-Lektor an der Germanistischen Abteilung der ‚Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa‘ (FLUL). In diesen Jahren hat mich mein Interesse an der ‚Gesprochenen Sprache Forschung‘ (GSF) immer begleitet und mich auch in den fast zwei Jahrzehnten meiner Tätigkeit als Lektor – die ersten fünf Jahre als DAAD-Lektor – immer wieder zu kleineren Arbeiten in diesem Forschungsbereich veranlasst, obwohl ich in Lissabon meine Zeit und Energie überwiegend dem Unterricht der deutschen Sprache widmete.
Das Interesse an vergleichenden Arbeiten ‚Deutsch-Portugiesisch‘ erwachte erst relativ spät Anfang der 2000er Jahre, zu einer Zeit, als sich mit der Anerkennung meines deutschen Doktorexamens mein akademischer Status in Portugal änderte. Damit ergab sich auch die Möglichkeit, erneut mehr in meine Forschungstätigkeit zu investieren. Die Ausgangslage eines Dozenten zwischen zwei unterschiedlichen Sprachkulturen und Wissenschaftstraditionen führten dann auch wie selbstverständlich zu einer Reihe von Studien im kontrastiven Bereich ‚Deutsch-Portugiesisch‘2. Meiner persönlichen Überzeugung zufolge handelt es sich bei diesem Schritt in Richtung vergleichende Sprachforschungen nahezu um eine Pflicht für Akademiker, die das Privileg genießen, parallel an zwei verschiedenen Sprach- und Wissenskulturen teilhaben zu dürfen.
In derselben Phase meiner beruflichen Laufbahn ergab es sich durch persönliche und eher zufällige Kontakte, dass ich das Modell des Nähe- und Distanzsprechens von Ágel / Hennig kennenlernte, das sich wiederum an dem der Romanisten Koch / Oesterreicher ausrichtet und sich m.E. aktuell als herausragendes ‚Werkzeug‘ zur systematischen Beschreibung gesprochener Sprache gerade und besonders auch für kontrastive Studien erweist3. Dieses Modell und seine Vorstellungen sollten von diesem Zeitpunkt an einen Großteil meiner weiteren Arbeit im Bereich der Sprachwissenschaft und auch im Bereich kontrastiver Studien orientieren. Auch für die vorliegende Arbeit bildet es die methodisch-konzeptuelle Basis.
Bei der Beschäftigung mit der GSF des Portugiesischen wurde relativ schnell deutlich, dass es unterschiedliche geopolitische Ausgangssituationen und Forschungstraditionen sind, die einen entscheidenden Einfluss auf die GSF ausüben. Die Bundesrepublik der 70er Jahre war auch im akademischen Bereich wesentlich geprägt durch die Nachwehen der Aufbruchsstimmung der 68er Generation und die sozialliberale Koalition zwischen SPD und FDP der frühen 70er Jahre, die sich an Ideen wie ‚Mitbestimmung‘, ‚Bildungsreform‘ und ‚sozialer Gerechtigkeit‘ ausrichtete. Die Auswirkungen einer entsprechenden Bildungs- und Hochschulpolitik sowie die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel rückten auch in der Germanistik und Linguistik – von nun an gebrauchte man statt des antiquierten Begriffs der ‚Sprachwissenschaft‘ bevorzugt den der ‚Linguistik‘ – neue Forschungsschwerpunkte und Projekte in den Vordergrund von Lehre und Forschung, zu denen neben der Soziolinguistik auch die Dialektologie sowie die gesprochene Sprache gehörten. Darum kann es nicht verwundern, dass die GSF in den folgenden 80er Jahren und bis heute enorme Fortschritte gemacht hat und sozusagen als ein Aushängeschild germanistischer Forschungen angesehen werden darf. Mit dem ‚Institut für Deutsche Sprache‘ (IDS) in Mannheim und seinen in den letzten Jahren aufgebauten Korpora zur gesprochenen Sprache4 besteht zudem eine ideale Ausgangsposition für Korpus basierte Forschungen auf dem Gebiet der germanistischen GSF.
Bedingt durch die unterschiedlichen politischen und soziogeographischen Rahmenbedingungen – die portugiesische Nelkenrevolution von 1974 lag erst gerade einmal zehn Jahre zurück – befand sich die Erforschung des gesprochenen Portugiesisch Mitte der 80er Jahre in einer gänzlich anderen Situation, die sich kurz folgendermaßen beschreiben lässt. Linguistische Ansätze zur Soziolinguistik, die mittel- oder unmittelbar auch die gesprochenen Sprache (GS) in den Aufmerksamkeitsfokus gerückt hätten, waren in Teilen der älteren aber immer noch einflussreichen Generation portugiesischer Philologen auch noch Jahre nach der Revolution verpönt, wie eine Formulierung von Scott-Rosin (1984, 259) verdeutlicht:
Zudem verstellte lange Zeit die Vorstellung von einer diastratisch relativ homogenen portugiesischen Sprache, die vor 1974 aus ideologischen Gründen gefördert wurde, den Blick auf die tatsächlichen sprachlichen Varianten und verhinderte damit die notwendige Diskussion um die Sprachnorm.
Einer Öffnung für eine Beschäftigung mit dem aktuellen mündlichen Sprachgebrauch schien auch das Selbstverständnis vieler portugiesischer Philologen skeptisch gegenüberzustehen, wie bereits Boléo 1954 beklagte (Boléo 1974, 269): „O estudo da linguagem viva, actual, tem sido impedido, nalguns países, designadamente Portugal, por um lamentável preconceito: o de que o filólogo se deve debruçar principalmente sobre assuntos antigos“.
Trotzdem begann 1970 relativ früh die Arbeit an einem ersten Korpus des gesprochenen Portugiesisch, deren Ergebnisse vom ‚Centro de Linguística da Universidade de Lisboa‘ (CLUL) unter dem Titel ‚Português Fundamental. Métodos e Documentos‘ 1987 publiziert wurden. Die Erstellung weiterer Korpora und Studien auch zur gesprochenen Sprache folgten in Portugal aber besonders auch in Brasilien (siehe auch Kapitel 2). Dass es trotzdem immer noch an Erkenntnissen zum gesprochenen Portugiesisch mangelt und bestimmte Aspekte dieses Forschungsbereichs unberücksichtigt blieben bzw. unter einem methodisch-konzeptionellen Ansatz erfolgen, der wenig zur ihrer Erhellung beiträgt, hat m.E. verschiedene Gründe. Zu ihnen zählen, dass die entsprechenden Korpora vorrangig Studien zur Phonetik und Geolexikologie dienen. Dieser von der portugiesischen Forschung eingeschlagene Weg wird allerdings vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung und geographischen Situation Portugals mit seiner Vielzahl von diatropischen Varianten außerhalb des Kontinentalportugiesischen durchaus verständlich.
Den Hauptgrund für das Desiderat aber sehe ich in der Vergangenheit einer Forschungstradition, die sich in den letzten Jahrzenten recht einseitig formal-strukturalistischen Konzepten der Sprachbeschreibung – unter den gegebenen politischen Umständen jener Zeit aus Gründen ihrer ideologischen Unverfänglichkeit vielleicht auch verständlich5 – verschrieben hatte, die in angloamerikanischen Vorbildern ihre historischen Wurzeln haben, wobei ein Blick in die bis dato herausgegebenen Referenzgrammatiken zur portugiesischen Sprache 6 genügt, um diesen Eindruck zu bestätigen. Andere Perspektiven auf ‚Sprache‘ hingegen werden vernachlässigt. Dazu gehört die mit der Pragmatik verbundene Sicht, die eine Einbindung von Sprechen in reale Situationen und die hieraus erwachsenen sprachlichen Beschränkungen und Möglichkeiten zum Ziel ihrer Untersuchungen machen würde. Genauso bleibt die Beschreibung derjenigen sprachlichen Mittel weitgehend unbeachtet, die der Herstellung und der Regelung von sozialen Beziehungen zwischen den Gesprächspartnern und ihren Interessen dienen, bzw. sie findet keinen Einlass in die entsprechenden Grammatiken.
Trotz dieser Umstande bin ich mir der Außergewöhnlichkeit und vielleicht auch des Risikos bewusst, ein methodisches Konzept samt seiner Grundbegriffe und Terminologie, das seinen Ursprung in der germanistischen Sprachwissenschaft hat und bisher vornehmlich auf die Erscheinungen der deutschen Sprache angewandt wurde, auf das Portugiesische zu übertragen. Die oben beschriebenen Desiderate, die Universalität des von mir benutzten Erklärungsmodells sowie die Überzeugung, dass Forschungstätigkeit eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin sehen sollte, die Grenzen zwischen unterschiedlichen Ländern, Sprachen und Wissenschaftstraditionen zu überwinden, verleihen mir jedoch die Überzeugung richtig zu handeln. Hinzu kommt, dass ich meine Arbeit in erster Linie als Vorschlag verstehe, die bereits gewonnenen Erkenntnisse, die inzwischen durch portugiesisch-brasilianische Forschungen zur gesprochenen Sprache zusammengekommen sind, auf der Basis eines zusätzlichen Konzepts systematisch zu ordnen und ihnen eine zusätzliche Ausgangsposition für zukünftige Arbeit zur Seite zu stellen. Damit verbinde ich die Hoffnung, dass es auf diesem Weg gelingen könnte, gesprochenem Portugiesisch zukünftig die Einschätzung und den Stellenwert zukommen zu lassen, die dieser Variante verbaler Verständigung wirklich angemessen ist.
Interessierte portugiesische Leser werden sich zudem, falls sie nicht über genügend Deutschkenntnisse für eine entsprechende Lektüre dieses Buches verfügen, mit Fug und Recht die Frage stellen, warum ich dieses Buch nicht auf Portugiesisch geschrieben habe und somit einem weitaus größeren Leserkreis zugänglich hätte machen können. Tatsächlich war dieses auch mein ursprüngliches Ziel. Ein portugiesischer Text wäre tatsächlich sinnvoller gewesen: Dieses Vorgehen kann ich nur so rechtfertigen, dass ich auch bereits viel Aufwand und Energie in eine portugiesische Version meiner Arbeit gesteckt hatte. Diese Arbeit war gekennzeichnet durch zeitraubendes und teilweise problematisches Übersetzen von zahlreichen Vorstellungen, Begriffen und Termini, die ihren Ursprung in der germanistischen GSF haben. Die ersten Kapitel hatte ich trotzdem bereits auf Portugiesisch geschrieben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem meine zweisprachige Assistentin und potentielle Mitautorin aus dem Projekt ausstieg. Angesichts der bereits vorangeschrittenen Zeit – ich musste mein Sabbatjahr zur Arbeit am Buch nutzen und hatte im Bemühen um eine portugiesische Version meines Buches bereits viel Zeit verloren und Energie eingebüßt – blieb mir keine andere Wahl, als im Widerspruch zu meinem ursprünglichen Plan das Buch auf Deutsch weiterzuschreiben7.
Natürlich schränkt ein Buch, das auf Deutsch sprachliche Erscheinungen des Portugiesischen beschreibt, den potentiellen Leserkreis erheblich ein. Als mögliche Nutznießer für ein Buch, das auf Deutsch (Metasprache) sprachliche Ausdrücke und Strukturen des Portugiesischen (Objektsprache) analysiert, verbleiben aber immerhin noch Lehrende und Lernende aus dem Bereich der Romanistik und komparatistischen Linguistik an deutschen, portugiesischen, brasilianischen sowie anderen ausländischen Universitäten. Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass diese potentiellen Leser über hinreichende Sprachkompetenz in beiden Sprachen verfügen.
Zum Schluss dieses Vorwortes sei mir noch folgende kritische Bemerkung erlaubt, die im Zusammenhang mit dem in diesem Beitrag angestrebten Ziel einer Wissensvermittlung zwischen unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen steht. Es ist unbestritten, dass inzwischen Englisch als ‚Lingua Franca‘ bei internationalen Konferenzen und anderen Formen wissenschaftlicher Zusammenkünfte die Rolle zukommt, als ‚Vehikel‘ das Verständnis zwischen Teilnehmern unterschiedlicher Länder und Sprachen zu ermöglichen. Diese Leistung betrachte ich allerdings mit einem gewissen Vorbehalt. Wenn man von einem Begriff des ‚Verstehens‘ ausgeht, wie es Diltheys8 für den Begriff der Geisteswissenschaften definiert, setzt ein solches Verstehen voraus, dass dieser Wissenstransfer von Wissenschaftlern – im hier vorliegendem Fall sind speziell Sprachwissenschaftler gemeint – vorgenommen wird, die ihre Erkenntnisse auf der Grundlage von Begriffen vermitteln, die sich bei ihnen selber als Ergebnis ihres sinnlichen Nacherlebens und kognitiven Nachvollziehens der zu thematisierenden sprachlichen Phänomene herausgebildet haben. Diese Voraussetzung gilt für den Bereich beider Sprachen und Wissenschaftstraditionen, zwischen denen ein solcher Transfer vorgenommen werden soll. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn ein Linguist, der wie ich in der germanistischen GSF ‚groß geworden ist‘ sich das Ziel setzt, den Begriff ‚Überbrückungsphänomene‘ mittels des Begriffs ‚hesitações‘ ins Portugiesische zu übersetzen, sollte er in der Lage sein, diesen Begriff in beiden Sprachen und Wissenschaftstraditionen sowohl ‚kognitiv‘ als auch ‚sinnlich‘ nachzuvollziehen. Nur so kann es ihm gelingen, wirklich passende Begriffe einander zuzuordnen. Dazu gehört die Kenntnis der theoretischen Kontexte (Sekundärliteratur), in denen diese Begriffe jeweils gebraucht werden. Bedingung für ein solches ‚Verstehen‘ im Sinne Diltheys ist es aber auch ‚nachzuempfinden‘ zu können, welche Assoziationen Begriffe und Termini der Sprachwissenschaft auslösen, wenn sie von deutschen bzw. portugiesischen Muttersprachlern gebraucht werden. Der oberflächliche Wissenstransfers durch einen dritten vermittelnden Begriff wie den des englischen ,hedges words‘ stellt m.E. dabei nur eine Ausflucht und Scheinlösung dar. Er garantiert keineswegs, dass portugiesische Sprecher wirklich verstehen, was nun mit dem deutschen Begriff ‚Zögerungssignal‘ gemeint ist, wenn sie ihn über den Umweg des Begriffs ‚hedges words‘ kennenlernen. Auch aus dieser Perspektive gewinnt die vorliegende Arbeit an Bedeutung und rechtfertigt die viele Mühe und Zeit, die ich in sie investiert habe.
1.Einleitung
Sprache und Schrift sind zwei verschiedene Systeme von Zeichen; das letztere besteht nur zu dem Zweck, um das erstere darzustellen. Nicht die Verknüpfung von geschriebenem und gesprochenem Worte ist Gegenstand der Sprachwissenschaft, sondern nur das letztere, das gesprochene Wort allein ist ihr Objekt.
(De Saussure [1916] 1967, 28)
Das Sprechen ist nicht von der Sprache her zu erklären, sondern umgekehrt die Sprache nur vom Sprechen. Das deswegen, weil Sprache konkret nur Sprechen, Tätigkeit ist und weil das Sprechen weiter als die Sprache reicht. Denn während die Sprache ganz im Sprechen steckt, geht das Sprechen nicht ganz in der Sprache auf.
(Coseriu [1975] 2007, 58)
Ziel dieser Untersuchung ist es, sprachliche Merkmale der mündlichen portugiesischen Kommunikation aus sprachpragmatischer Perspektive1 zu beschreiben. Die onomasiologische Vorgehensweise – von Funktionen zu sprachlichen Merkmalen zur Wahrung dieser Funktionen – nimmt dabei ihren Ausgang von Aufgaben, die sich daraus ergeben, dass Sprechen in konkreten Situationen und in Anwesenheit von Gesprächsteilnehmern und ihren Interessen erfolgt. Aus diesen Umständen erwachsen Beschränkungen und Möglichkeiten, die wesentlich die Art und Weise prägen, wie die beteiligten Personen unter diesen Bedingungen vom verbalen Code Gebrauch machen. Die weitere detaillierte Bestimmung und Gliederung entsprechender sprachlicher Ausdrücke und Strukturen im Zusammenhang mit den Faktoren ‚Situation‘ und ‚Anwesenheit von Gesprächspartnern‘ erfolgt dabei im Rahmen des Modells des Nähe- und Distanzsprechens (Ágel / Hennig 2006a, 2006b, 2007), seines Axioms, seiner universalen Diskursverfahren, seiner Begriffe und seiner Terminologie. Die entsprechenden Grundannahmen, die dieses Konzept prägen, werden in ‚Kapitel 4‘ vorgestellt. Zusammen mit Erkenntnissen der „Interaktionalen Linguistik“, der zufolge es beim dialogischen Sprechen immer auch darum geht, „intersubjektiv Bedeutung herzustellen und soziale Beziehungen zu gestalten“ (Imo 2015, 3), werden in den Kapiteln dieses Buches charakteristische Erscheinungen des mündlichen Portugiesisch – der Begriff ‚mündlich‘ wird im Folgenden durch den umfassenderen Begriff ‚nähesprachlich‘ (siehe ‚Kapitel 4‘) ersetzt – erläutert und in einem systematisch und hierarchisch geordneten Zusammenhang erklärt.
Untersuchungen zum gesprochenen Portugiesisch findet man in den letzten Jahren immer häufiger (siehe auch ‚Kapitel 2‘). Dazu zählen insbesondere Studien, die phonetische oder lexikalisch-geographische Aspekte2 der ‚Gesprochenen-Sprache-Forschung‘ thematisieren. Pragmatische Gesichtspunkte werden hingegen relativ selten erörtert, und wenn, fehlt es den entsprechenden Beiträgen meiner Einschätzung nach oft an einer durchdachten konzeptionellen Grundlage. Entsprechend zusammenhangslos werden die entsprechenden Erkenntnisse präsentiert, was wiederum zur Folge hat, dass sie nicht angemessen wahrgenommen werden und infolgedessen in den Referenzgrammatiken3 – zumindest zum Kontinentalportugiesisch – bis jetzt keine angemessene Beachtung gefunden haben.
Zur Vermeidung bestimmter Vorurteile, die sich leider nur allzu schnell mit dem Begriff der gesprochenen Sprache verbinden: Es geht in diesem Buch weder um Dialekte, Soziolekte oder Gruppensprachen – wie z.B. der Jugendsprache –, sondern um Formen und Ausdrucksweisen, die allgemein und variantenübergreifend erforderlich sind, um mündliches oder schriftlich basiertes Nähesprechen überhaupt erst zu ermöglichen.
Die einleitenden Zitate von zwei der renommiertesten Sprachwissenschaftler des 20. Jahrhunderts heben die besondere genealogische und methodologische Vorrangigkeit gesprochener Sprache im Vergleich zum schriftlichen Ausdruck hervor und bieten somit einen geeigneten Ausgangspunkt für das Thema des Buches. Nun wird sich der Leser vielleicht zweifelnd fragen, ob es denn nicht im Gegenteil der schriftliche Ausdruck und die auf seiner Basis entstandenen Werke der Literatur und Wissenschaft sind, die Kultur und den Stolz einer Sprachgemeinschaft prägen und die kulturelle Identifikation von Individuen ermöglichen?4 Dieser Meinung kann man nur zustimmen, und auch an dieser Stelle soll die überragende kulturelle Bedeutung des geschriebenen Wortes nicht geleugnet werden. Der schriftliche Ausdruck bildet einen ausschlaggebenden Faktor bei der Entwicklung hochzivilisierter Sprachgemeinschaften, an der literarische und wissenschaftliche Werke ihren wesentlichen Anteil haben. Diese Herausstellung des Primats der Schriftlichkeit trifft auch für den Bereich der Sprachwissenschaft zu. Ohne die Möglichkeit schriftlicher Dokumentation wäre die Möglichkeit einer systematischen Erforschung der gesprochenen Sprache, ihrer Weiterentwicklung, Verbreitung und Überlieferung in Form von Grammatiken, Wörterbüchern und Beiträgen zur Fachliteratur ausgeschlossen. Folgende Zitate der Linguisten Coulmas und Ágel verdeutlichen diese Überzeugung:
Schrift fixiert Sprache nicht nur im visuellen Sinn, sondern auch, indem sie sie stabilisiert. Mit anderen Worten, Schrift ist das Mittel der Sprachstandardisierungen (Coulmas 1985, 98).
Die Ablösung der oralen und die Herausbildung der literalen Kultur bedeuten, dass der Mensch nunmehr nicht nur Sprechhandlungen vollzieht, sondern auch Sprachwerke schafft [Heraushebung durch den Autor des Zitats], und dass diese Sprachwerke über grammatische (und sonstige sprachliche) Merkmale verfügen, über die Sprechhandlungen nicht verfügen (und umgekehrt). (Ágel 1999, 211)
Diese von allen Sprachgemeinschaften geteilte Hochachtung der Schrift führte dann allerdings in der Folgezeit zu einem wachsenden Verlust der Wertschätzung der gesprochenen Sprache. Diese ist durch eine fast vollkommende Vernachlässigung bzw. durch eine Form wissenschaftlicher Thematisierung gekennzeichnet, die auf verzerrenden und fehlerhaften theoretischen Voraussetzungen beruht. Zu diesen zählen (a) eine Beschreibung von Merkmalen der gesprochenen Sprache im latenten, wenn auch oft unbewussten Vergleich mit der Grammatik der geschriebenen Standardsprache, die sozusagen den geltenden Maßstab für alle Formen sprachlicher Verständigung darstellt, (b) eine einseitige Fokussierung auf ihre lautliche Realisierung, (c) die Ausklammerung der Eigenständigkeit von Regularitäten des Sprachgebrauchs5 auf der Ebene der Morphosyntax sowie (d) die Nichtbeachtung bzw. Unterbewertung von sprachlichen Ausdrücken und Strukturen, deren Bedeutung für das Funktionieren mündlicher Kommunikation sich aus sprachpragmatischer Perspektive eröffnet.
Obwohl sich auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Hinweise in der portugiesischen Sekundärliteratur finden, die den oben genannten Tendenzen widersprechen und dem lebendigen, gesprochenen Wort ihre Aufmerksamkeit zuwenden6, überwog lange Zeit die Rückwendung auf die Vergangenheit und eine Dominanz präskriptiver Formen der Sprachbeschreibung7. Zusammen mit der einseitigen Wertschätzung der Schriftkultur ergab sich daraus eine Haltung, die in der angelsächsischen und germanistischen Wissenschaftsliteratur als „Skriptizismus“8 bezeichnet wird. Aus der Sicht der brasilianischen Linguistin Quadros Leite stammt dieses Vorurteil, das in der Annahme einer minderwertigen Mündlichkeit gegenüber dem überlegenen schriftlichen Ausdruck ausgeht, aus der Epoche der Renaissance, als sich eine Grammatikalisierung der Sprachen vollzog: „A partir desde momento a língua é entendida como uma entidade monolítica, cuja única forma é aquela descrita nos manuais de gramática tradicional e nos dicionários; as divergências são erros crassos“ (Quadros Leite 2000, 135). Auf ironische Weise äußert sich der germanistische Sprachwissenschaftler Ludger Hoffmann (1998, 3) darüber, wie sich die Haltung des ‚Skriptizismus‘ in den Köpfen und dem Denken seiner Verfechter widerspiegelt:
Kein Wunder, dass Lehrstuhl-Grammatiker die Mündlichkeit für chaotisch und irregulär halten und als bloße ‚Performanz‘ aus dem Gegenstandsbereich verbannen. Sie befassen sich lieber mit dem in den Köpfen ‚internalisierten‘ Sprachsystem, d.h. mit dem, was sie selbst über Grammatik wissen.
Bei allem Verständnis für diese Kritik scheint es allerdings nicht angebracht, beide Anwendungsvarianten verbaler Verständigung gegeneinander auszuspielen. Angemessener lässt sich das Verhältnis zwischen Sprechen und Schrift als eins der gegenseitigen Abhängigkeit und Beeinflussung bestimmen, das wie der deutsche Sprachwissenschaftler Wolfgang Raible (1994, 2) anmerkt, das Merkmal einer dialektischen Beziehung aufweist: „There´s no slave or servant without a master, no leisure time without work, no nature without culture; in the same way literacy cannot be conceived of without orality, and orality not without literacy“.
Doch war es nicht ausschließlich die Haltung des ‚Skriptizismus‘ – und diese Aussage gilt sowohl für die brasilianisch-portugiesische als auch die germanistische Gesprochene-Sprache-Forschung –, die lange Zeit eine angemessene wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der gesprochenen Sprache verhinderte oder zumindest verzögerte. So fehlten bis zur Mitte der 60er Jahre die technischen Voraussetzungen (tragbare Tonbandgeräte), die es ermöglicht hätten, gesprochene Sprache in spontanen Kommunikationssituationen aufzunehmen und für weitere Analysen zu archivieren. Mindestens genauso schwer wiegt aber das methodologische Dilemma, das der Erforschung gesprochener Sprache unausweichlich anhaftet. So ist man zur Erfassung des flüchtigen gesprochenen Wortes zunächst einmal auf die Schrift in Formen von Transkriptionen angewiesen, um den zu untersuchenden Gegenstand überhaupt festhalten, beschreiben und erzielte Erkenntnisse weiterverbreiten zu können. Darüber hinaus stellt jedes Transskript einen Kompromiss dar, weil es nicht in der Lage ist, alle Faktoren angemessen zu beschreiben, die bei einem gesprochenen Alltagsdialog von Bedeutung sind9. Dazu zählt die Gesamtheit der von den Sprechteilnehmern hervorgebrachten Lautsequenzen, zu denen auch solche gehören, die nicht Teil des eigentlichen verbalen Codes sind. Hinzu kommen die ständig wechselnde Mimik, die Gestik und die Gebärden der Gesprächsteilnehmer sowie alle nichtsprachlichen Handlungen, die den verbalen Teil der Kommunikation begleiten. Auch die räumliche Distanz, die Gesprächsteilnehmer zwischen sich einnehmen (Proxemik), und die Prosodie (Dynamik, Wort- und Satzakzente, Rhythmus, Satzmelodie, Stimmfärbung, Länge der Aussprache von Lauten und Pausen) tragen mit zur Informationsübermittlung in einem Alltagsdialog bei.
Um das Ziel der vorliegenden Studie anschaulicher und verständlicher zu machen und um bereits im Vorfeld der späteren, ins Detail gehenden Erläuterungen das Interesse und die Neugier der Leser zu wecken, möchte ich einleitend zwei kurze Textausschnitte vorstellen. Der erste Text von José Saramago, bei dem es sich um einen Ausschnitt aus den „Folhas Políticas“ (Saramago 1999, 178)10 handelt, steht dabei stellvertretend für einen prototypischen Text der ‚Distanzsprache‘11. Der zweite Ausschnitt hingegen, der einen prototypischen Text der ‚Nähesprache‘ repräsentiert, stammt aus dem ‚C-ORAL-ROM-Korpus‘ des ‚Centro Linguístico da Universidade de Lisboa‘ (=CLUL)‘12.
‚Text 1‘ – Beispiel für einen prototypischen Text des ‚Distanzsprechens‘.
Poucas vezes como neste caso terei sentido tão fortemente a necessidade de me manter num certo ângulo de observação que me é peculiar, o duma aguda e quase obsessiva consciência da absoluta relatividade de todas as coisas – com perdão da incompatibilidade lógica entre relativo e absoluto, que, sendo indesculpável em qualquer texto que se apresentasse com alguma pretensão científica, espera desta vez uma absolvição completa, por ser, obviamente, nesta circunstância, um abuso mais da liberdade de expressão. Literária, claro está. Propor, ou discernir, ou inventariar uma visão (Invenção) europeia da América, sempre terá de tomar em conta os fatores de tempo e de lugar, sob pena de nos vermos precipitados pela imperiosa realidade naquele profundo abismo em que costumam naufragar as inteligências desprevenidas, ingênuas ou otimistas – o tópico. Em primeiro lugar, se o passado considerarmos, desde que Colombo, em 1492, tocou terra americana, julgando ter chegado à índia, e que Álvares Cabral, em 1500, por casualidade ou de caso pensado, encontrou o Brasil – foram diversas mas nunca contraditórias, as imagens que a Europa recebeu de um mundo novo, em muitos aspectos incompreensível, mas, como a história veio a demonstrar, bastante dúctil e moldável, ora pela violência das armas ora pela persuasão religiosa, aos interesses materiais e ideológicos dos que, tendo começado por ser descobridores, imediatamente passaram a exploradores.
Bereits bei einer ersten und oberflächlichen Durchsicht des Textes von Saramago werden folgende Charakteristika deutlich: (a) Es handelt sich um einen aus 221 Wörtern und nur vier Sätzen bestehenden Text. Das einzige kurze Syntagma, das nur aus den drei Wörtern Literária, claro está besteht, ist kein eigenständiger Satz, sondern ein syntaktisch und logisch vom Vorsatz abhängiger ‚Zusatz‘ (Apposition). Nehmen wir ihn heraus, besteht der gesamte Ausschnitt nur aus drei Sätzen mit durchschnittlich 72,7 Wörtern. (b) Die drei verbliebenen Sätze bilden ein dichtes Geflecht ineinander verwobener syntaktischer Strukturen aus Hypotaxen und Parataxen. Besonders komplex sind die Satzgefüge mit mehreren Nebensätzen, die unterschiedliche Grade der Unterordnung aufweisen. Die syntaktischen und inhaltlich-logischen Relationen, die zwischen den verschiedenen Teilen des Gesamttextes bestehen, sind durch entsprechende Konnektoren bzw. Junktoren explizit gekennzeichnet. (c) Die im Text gebrauchten Lexeme wie dúctil oder moldável oder eine Sequenz wie com perdão da incompatibilidade lógica entre relativo e absoluto stehen für einen elaborierten und von Saramago mit Bedacht gewählten subtilen sprachlichen Duktus.
‚Text 2‘ – Beispiel für einen prototypischen Text des ‚Nähesprechens‘13. Charakteristische Merkmale, dieser Art und Weise vom verbalen Code Gebrauch zu machen sind durch Unterstreichung markiert.
A: o que é que acha da moda deste ano?
B: ah / eu acho / olhe / a moda deste ano acho engraçada // acho / porque é / é / tem muita coisa por onde se escolher // é calças curtas e / ah / e compridas / o / hot-pants e / e saias e / midis e maxis e tudo / de modo que / acho uma variedade muito / extraordinária / agrada a toda a gente // toda a gente tem por onde escolher // nós agora até / tivemos / dois dias / em passagens de modelos / a semana passada // com manequins profissionais e / e algumas / ah / raparigas curiosas / mas uma rapariga de lá da loja que se portou muitíssimo bem // e / e agora vou / voltar a ter lá uma passagem / no dia vinte e três // com seis manequins // e parece-me que vão também por alguns números de variedades / isso é que eu ainda não sei o que é que eles vão fazer // já ouvi falar numas bailarinas // eh / não sei que relação o possa ter uma coisa com a outra // mas / eh / de qualquer / eh / forma / e / e / e respondendo / aquilo que o senhor perguntou / acho que / a moda / está interessante / este ano // eu gosto //
A: gosta?
B: / acho que sim // não para mim mas / para as raparigas magras que têm / possibilidades de por tudo e tudo lhes fica bem // acho que sim // temos lá a Maria / a Ana Maria Lucas / que tem uma vontade / uma classe realmente extraordinária // além de bonita // bem / é muito antipática / para já // […]
Eine erste vorläufige Analyse dieses Textausschnitts, der zu einem großen Teil aus einer monologischen Sequenz von ‚Sprecher B‘ besteht, führt zu folgenden Einsichten: (a) Der Text weist 308 Wörter auf, wobei der in Fragmente, einzelne Wörter und Wortformeln ‚zerstückelte‘ Diskurverlauf (Häppchenstil) es im Gegensatz zum Distanztext problematisch gestaltet, die exakte Anzahl von Einheiten, die man als Sätze definieren könnte, festzustellen – ein Problem auf das ich an dieser Stelle nicht weiter einzugehen gedenke. Auf jeden Fall handelt es sich bei den Fragmenten, die diese Sprechsequenz des Nähesprechens bilden, um wesentlich kürzere Einheiten als die, aus denen sich typischerweise Distanztexte zusammensetzen. (b) Für eine nur indirekt erschließbare syntaktisch und logisch-semantische Kohäsionsstiftung zwischen den aufeinanderfolgenden Teilen der Sprechsequenz ist der folgende Ausschnitt charakteristisch acho uma variedade muito / extraordinária / agrada a toda a gente / toda a gente tem por onde escolher. Nähesprachliche Texte scheinen eine Organisation der zu übermittelnden Informationen in Form einer additiven Aneinanderreihung der Bestandteile dieser Information vorzuziehen. Es bleibt der Eindruck einer Fragmentierung der Teile einer Sprechsequenz, die sowohl ihre syntaktische als auch logisch-inhaltliche Ordnung betrifft. (c) Einzelne aus dem Zusammenhang der inhaltlichen Darstellung herausgerissene Ausdrücke wie olhe (2. Zeile ‚Sprecher B‘), bem, para já (letzte Zeile ‚Sprecher B‘) dienen weniger der inhaltlichen Information (dem propositionalen Anteil des Sprechakts) als vielmehr anderen Aufgaben wie der Regelung des Rederechts oder der Graduierung des illokutiven Gehaltes des entsprechenden Sprechaktes. Die Aufgaben, die sie als ‚Rederechtsmittel‘ oder besondere ‚Ausprägungen von Diskursmarkern‘ (Operatoren) erfüllen, werde ich weiter unten erläutern. (d) Die häufig vorkommenden und zunächst funktionslos erscheinenden Wiederholungen einzelner ‚Laute‘ – aus schriftsprachlich orientierter Sicht einzelner ‚Wörter‘ – wie é é / e e oder „tonaler Zeichen“ (Henne / Rehbock 1982, 80sq.), die in den Transkriptionen bevorzugt mittels der Grapheme ah und he wiedergegeben werden, lässt auf Probleme bei der zeitgerechten Ausführung der Sprechsequenz schließen, die unten im entsprechenden Kapitel 6.3.1 als ‚Überbrückungsphänomene‘ im Zeitparameter thematisiert werden. (e) Hinzu kommt der Gebrauch von Ausdrücken und Wortverbindungen wie e tudo, coisa oder de qualquer forma, die ein breites semantisches Spektrum abzudecken in der Lage sind und unter den ‚beengten‘ zeitlichen Bedingungen eines Präsenzdialogs den Gesprächspartnern als Ersatz passender und genauerer Bezeichnungen äußert gelegen kommen. Unten werden sie in ‚Kapitel 6.3‘ als „Passe-partout Wörter“ (Schwitalla 2012, 161) beschrieben. (f) Auch die Funktion von Strukturen wie isso é que, o que é que (frases clivadas) bieten sich für eine Interpretation aus pragmatischer Perspektive an, weil sie in der Lage sind, einen Teil des Informationsflusses hervorzuheben und in den Aufmerksamkeitsfokus des Gesprächspartners zu rücken. (g) Eine ähnliche Einschätzung erlaubt der Gebrauch von direkt nach dem ‚turn-taking‘ vom Gesprächspartner hervorgebrachten Wörtern oder formelhaften Wortverbindungen – ich werde sie in Kapitel 6.2.1 als ‚Reaktive‘ definieren und ihre Leistungen bestimmen –, wie acho que sim, nem pensar, ai é etc., die erst unter den besonderen situativen Bedingungen prototypischen Nähesprechens eine Interpretation erlauben, die ihren Funktionen gerecht wird. (h) Eine bereits seit der Antike als rhetorisches Mittel bekannte Stilfigur wie das ‚Apokoinu‘ lässt sich im Kontext des Nähesprechens dem entsprechenden Interpretationsparameter ‚Zeit‘ sowie dem universalen Diskursverfahren einer ‚aggregativen Strukturierung des Informationsflusses‘ (vgl. ‚Kapitel 4‘) zuordnen und erlaubt unter diesem Aspekt ebenfalls eine sinnvolle Interpretation. Die Strukturierung der Sprechsequenz eu acho / olhe / a moda deste ano acho engraçada, in der das konjugierte Verb acho dasselbe Satzglied a moda deste ano sozusagen ‚umarmt‘ und beidseitig und räumlich aufeinanderfolgend doppelt regiert, favorisiert ebenso eine Fragmentierung der Sprechsequenz und fördert den für das Nähesprechen vorteilhaften Häppchenstil‘. (i) Auch eine Technik, die darin besteht, dass Sprecher, die an einem Dialog beteiligt sind und ihre Aufmerksamkeit und ihr Verstehen durch ‚Wiederholung‘ von einzelnen Wörtern oder größere Teilen der Sprechsequenz des Gegenübers (adjazente Strukturen) zum Ausdruck bringen, gehört zum Repertoire von Dialogpartnern: Entsprechend wiederholt ‚Sprecher B‘ zu Beginn des Dialogs nach dem Sprecherwechsel den Ausdruck (d)a moda deste ano seines Gesprächspartners. Auch die von ‚Sprecher A‘ gestellte Frage gosta? wiederholt die direkt vorher von ‚Sprecher B‘ getroffene Aussage eu gosto. In Texten mit einer höheren Frequenz von Sprechwechseln wird dieses Mittel zur Verständigungsabsicherung durch Wiederholung von einzelnen Wörtern oder verbalen Strukturen entsprechend öfter eingesetzt und gewinnt dadurch an zusätzlicher Bedeutung.
Die Aufgabe in den nächsten Kapiteln wird nun darin bestehen, die oben nur kurz und vorläufig angedeuteten Charakteristika des prototypischen Nähesprechens, zu denen sowohl sprachliche Ausdrücke, aber auch spezifische Gestaltungen der Sprechsequenz gehören, in ihren formalen und funktionalen Details ausführlich zu beschreiben. Dazu bleibt festzuhalten, dass diese Merkmale, die Textexemplare aus dem Bereich der ‚kommunikativen Praktiken‘ des Nähesprechens prägen, keine Aufgaben für die eigentliche Informationsübermittlung (den propositionalen Anteil des Sprechaktes) übernehmen. Auch lassen sie sich nicht als Elemente der langue im Sinne einer formal-strukturalistischen Sprachbeschreibung bestimmen. Entsprechend entziehen sie sich Bestimmungen, die sich z.B. die Generative Transformationsgrammatik in der Nachfolge Chomskys oder die Varianten der Verbvalenzgrammatik für die Bestimmung sprachlicher Elemente zum Ziel setzen. Wenn man diese Perspektiven einnimmt, könnte man sogar provokativ anmerken, dass die vorliegende Studie ausschließlich die ‚Reste‘ thematisiert, die für formal-strukturalistische Sprachbeschreibungen keine Rolle spielen. Letztere lassen sie ausdrücklich unberücksichtigt, weil sie aus der Perspektive ihrer Zielsetzung keine Rolle spielen, wie aus dem folgenden Zitat Chomskys (Chomsky 1965, 3) deutlich wird:
Linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in a complete homogeneous speech-community, who knows its language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions, shifts of attention and interest, and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual performance.
Eine angemessene und ihrer Bedeutung entsprechende Beschreibung der Ausdrücke und Strukturen, die oben in ‚Text 2‘ skizzenhaft vorgestellt wurden, wird aber unter der Perspektive der Sprachpragmatik14 zwingend notwendig. In ihrer umfassenden Bedeutung schließt diese pragmatische Sichtweise Funktionen mit ein, die Aspekte der situativen (räumlich/zeitlichen) Einbindung, des diskursiven Verlaufs, der inner- und außersprachlichen Kontexte – einschließlich der sich aus ihnen ableitbaren Präsuppositionen – sowie der sozialen Interaktion des sprechsprachlichen Handelns betreffen.15 Sprachliche Kommunikation findet aus dieser Sicht nicht zwischen idealen Sprechern im Vakuum eines abstrakten Raums und zeitlicher Ungebundenheit statt. Stattdessen spielt sie sich zwischen real existierenden Gesprächspartnern mit ihren aufeinander stoßenden und möglicherweise auch unterschiedlichen Interessen, Gefühlslagen, allgemeinem Welt- und spezifischem Vorwissen, Sympathien etc. ab. Zudem ist sie in konkrete Situationen eingebunden und raumzeitlichen Bedingungen ausgeliefert, die Auswirkung auf die sprachlichen Ausdrücke und Strukturen nehmen, die Sprecher unter diesen Bedingungen benutzen, bzw. deren Gebrauch Sprecher diesen Bedingungen anpassen. Um ein Beispiel zu geben: Wer in Portugal einen Kaffee mit einigen Tropfen kalter Milch möchte, wird in der entsprechenden Situation, vielleicht an der Theke einer pastelaria gelehnt, einen café, pingado se faz favor!16 bestellen. Die Möglichkeit, seinen Wunsch in dieser elliptischen Form vorzutragen und die spezifische Bedeutung von ‚mit einigen Tropfen kalter Milch‘ des Zusatzes pingada ergibt sich als Folge einer zur Konvention gewordenen Formulierung, die sich genau für diesen Bezeichnungszweck und diese Situation bei kompetenten portugiesischen Sprechern in (vielleicht) Jahrzehnten herausgebildet hat. Diese Form einer „Handlungsellipse“, d.h. von „Aufforderungen zu Handlungen in stark vorstrukturierten Situationen“ (Ágel / Hennig 2007, 201) entspricht in der Sprachwissenschaft Bühlers „empraktischen Nennungen“ ([1934]1982, 155sqq.). Im Rahmen des Modells des Nähe- und Distanzsprechens werden entsprechende Ausdrücke als ‚Handlungsellipsen‘ unter dem Beschreibungsparameter ‚Situation‘ erläutert. Das bedeutet, es sind sprachliche Mittel, in denen sich das universale Diskursverfahren ‚Verflechtung von Sprechen und non-verbalem Handeln‘ manifestiert (cf. ‚Kapitel 4‘).
Für das Ziel dieser Arbeit, aus sprachpragmatischem Blickwinkel die oben erwähnten sprachlichen Mittel und Strukturen in ihrer formalen und funktionalen Vielfalt in einer systematischen, nachvollziehbaren und verständlichen Art und Weise zu Gruppen zusammenzufassen (Stichwort Operationalisierbarkeit), erweist sich das Modell des „Nähe- und Distanzsprechens“ in seiner von Ágel / Hennig optimierten Variante, die seine konzeptionellen Voraussetzungen, Begriffe, Definitionen und seine Terminologie mit einschließt, als geeigneter Rahmen. Die Gliederung dieses Buches in Kapitel und Unterkapitel orientiert sich infolgedessen an den im Modell des Distanz- und Nähesprechens postulierten Beschreibungsparametern ‚Rolle‘, ‚Zeit‘, ‚Situation‘, ‚Code‘ und ‚Medium‘, den ‚Universalen Diskursverfahren‘, die sich diesen Parametern zuordnen lassen sowie den sprachlichen Mitteln, in denen sich diese Verfahren in einer Sprache manifestieren.
Alle im Buch vorgenommenen Analysen und kategorialen Bestimmungen von Nähemerkmalen folgen hierbei genau vorgeschriebenen Schritten, die ich am Beispiel der „Reaktive“ (Sieberg 2016, 101sqq.) folgendermaßen verdeutliche: Erster Schritt: Ausgehend vom Studium und der vorläufigen Analyse einiger Transkriptionen aus dem ‚CLUL-Korpus‘ sowie ersten Hinweisen aus der Sekundärliteratur fallen sprachliche Ausdrücke auf, die direkt nach dem Sprecherwechsel gebraucht werden, und deren Funktion darin zu bestehen scheint, spontan und effizient auf die vorhergehende Äußerung des Gesprächspartners zu reagieren. Zweiter Schritt: Im Modell – siehe seine vereinfachte und schematische Darstellung in ‚Kapitel 4‘ – findet man unter dem Beschreibungsparameter ‚Zeit‘ das universale Diskursverfahren ‚Einfache Verfahren der Einheitenbildung‘, dem sich diese Gruppe von ‚Reaktiven‘ zuordnen lässt, weil der Gebrauch von Ausdrücken wie claro, certo, exatamente, ai é, nem pensar, acho que sim, etc. auf den Einfluss dieses Verfahrens zurückgeführt werden kann, bzw. weil sich dieses Diskursverfahren in diesen sprachlichen Mitteln manifestiert. Dritter Schritt: Durch eine vertiefende Lektüre entsprechender Sekundärliteratur sowie eine weitere Suche im empirischen Material, die zu einer Vergrößerung des Repertoires von passenden tonalen Zeichen, Wörtern und Wortverbindungen führt, gelangt man schließlich zu einer Definition dieser Gruppe von Nähemerkmalen, die formale und funktionale Charakteristika der ‚Reaktive‘ so treffend und umfassend wie möglich bestimmt: „Sprecher gebrauchen Reaktive direkt nach dem Sprecherwechsel und verfügen mit ihnen über ein sprachliches Mittel, das es ihnen erlaubt, spontan Stellung zu den vorangehenden Äußerungen der Gesprächspartner und den mit ihnen verbundenen Geltungsansprüchen (illokutive Bestandteile der Sprechakte) zu nehmen“ (cf. Kapitel 6.2.1).
Angesichts des von mir gesteckten Ziels – man beachte nur die Vielzahl und Heterogenität der zu beschreibenden sprachlichen Erscheinungen – sollte es den Leser nicht verwundern, dass meine Recherchen keinen umfassenden Überblick über die entsprechende Sekundärliteratur liefern, die es zu den jeweiligen Phänomenen im Bereich der germanistischen und luso-brasilianischen Sekundärliteratur gibt. In Orientierung an dem Ziel, das bereits im Vorwort formuliert wurde, geht es in dieser Arbeit vielmehr darum, durch die Übernahme eines Konzepts der germanistischen GSF portugiesisches Nähesprechen angemessen und durch nachvollziehbare Operationen beschreiben zu können. Folglich liegt auch der Schwerpunkt und der Ausgangspunkt dieser Recherche vornehmlich im Bereich der germanistischen Sekundärliteratur zur GSF.
Letztendlich stelle ich mir diese Arbeit als Anregung und als zusätzliche Orientierungshilfe für weitere Forschungen zum gesprochenen Portugiesisch vor. Dabei wäre auch eine Anwendung auf andere romanische Sprachen durchaus denkbar. Dieser Optimismus beruht auf der besonderen Eignung des an dieser Stelle benutzten Konzepts und Modells, seiner Operationalisierbarkeit, seiner streng systematischen und hierarchischen Gliederung sowie auf der universalen Geltung seines Axioms und seiner Diskursverfahren.
Neben der bereits erwähnten Operationalisierbarkeit sowie Universalität seiner Parameter und Diskursverfahren bietet das Modell des ‚Nähe- und Distanzsprechens‘ den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass sich auch der Sprachgebrauch von kommunikativen Praktiken der ‚Neuen Medien‘ – im Folgenden möchte ich für die Bezeichnung dieser Kommunikationsform den Terminus „keyboard-to-screen communication“ (Imo 2015) verwenden – im Rahmen dieses Modells systematisch erklären lässt. Ins Zentrum meiner Untersuchung stelle ich allerdings den Bereich des prototypischen Nähesprechens (Alltagsdialoge). Die Vorstellung und Interpretation einiger portugiesischer Tweets aus dem Bereich des peripheren Nähesprechens beschränke ich hingegen auf Kapitel und sprachliche Erscheinungen, für die sich eine solche Erörterung anbietet und besonders relevant ist – z.B. innerhalb der Beschreibungsparameter ‚Code‘ und ‚Medium‘.
Prinzipiell ließen sich auch die Nähesprachlichkeit anderer kommunikativer Praktiken der „keyboard-to-screen communication“ wie Einträge in Weblogs, Internetforen oder den Chats in sozialen Netzwerken wie Facebook etc. mit Hilfe des hier angewendeten Konzepts untersuchen. Alle diese kommunikativen Praktiken fallen durch einen Sprachgebrauch auf, der den Formen medial mündlichen Nähesprechens teilweise ähnelt und analoge Ausdrucksformen und Strukturen aufweist. Zudem handelt es sich um Formen, die zunehmend einen großen Teil unserer kommunikativen Wirklichkeit bestimmen und dabei radikale Veränderungen unserer zwischenmenschlichen Umgangsformen nach sich ziehen. Zum Anlass der Verleihung des ‚Konrad-Duden-Preises‘ äußerte sich Peter Schlobinski, Professor an der Universität Hannover, folgendermaßen zur Radikalität dieses Wandels (Schlobinski 2012, 18):
Die digitale Revolution integriert alle Errungenschaften vorangegangener Medienrevolutionen unter einem Dach. Multimedialität und -modalität, Medienkonvergenz und Transmedialität sind die Schlüsselbegriffe dieses Prozesses. Doch im Kern führt diese Mediamorphose zu einem integrierten, allumfassenden Kommunikationssystem, einem Unimedium, in dem reale, imaginär-fiktionale und virtuelle Welt aufeinander bezogen sind. Und das Unimedium globalisiert Sprache und Kommunikation in einer neuen Qualität. Es macht Kommunikation frei konvertierbar und die Währung sind Bits und Bytes.
Für den Sinn der vorliegenden Studie spricht zudem, dass die Forderung nach Beschäftigung mit der gesprochenen Sprache aus der Perspektive angewandter Linguistik zunehmend lauter wird17. Gerade in jüngster Zeit widmet sich die Didaktik der Fremdsprachenvermittlung gezielt der gesprochenen Sprache und ihrer Einbeziehung in den Fremdsprachenunterricht. Die Kenntnis zentraler Merkmale und das Beherrschen der spezifischen Ausdrucksmittel mündlicher Kommunikation werden zum integralen Bestandteil einer entsprechenden „interaktionalen Kompetenz“ (siehe auch ‚Kapitel 10‘). Ohne sie sind die Lerner einer Fremdsprache entsprechenden Situationen mündlicher Kommunikation relativ hilflos ausgeliefert. Das Wissen darüber, wie mündliche bzw. nähesprachliche Kommunikation funktioniert, und welche spezifischen Ausdruckformen und Strukturen vermittelt werden müssen, um bei den Lernern entsprechende Kompetenzen zu fördern, sollte folglich auch zum obligatorischen Bestandteil des ‚Portugiesisch als Fremdspracheunterricht‘ gehören. Der vorliegende Beitrag liefert das hierfür notwenige linguistische Grundwissen.
2.Zur Situation der Gesprochenen-Sprache-Forschung in Portugal und Brasilien
Im Folgenden skizziere ich meine Einschätzung der Forschungslage zur gesprochenen Sprache in Portugal und Brasilien. Dazu gehört die Darstellung von zentralen Forschungszentren und Projekten in Portugal und Brasilien, sowie eine Beschreibung von Tendenzen, Schwerpunkten und Desideraten, die sich in der mir bekannten Forschungsliteratur zum Thema benennen lassen. Gemessen an diesem hohen Anspruch – eine entsprechende umfassende Recherche und Beschreibung bedürfte eines eigenen Projekts und Veröffentlichung – möchte ich den zusammenfassenden und vorläufigen Charakter der folgenden Ausführungen herausstellen.
In Relation zu den die übrigen Teilen dieses Buches handelt es sich bei diesem Kapitel um einen ‚Exkurs‘. In ihm wird ein Thema erörtert, das eigentlich außerhalb des restlichen, ‚systematischen‘ Teil dieses Buches steht.
In Portugal ist das Centro de Línguas da Universidade de Lisboa1 (CLUL) die wichtigste Institution, die sich u.a. mit der Erforschung der gesprochenen Sprache beschäftigt. Besonders hinsichtlich der Zurverfügungstellung von geeigneten Korpora und Transkriptionen bietet dieses Zentrum eine gute Ausgangsposition für weiterführende Forschungen zum gesprochenen Portugiesisch. Die Korpora, von denen ich im Folgenden einige vorstelle, zeichnen sich durch ihren Umfang und durch ihre teilweise ‚On-line‘ Verfügbarkeit aus:
Was die Projekte anbelangt, die auf der Grundlage der oben genannten Korpora durchgeführt wurden, noch laufen bzw. sich zurzeit in ihren Anfangsphasen befinden, scheint mir das Zitat oben unter Gliederungspunkt (c) sehr aufschlussreich zu sein. Es macht deutlich, was portugiesische Sprachwissenschaftler fast wie selbstverständlich als Ziel einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit ihrer gesprochenen Sprache verstehen. Nach einer Recherche zu abgeschlossenen bzw. noch aktuellen Forschungsprojekten in Zusammenhang mit dem gesprochenen Portugiesischen verdichtet sich zwar der Eindruck, dass Studien zur Phonetik, Phonologie, Prosodie und Lexikographie immer noch vorherrschen, doch wäre es ungerecht und ergäbe ein ‚verzerrtes Bild‘, nicht auch auf andere Studien mit unterschiedlichen Untersuchungszielen aufmerksam zu machen. Ohne an dieser Stelle einen kompletten Überblick geben zu können, folgt die Darstellung einer kleinen Auswahl solcher Projekte und Ziele11. Die Projekte sind dabei thematisch in folgende Sektoren unterteilt, bzw. unterschiedlichen Forschungszentren zugeordnet: (I) ANAGRAMA – Análise Gramatical e Corpora, (II) CLG – Grupo de Computação do Conhecimento Léxico-Gramatical, (III) Dialectologia e Diacronia, (IV) LabFon – Laboratório de Fonética, (V) Laboratório de Psicolinguística und (VI) Filologia.
Was momentan laufendende und noch nicht abgeschlossene Projekte im Themenbereich des gesprochenen Portugiesisch betrifft, möchte ich als Beispiele das Projekt ‚COPAS‘ hervorheben, das darauf abzielt zu erforschen, wie Intonation und syntaktische Mittel beim Sprechen zur Hervorhebung des ‚Topiks‘ einer Äußerung beitragen; ‚LeCIEPLE‘ aus dem Bereich des ‚Portugiesisch als Fremd- und Zweitsprachenerwerbs‘ mit der Erstellung eines eigenen Lernkorpus; das Projekt ‚VAPOR‘, das sich um die Zusammenstellung von Korpora mit in Afrika gesprochenen Varianten des Portugiesisch bemüht; das Projekt ‚LETRADU‘, das sich der Entwicklung Computer gestützter Übersetzungsprogramme sowie der Erstellung verschiedener Wortatlasse widmet, die auch das gesprochene Portugiesisch in Afrika, Brasilien, Europa, Galizien und auf den Azoren mit einschließen.
Eine weitere mir bekannte und bereits abgeschlossene Arbeit, deren Planung und Realisierung aber außerhalb Portugals erfolgte, ist die auf Deutsch verfasste Arbeit von Viegas Brauer-Figueiredo (1999), die m.E. in Portugal bis jetzt nicht die ihr gebührende Beachtung gefunden hat. Wie die Autorin selber ausführt, wurde sie zu ihrer Arbeit durch Koch / Oesterreicher (1999, 9) angeregt, was als Folge hatte, dass sie sich bei ihrer Arbeit um eine Orientierung an dem Modell dieser Autoren12 bemühte, allerdings ohne dieses Konzept konsequent einzuhalten. Jedenfalls folgt die Arbeit dem für ihre Zeit neuartigen Konzept, morphologisch-syntaktische Erscheinungen der GS – u.a. Kontaktsignale, Überbrückungsphänomene, sprachliche Mittel zur Engführung13, polyfunktionales que, frases clivadas, passe-partout