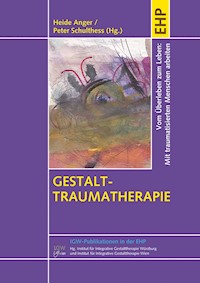
Gestalt-Traumatherapie E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHP Edition Humanistische Psychologie
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Band vermittelt den State of the Art der gestalttherapeutischen Arbeit mit traumatisierten Menschen: Grundlagen, Methoden und Praxis der Traumatherapie, u.a. Kriegstraumatisierung, Armut und Trauma, Traumafolgestörungen, Dissoziative Fugue, Traumabehandlung von Kindern und Jugendlichen, Albträume, Genderperspektiven.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IGW-Publikationen
Hg. Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg (IGW)
Institut für Integrative Gestalttherapie Wien (IGWien)
Die Reihe wird gemeinsam vom Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg (IGW) und dem Institut für Integrative Gestalttherapie Wien (IGWien) herausgegeben. Die beiden Schwesterinstitute wollen damit im deutschen Sprachraum einen Beitrag leisten zum öffentlichen fachlichen Diskurs unter Gestalttherapeutinnen und Gestalttherapeuten sowie bei gegebenem Thema auch unter Personen, die andere Therapieansätze vertreten. Als Autorinnen und Autoren treten Lehrende und Graduierte der beiden Institute auf, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen.
Verantwortlich für die Reihe sind:
Peter Schulthess, Zürich (IGW), und Heide Anger, Wien (IGWien)
Herausgeberin und Herausgeber dieses Bandes
Heide Anger, Jg. 1953, Dr. med.; Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie; Psychotherapieausbildung (Gestalttherapie, systemische Therapie, körpertherapeutische Methoden, Autogenes Training, paartherapeutische Weiterbildung); Ausbildnerin und Lehrtherapeutin/Lehrsupervisorin im IGWien; nach dem Bosnienkrieg Mitarbeit in verschiedenen Projekten zur Unterstützung exjugoslawischer KollegInnen in Maribor und Zagreb; Unterricht an der staatlichen sowie an der katholischen Universität in La Paz/Bolivien 2007; Schwerpunkt des Weiterbildungsangebots: Arbeit mit traumatisierten Menschen und Persönlichkeitsstörungen; zwei Kinder.
Peter Schulthess, Jg. 1950, lic. phil. I; Psychotherapeut (ECP, EAGT, SPV, SVG); arbeitet seit 1976 in Zürich als Gestalttherapeut in freier Praxis; studierte an der Universität Zürich Pädagogik, Psychologie und Philosophie; gestalttherapeutische Ausbildung am Fritz Perls Institut und in Seminaren bei Lore Perls, Joseph Zinker, Erv und Miriam Polster; seit 1990 Ausbilder am Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg (IGW) und seit 2002 an der Gestaltfoundation in Athen und Thessaloniki; lehrt in der Schweiz, Deutschland, Griechenland, Polen, Serbien und Russland; Präsident der Schweizer Charta für Psychotherapie und Vizepräsident der EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
© 2008 EHP – Verlag Andreas Kohlhage, Bergisch Gladbach
www.ehp.biz
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationabibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagentwurf: Uwe Giese
– unter Verwendung eines Bildes von Dorothea Cyran-Daboul: Untitled –
Gedruckt in der EU
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.
eBook-ISBN 978-3-89797-534-7
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
(Heide Anger, Peter Schulthess)
Traumatherapie aus gestalttherapeutischer Perspektive
(Wolfgang Wirth)
Frau A. – Vom Überleben zum Leben
(Anja Jossen)
›Quälende Erinnerungen‹.
Gedanken zum Thema Kriegstraumatisierungen
Mit einem Gespräch mit Willi Butollo
(Almut Ladisich-Raine)
Die Arbeit mit kriegstraumatisierten Menschen und Gestalttherapie
(Irena Bezić)
Wie die Armut schockiert und tiefe Wunden schlägt.
Ein Beitrag zur Klärung des Verhältnisses von struktureller Gewalt und PTBS aufgrund einer Fallstudie im bolivianischen Hochland
(Colette Jansen Estermann)
»Nicht betreten!«
Stabilisierende Therapie bei Traumafolgestörungen – gestalttherapeutisch definiert
(Rotraud Kerner)
»The Gestalt wants to be completed«.
Therapiebericht über eine Dissoziative Fugue
(Heide Anger)
Über den Umgang mit dem Entsetzen.
Aspekte gestalttherapeutischer Traumabehandlung bei Kindern und Jugendlichen
(Thomas Schön)
Kognition im Schlaf (luzides Träumen).
Eine Therapiemethode zur Bewältigung von Albträumen – auch bei Traumatisierung
(Brigitte Holzinger)
Hat das Trauma ein Geschlecht?
Genderperspektivische Bewältigungsstrategien nach traumatisierender Gewalterfahrung aus der Sicht gestalttherapeutischer Theorie
(Beatrix Wimmer)
Autorinnen und Autoren
Vorwort
Noch ein Buch über Traumatherapie?
Die Präsentation theoretischen und praktischen Wissens von GestaltherapeutInnen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, erscheint uns gerade zu einem Zeitpunkt besonders wichtig, da einerseits immer mehr manualisierte Herangehensweisen vorgelegt werden, die suggerieren, auch unerfahrene PsychotherapeutInnen könnten mit schwer Traumatisierten arbeiten, wenn sie nur das Manual einhielten, andererseits eine Überwindung des starren Anhaftens an Therapieschulen und Methoden in Aussicht ist, die sich zunehmend am dringenden Bedarf der Betroffenenen orientiert.
Die Statistiken sind fatal.
Etwa 30 Prozent der Kinder, die unter schweren Lebensereignissen oder suboptimaler Versorgung litten, erkranken im Laufe ihres Lebens an einer majoren Depression, nicht erst im Erwachsenenalter, sondern schon als Kinder oder als Jugendliche. Und das ist nur eine mögliche Traumafolgestörung.
Jede Form der Traumafolgestörung stellt einen Versuch dar, mit dem traumatisierenden Ereignis und den Schäden, die es angerichtet hat, zurechtzukommen. Jede einzelne stellt einen Versuch dar, eine unterbrochene Handlung zu Ende zu bringen, eine Gestalt zu schließen.
Man könnte sagen, Gestalttherapie ist aus diesem Grund genuin Traumatherapie. Wolfgang Wirth belegt dies in seiner Darstellung der Lebens- und Traumageschichte von Fritz Perls auf eindrucksvolle Weise.
Im Herbst 2007 fand in Wien eine Ausstellung zu Leben und Werk Wilhelm Reichs statt. Auch dies eine Traumageschichte, von Bedeutung durch das Erkennen der Wichtigkeit des Köpergedächtnisses für die Aufrechterhaltung der seelischen Belastung.
Viele GestalttherapeutInnen arbeiten in ihrer täglichen Praxis mit traumatisierten Menschen. Wenig ist bisher publiziert worden, wie sie dies tun und wie sie sich in ihrer Arbeit theoretisch und methodisch auf die Gestalttherapie beziehen.
Bekannt sind die Arbeiten von Butollo und seinen KollegInnen (z.B. Butollo et al. 1998 und 2003) zum Umgang mit traumatischen Folgen durch Krieg.
Imke Deistler und Angelika Vogler legten 2005 ein Buch zur therapeutischen Begleitung von schwer traumatisierten Menschen vor, welches zugleich eine Einführung in das Verständnis der dissoziativen Identitätsstörung abgibt. Sie reflektieren dieses Störungsbild aus der Sicht der Gestalttherapie und zeigen Therapiemöglichkeiten auf aus ihrer Arbeit mit Opfern sexueller Gewalt.
Eine weitere Möglichkeit der Traumatisierung wurde 2006 von Michaela Pröpper thematisiert: Die traumatisierenden Folgen einer Krebsdiagnose.
Neben diesen größeren Publikationen ist eine Reihe kleinerer Beiträge erschienen, auf welche in diesem Band Bezug genommen wird. Weiter wird die Notwendigkeit deutlich gemacht, sich verschiedene Sichtweisen und Techniken anderer Methoden zunutze zu machen, um die PatientInnen optimal zu behandeln. Mit diesem Buch wollten wir GestaltherapeutInnen Gelegenheit geben, aus ihrer Praxis zu berichten. Wir wollen damit die theoretische Diskussion wie auch den Austausch über Praxiserfahrungen in der Arbeit mit traumatisierten Menschen anregen und beleben. Die meisten AutorInnen schauen in Theorie und Praxis auch über den »Tellerrand«. Sie beziehen sich nicht nur auf die Gestalttherapie sondern auch auf den aktuellen Forschungsstand der Traumatherapie. Stabilisierende Vorgehensweisen und Techniken sind grundlegend für jede psychotherapeutische Methode, und die Sammlung imaginativer Techniken, die Luise Reddemann vorgelegt hat, ist ein wertvolles Schatzkästchen für all jene, die beim gestalttherapeutischen Experimentieren Unterstützung suchen.
Alle AutorInnen dieses Bandes arbeiten in unterschiedlicher und beeindruckender Weise eine Verankerung mit der Theorie und den Konzepten der Gestalttherapie heraus und zeigen, wie gut diese sich eignet, um mit traumatisierten Menschen zu arbeiten. Sie fördern damit die gestalttherapeutische Theoriebildung.
Wir wollen in diesem Band einerseits den aktuellen Wissensstand widerspiegeln, andererseits Einblick in die individuellen gestalttherapeutischen Vorgangsweisen der AutorInnen geben und schließlich ermutigen, auf der Basis gestalttherapeutischen Grundverständnisses von Annahme, Kontakt und Stütze Anregungen für die Behandlung der wachsenden Personengruppe mit diagnostizierten Traumafolgestörungen zu bieten.
Den Auftakt macht Wolfgang Wirth mit einer überblicksartigen Aufarbeitung der theoretischen Anknüpfungspunkte zu einer gestalttherapeutischen Konzeption der Traumatherapie. Spannend sind u.a. seine biografischen Ausführungen zu Fritz Perls, welche ihn als durch Kriegserlebnisse und familiäre Gewalt Traumatisierten darstellen, was wesentlichen Einfluss auf die Konzeption der Gestalttherapie hatte. Sie enthält, wie anhand einer genauen Durchsicht von Gestalttherapie (Perls et al 2006) gezeigt wird, schon in ihrer originären Konzeption wesentliche Elemente und Stützen zu einer Traumatherapie. Wirth arbeitet mit Hörgeschädigten und rundet seinen Beitrag mit einer Fallvignette über eine gehörlose Frau ab, die miterlebte, wie ihre Freundin von einer Lawine erfasst und getötet wurde. Bemerkenswert ist, dass die Therapie in der Gebärdensprache erfolgt.
Anja Jossen präsentiert in ihrem Beitrag ein eindrückliches Fallbeispiel einer Überlebenden eines Gemetzels aus dem Kosovokrieg. Es gelang der Frau, in die Schweiz zu flüchten und dort um Asyl anzusuchen, welches ihr im Behandlungszeitraum auch gewährt wurde, was mit zu einer Stabilisierung beitrug. Jossen gelingt es, hautnah zu schildern, was passiert war, wie der Therapieprozess verlief und den Beitrag durch gestalttheoretische Reflexion zu bereichern. Der Artikel wird abgerundet durch die Schilderung eines Treffens fünf Jahre nach Abschluss der Therapie. Erwähnenswert ist, dass in dieser Therapie einer aus einer anderen Kultur stammenden Patientin aus sprachlichen Gründen immer eine Drittperson als Übersetzerin mitwirkte. Das gehört nicht selten zu den Therapiebedingungen in der Arbeit mit Fremdsprachigen, mit Asylsuchenden, und diese sind häufig traumatisiert.
Im anschließenden Beitrag interviewt Almut Ladisich-Raine den bekannten Psychologieprofessor Willi Butollo aus München. Butollo wirkte im Auftrag der UNICEF während des Bosnienkrieges an einem Projekt mit, welches bosnische PsychotherapeutInnen zur Arbeit mit traumatisierten Kriegsopfern befähigen sollte. Er führt aus, wie er als kriegsunversehrter Deutscher, ohne wirkliche Erfahrung in der Therapie Kriegstraumatisierter, keine billigen Therapierezepte anzubieten hatte, sondern in dialogischer Weise gemeinsam mit den Beteiligten erarbeitete, welche Unterstützung sie brauchten. Was er zu bieten hatte, waren generelle Kenntnisse aus der Traumatherapie, was die einheimischen TherapeutInnen zu bieten hatten, war deren eigene Erfahrung als vom Krieg Geprägte. Gemeinsam konnten Wege zur therapeutischen Bewältigung gefunden werden. Die Würdigung der Bosnier als Experten auf gleicher Ebene ermöglichte eine Begegnungsqualität, welche für sich heilend war und einer gestalttherapeutischen Haltung entspricht. Deutlich wird im Interview, dass es bei den bosnischen TherapeutInnen keine Unterscheidung gab zwischen unbetroffenem Helfer und betroffenem Patienten. Alle waren sie traumatisiert und geprägt von ihrer je eigenen Kriegserfahrung und familiären Verlusten. Das ergab eine besondere Grundlage für die therapeutische Arbeit, für Abgrenzungen zwischen dem Erleben von TherapeutIn und PatientIn und die Psychohygiene der TherapeutInnen.
Ladisich-Raine war nach dem Krieg als Ausbildnerin in Kroatien tätig und hat dort auch erlebt, wie die auszubildenden TherapeutInnen immer zugleich auch Betroffene des Kriegs waren.
Irena Besic ist Gestalttherapeutin und Psychiaterin aus Kroatien. Sie war am Projekt Butollos in Bosnien beteiligt wie auch am gestalttherapeutischen Ausbildungsgang, in welchem Ladisich-Raine mitwirkte. Sie erlebte die Kriegszeit und die Nachkriegszeit in einer Doppelrolle als professionelle Helferin und Betroffene. Sie leistete in manchen der neuen Staaten professionelle Hilfe im Umgang mit schweren Traumafolgen. Ihr kurzer Erfahrungsbericht lässt erahnen, wie nachhaltig diese Folgen sind und wie prägend auch für die TherapeutInnen.
Colette Jansen Estermann berichtet über die Therapie eines durch sexuelle Gewalt traumatisierten Mannes im bolivianischen Hochland. Sie reflektiert dabei auch eine aus feldtheoretischer Sicht wichtige Dimension, die der strukturellen Gewalt.
Sie zeigt auf, wie gesellschaftliche Machtverhältnisse, insbesondere in Ländern mit großer Armut, durch strukturelle Gewalt – im Sinne Johan Galtungs – Traumatisierungen im familiären, kirchlichen und behördlichen Rahmen begünstigen. Aber auch wie die Permanenz struktureller Gewalt (z.B. keine Aussicht auf Arbeit und Teilhabe an gesellschaftlichen Werten, Bedrohung durch militärische und paramilitärische Truppen) dauerhafte psychische Veränderungen bewirkt, die die Menschen überhaupt erst in die Lage versetzen, ihre Situation zu ertragen.
Eine weitere sehr anschauliche und theoretisch gut reflektierte Fallgeschichte präsentiert Rotraud Kerner. Es handelt sich um die Schilderung der stabilisierenden Therapie einer traumatisierten Frau, welche wiederholt sexuelle Gewalt im Familienkontext erlebt hatte und eine Dissoziative Identitätsstörung entwickelte. Kerner verbindet Stabilisierungstechniken, die sie bei Reddemann, Sachsse und Huber fand, und das Ego-state-Konzept (Systemische Therapie mit der inneren Familie, vergleichbar dem Konzept der Selbst-Anteile in der Gestalttherapie) mit der Haltung, den Prinzipien und Techniken der Gestalttherapie. Sie zeigt, wie ein nachhaltiger Therapieerfolg im Hinblick auf ein befriedigendes Alltagsleben auch durch die konsequente Verwendung von Stabilisierungstechniken allein erreicht werden kann, ohne dass Traumaexposition sich je als erforderlich zeigt.
Da viele Traumatisierungen bereits im Kindesalter erfolgen, schien uns ein Beitrag über die Traumabehandlung bei Kindern und Jugendlichen unentbehrlich. Thomas Schön arbeitet seit vielen Jahren in freier Praxis und in einer therapeutischen Wohngemeinschaft mit Kindern und Jugendlichen. Er zeigt die Wichtigkeit einer frühen Traumabehandlung im Kindesalter auf, gibt Fallvignetten und reflektiert diese auf gestalttherapeutischem Theoriehintergrund. Wichtig auch sein Exkurs zu Psychohygiene von Helfenden.
Mit der Präsentation des »Luziden Träumens« als Therapieansatz für den Umgang mit Albträumen offeriert Brigitte Holzinger einen Ansatz, wie auch Albträume im Zusammenhang mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung von der träumenden Person beeinflusst werden können, so dass eine symptommildernde, stabilisierende Wirkung erreicht wird.
Der Band wird abgerundet mit einem Beitrag von Beatrix Wimmer zu genderspezifischen Bewältigungsstrategien von traumatisierenden Gewalterfahrungen aus der Sicht gestalttherapeutischer Theorie.
Da es sich um einen Sammelband mit vielen AutorInnen handelt, zeigen sich deren Arbeitsumwelten natürlich auch in ihren Texten. Ebenso ergibt sich daraus eine uneinheitliche Verwendung der weiblichen und männlichen Sprach-Schreibform.
Dieses Buch sei allen Patientinnen und Patienten gewidmet, denen wir eine Fülle an Erfahrungen und eine wesentliche Verbesserung unserer Kenntnisse verdanken und all den Helfenden, die mit traumatisierten Menschen arbeiten.
Heide Anger und Peter Schulthess
Wien und Zürich, Januar 2008
Literatur
Butollo, W., Krüsmann, M., Hagl, M. (1998): Leben nach dem Trauma. Über den therapeutischen Umgang mit dem Entsetzen. München: Pfeiffer
Butollo, W., Hagl, M., Krüsmann, M. (2002): Kreativität und Destruktion posttraumatischer Bewältigung. Forschungsergebnisse und Thesen zum Leben nach dem Trauma. München: Pfeiffer
Deistler, I., Vogler, A. (2005): Einführung in die Dissoziative Identitätsstörung. Multiple Persönlichkeit. Therapeutische Begleitung von schwer traumatisierten Menschen. Paderborn: Junfermann
Huber, M. (2003): Trauma und die Folgen. Trauma und Traumabehandlung Teil 1. Paderborn: Junfermann
Huber, M. (2003): Wege der Traumabehandlung. Trauma und Traumabehandlung Teil 2. Paderborn: Junfermann
Perls, F., Hefferline, R., Goodman, P. (2006): Gestalttherapie. Grundlagen der Lebensfreude und Persönlichkeitsentfaltung. (Neu übersetzte deutsche Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta
Pröpper, M. (2006): Gestalttherapie mit Krebspatienten. Eine Praxishilfe zur Traumabewältigung. Köln/Wuppertal: Hammer
Reddemann, L. (2003): Imagination als heilsame Kraft. Stuttgart: Pfeiffer
Wolfgang Wirth
Traumatherapie aus gestalttherapeutischer Perspektive
»Was die Wunde schlug, wird sie heilen«
Orakel von Delphi
In diesem Beitrag wird vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte von Fritz Perls die Entwicklung der Gestalttherapie als traumaorientiertes Verfahren reflektiert. Eine kurze Skizze wichtiger traumadiagnostischer Kategorien und der Neurobiologie traumatischer Prozesse bilden die Grundlage für die Überprüfung gestalttherapeutischer Traumakonzepte. Diese werden aus dem Grundlagenwerk Gestalttherapie herausgearbeitet. Einige Modellskizzen veranschaulichen mein aktuelles und weitgehend gestalttherapeutisches Verständnis traumatischer Prozesse. Die Sichtung eines Großteils der Arbeiten zu verschiedenen gestalttherapeutischen Traumaschwerpunkten bildet neben eigenen Fallvignetten den praxisorientierten Abschluss.
Geschichte der Traumatherapie und Traumatheorien
Die Beschäftigung mit den lang anhaltenden und auch seelischen Folgen von Gewalt und Verletzungen lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Den delphischen Orakelspruch für die unheilbare Wunde des durch Achilles Speer verwundeten Telephos interpretierte dieser damit, neun Jahre nach der Verletzung Rost von Achilles Speerspitze abzukratzen und auf die Wunde zu streuen. Erst dadurch wurde sie geheilt. In dieser kurzen Geschichte offenbart sich ein sechsgliedriges Wissen um Heilprozesse:
1. Sicherheit, der Speer wird nicht mehr gebraucht, (denn sonst würde er nicht rosten),
2. eine Konfrontation zwischen Täter/Tatwaffe und Opfer findet statt,
3. die nicht mehr gebrauchte Waffe muss als eine Art Täter/Opfer-Ausgleich dem Opfer zur Verfügung gestellt werden, damit es diesen Rost erhalten kann,
4. Das ursprünglich Verletzende führt in abgeschwächter, »assimilierbarer« Form zur Heilung,
5. die verstreichende Zeit wird eingerechnet, die es dauert, bis die Speerklinge rostet und
6. die Einschätzung der Tat ist durch einen Transformationsprozess verändert. Die Realität dieses Transformationsprozesses wird erlebt und stößt die Heilung an.
In unserer Kultursphäre und Zeit wurde das Traumathema bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich anhand gerichtsmedizinischer Befunde über massive Kindesmisshandlungen durch Charcot aufgegriffen und von Janet (1889, zit. nach van der Kolk 2000, 223) sehr genau zu den Themenfeldern Dissoziation, Gedächtnisstörung und Organisation der seelischen Prozesse ausgearbeitet (Streeck-Fischer, Sachsse & Özkan 2001, 12). In England wurde die Thematik durch Ängste bei der Einführung der Eisenbahn als railway spin bewusst. Im 1. Weltkrieg wurde das Phänomen der Traumatisierung als »Kriegszittern« beobachtet und in England rasch mit dem Begriff shell shock (Granatenschock) belegt (Radkau 1998, 430). In den Anfängen hatte vor allem das Militär (Butollo 2003, 4) Interesse an der Behandlung und Entschärfung posttraumatischer Ausfälle von Soldaten, im russisch-japanischen Krieg 1904/5 wurden hierfür erstmals Militärpsychiater eingesetzt (Watson 1982, 206f). Durch die Sensibilisierung gegenüber den Symptomen wurden aber auch bei anderen Opfern von schlimmen Ereignissen wie Verkehrsunfällen, Schiffsunglücken oder Naturkatastrophen ähnliche Symptome festgestellt.
Das Interesse von Psychotherapeuten für die Behandlung der Folgen traumatischer Erlebnisse hat in den letzten 25 Jahren in hohem Maße zugenommen, sodass ein regelrechter Boom der Traumaforschung beobachtet werden konnte. Die Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wurde erst 1980 in das DSM III aufgenommen (van der Kolk et al. 2000, 86).
Einflussreiche Gründe dafür waren die lang andauernden psychischen Folgen bei Betroffenen. Zu diesen zählten unter anderem die Opfer des Holocausts, Vietnamveteranen sowie sexuell missbrauchte Frauen und Mädchen. Für diese letzte Gruppe schärfte sich das Bewusstsein im Gefolge der Diskussionen der Frauenrechtsbewegung um sexuelle Selbstbestimmung und sexuellen Missbrauch. In Europa wurden die psychischen Folgen der Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien von verschiedenen Forschern genauer untersucht (z.B. Butollo, Krüsmann & Hagl 1998, Butollo, Hagl & Krüsmann 2003). Der 11. September 2001 mit der Zerstörung der Zwillingstürme in New York führte auch bei Gestalttherapeuten zu einer Fokussierung auf das Traumathema, was sich in einem Themenheft (2004) der elektronischen Zeitschrift Gestalt! zeigte. Die Diskussion um die Diagnose PTBS ist gegenwärtig weiter im Fluss und wird weitere Differenzierungen erfahren. (Butollo, Hagl, Krüsmann 2003, 189)
Eigene Traumatisierungen als lebensgeschichtlicher Hintergrund bei Fritz Perls
Perls charakterisiert seine Kindheit und sein junges Erwachsenenalter selbst als traumatisch. Dabei können mindestens fünf traumatische Einflüsse unterschieden werden.
1. Gewalt, Ablehnung, heftigste Prügeleien und der Versuch den Willen des Kindes Fritz auszulöschen,
2. sozialer Ausschluss und Repression an der Schule als Jude,
3. Kriegstraumatisierungen im 1. Weltkrieg mit Verlust seines besten Freundes, mit möglicher Retraumatisierung durch seine Psychoanalyse bei Harnack
4. Trauma der erzwungenen Emigration
5. Ermordung des Großteils seiner gesamten Familie, Verwandtschaft, vieler Freunde, Lehrer und Kollegen.
1) »Meine Mutter schlug mich mit Teppichklopfern. Sie konnte mich nicht brechen, ich zerbrach die Teppichklopfer.« (Perls 1981, 313). Bocian (2002, 39) vermutet, dass die folgende Passage aus Perls 1981 (290) zumindest mit eigenem Erleben vermischt ist: »Nie vergaß er, dass sein Vater ihn des öfteren »ein Stück Scheiße« nannte. Die Reaktionen der Eltern (…) erlebte er als existentiell vernichtend. »Ich will dich auslöschen, du sollst nicht leben. An deiner Stelle soll ›nichts‹ sein. (…) Wir erziehen dich. Bis du so wirst wie Wir, Wir, Wir, Wir dich haben wollen.« Bocian führt über Perls weiter aus: »Eine traumatische Neurose definiert er an einer Stelle als Verteidigungsstrategie, um sich gegen die »Überfälle der Gesellschaft« (Perls 1979, 49, zit. nach Bocian 2002) zu schützen. »Das zweijährige Kind z.B., das von seinen Eltern in einer dunklen Kammer eingeschlossen wurde, ist fast einer unerträglichen Anspannung unterworfen. Es wird durch ihr Verhalten auf ein Nichts reduziert – ja auf weniger als ein Nichts; es wird zu einem Objekt ihrer Manipulation ohne eigenes Recht und eigene Macht. Es gibt kein ›Ich‹ mehr, es gibt nur ›sie‹ und was ›sie‹ tun können« (ebd.). Bei der Durchsicht der Kurzvariante seiner Autobiographie (Perls 1993) fällt die schwierige Kindheitssituation und die fehlende soziale Unterstützung auf. Das Kind kann nicht verstehen, was geschieht. Verstehbarkeit ist aber nach Antonovsky (1997) eine wichtige Ressource, um ein Ereignis als weniger beschädigend und traumatisierend zu erfahren, ihr Fehlen erhöht die Gefahr traumatischer Verarbeitung.
2) »Diese Schule war ein Albtraum für mich« (Perls 1981, 193). »Selten haben so wenige Lehrer so viele Schüler gequält. Das Grundprinzip war Disziplin und Antisemitismus« (ebd., 280).
3) Perls berichtet über Erlebnisse aus dem 1. Weltkrieg im Jahr 1916: Perls hat eine Grippe mit hohem Fieber entwickelt, wird in einem Feldlazarett untergebracht. Er träumt: »meine Familie, im Vordergrund Grete, die Schwester, die ich liebe, steht um mein Grab herum und bittet mich ins Leben zurückzukehren. Ich bemühe mich, strenge mich an, biete alle meine Kräfte auf und schaffe es. Langsam, ganz langsam kehre ich zurück ins Leben, bereit, wenn auch nicht allzu bereit den Tod loszulassen, den Tod, der so viel erträglicher war als die Schrecken des Krieges.« Perls verbrachte neun Monate in den Schützengräben des Stellungskrieges in Flandern, wo der Gaskrieg erstmals erprobt und auf das heftigste geführt wurde. »Ich hatte bereits einen gewissen Grad an Härte und Gefühllosigkeit erreicht, aber es gab zwei Formen des Todes, die ich kaum ertragen konnte. Das eine waren die Kommandos nach den Angriffen. Nachdem die Gas-Wolke über die feindlichen Linien gezogen war, kletterten sie aus ihren Gräben. Sie waren mit einem langen biegsamen Hammer ausgerüstet, mit dem sie jeden der noch ein Lebenszeichen von sich gab, erschlugen. (…) Das andere passierte nur einmal. (…) In dieser Nacht machten wir einen weiteren Gas-Angriff. Öffnet die Ventile. Die gelbe Wolke kriecht in Richtung auf die (feindlichen) Gräben. Dann ein plötzlicher Wirbel. Der Wind ändert seine Richtung. Die Gräben verlaufen in Zick-Zack-Linien. Das Gas kann in unsere eigenen Gräben ziehen… und bei vielen funktionieren die Gasmasken nicht. Und viele, viele erleiden leichte und schwere Vergiftungen und ich bin der einzige Arzt und habe nur vier kleine Sauerstoff-Flaschen und jeder verlangt verzweifelt nach etwas Sauerstoff, klammert sich an mich und ich muss ihm die Flasche entreißen, um einem anderen Soldaten etwas Linderung zu verschaffen. Mehr als einmal war ich versucht, die Gasmaske von meinem schweißgebadeten Gesicht zu reißen.« (Perls 1981, 164f) Nachdem er diese Kriegsberichte aufgeschrieben hat, beschreibt sich Perls am nächsten Tag wieder so: »Heute morgen fühlte ich mich dem Wahnsinn nahe. Worte krochen wie Termiten über meinen ganzen Körper.« (ebd., 169)
Bocian (2002, 88f) geht mit Faiss (zit. in Bocian 2002) von einem starken Kriegstrauma bei Perls aus, das ihn für den Rest seines Lebens verbitterte (Zeff, zit. nach Bocian 2002) und zum Zyniker werden ließ (Perls 2003, 49f).
Perls (1993) selbst spricht von desensitization, einer Desensibilisierung, was in der Traumaliteratur als Abstumpfung oder numbing bezeichnet wird. Diese innere Panzerung aufzulösen und die Lebendigkeit und Lebensfreude wiederzugewinnen ist ein vermutlich daraus erwachsenes dringendes Anliegen. Bocian (2002, 90) sieht diese biographisch bestimmten Themen als zentral für die Entwicklung der Gestalttherapie. Bocian (2002, 112) nennt die in dieser Zeit und der nachfolgenden Weimarer Republik erfahrene »tief greifende Erfahrung der Verunsicherung, ja Dissoziation des Ich« (Vietta, zit. nach Bocian 2002) den Gegenpol zur Sehnsucht nach einer persönlich erlebten guten Gestalt von Perls. Die als Heilungshoffnung aufgesuchte zweite Lehranalyse bei dem extrem abstinenten Analytiker Harnak empfand er als Qual (Bocian 2002, 178). Der Analytiker Venzlaff (2001, 148) schreibt über die Abstinenzhaltung des Analytikers gegenüber Traumatisierten, besonders bei KZ-Überlebenden: »Die von der Psychoanalyse vorgeschriebene Abstinenzhaltung des Analytikers ließ den Patienten diesen in der Übertragungssituation als neuerlichen Aggressor erleben, wirkte oft in hohem Maße angstauslösend und somit antitherapeutisch.«
4) In seinem Interview mit Jim Simkin 1966 schildert Fritz Perls (1992, 23): »In Deutschland, nun dort haben wir einigermaßen komfortabel gelebt. Ich hatte mein Einkommen und Lore bekam etwas Geld von zu Hause. Dann gingen wir nach Holland, wo wir dann in größter Armut lebten. Als ich nach Holland floh, hatte ich eine Summe von umgerechnet 25 Dollar in meinem Feuerzeug versteckt. Und nun durften wir überhaupt kein Geld verdienen. Wir lebten von der Wohlfahrt, im tiefsten Winter auf einem Dachboden. Und Lore musste putzen gehen, das hatte sie vorher noch nie gemacht, und kalt war es, wir froren uns halb tot.«
Lore berichtet, dass sie sehr gefährdet waren »als Mitglieder der antifaschistischen Liga. Sie kamen immer nachts zwischen zwei und vier. Die letzten Nächte schliefen wir jede Nacht woanders.« (DVG-Film 2005)
5) Beim Schreiben seiner Autobiographie und beim Nachdenken darüber, ob er eine jüdische Identität habe, und wie diese sei, berichtet Perls Folgendes: »Ich erwache heute morgen benommen und schwer. Saß auf meinem Bett, dumpf und in einer Trance wie ich sie bei Insassen von psychiatrischen Kliniken gesehen habe, die sich in ihre Grübeleien zurückgezogen hatten. Geister, die Opfer Hitlers, meist Verwandte von mir und Lore besuchen mich, zeigen mit dem Finger auf mich: »Du hättest mich retten können«. Sie wollen, dass ich mich schuldig und für sie verantwortlich fühle.« (Perls 1981, 135f)
Perls kann daher als kindheitstraumatisiert sowie als kriegstraumatisiert angesehen werden. Auf seine Traumatisierung deutet auch seine doch erst sehr späte »Heilung« durch Ida Rolf hin, da aus der Therapie von Traumapatienten inzwischen bekannt ist, dass vor allem der Einbezug und die Fokussierung auf körperlich-emotionales Erleben eine Traumaauflösung möglich macht. Perls schreibt dazu: »… ich hatte Kontakt zu einer Schicht von zersplitterten und zerstreuten Bruchstücken von winzigen Introjektionen und fremdem Material. Viele bestanden aus körperlichen Empfindungen und Bildern jedoch ohne Zusammenhang. (…) Ich habe nicht die geringste Ahnung wie, aber offensichtlich bewirkte dieser Kontakt eine Veränderung. Meine zwanghafte Lüsternheit ließ wirklich nach. (…) Vor etwa drei Monaten gab ich mein zwanghaftes Masturbieren auf und es ist praktisch nichts mehr davon da. (…) ich weiß, dass eines Tages etwas ähnliches mit meinem Rauchen passieren wird« (Perls 1981, 267). Seine Sex- und Nikotinsucht können als weitere traumainduzierte Spannungszustände angesehen werden. Levine schreibt: »Zwanghaftes, perverses, promiskuitives und gehemmtes Verhalten in der Sexualität sind oft Anzeichen für das Bestehen eines Traumas und müssen nicht unbedingt durch sexuellen Missbrauch hervorgerufen worden sein (Levine 1998, 41).
Sein Verhältnis zu seinen Kindern, seine Prügelorgien gegenüber seiner Tochter (»he wanted to beat the hell out of me«: Renate Perls im biographischen Laura-Perls-Film ›Leben an der Grenze‹, 2005) sind weitere Hinweise auf seine traumageprägte Persönlichkeit im Sinne einer Wiederholung als hilfloser Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr.
PTSD-Diagnostik
Innerhalb der Gestalttherapie ist die Entwicklung einer theorie- und therapieangemessenen Diagnostik insbesondere während der Anfangsjahre nicht mit großer Entschiedenheit vorangetrieben worden bzw. wurde immer wieder durch das Bestehen auf einer reinen Prozessdiagnostik erschwert. Einen der neueren Ansätze diagnostischen Herangehens legte Dreitzel (2004) mit einer prozessorientierten Gestaltdiagnostik vor. Für Traumabetroffene erscheint vor Therapiebeginn eine Abklärung der Symptome mit Hilfe diagnostischer Manuale bzw. Tests als sinnvoll, da das Übersehen einer traumabedingten Störung und eine unvorsichtige therapeutische Praxis unter Umständen eine Reinszenierung oder Reaktivierung bislang kompensierbarer Erlebnisse nach sich ziehen kann, die zu einer erneuten Verschlechterung der psychischen Situation mit sehr leidvollen Folgen für Betroffene führen kann. Eine sehr gute Übersicht über Traumadiagnostik geben Butollo, Krüsmann & Hagl (1998, 207f). Ein gestalttherapeutischer Diagnostikbogen, der auch für den Traumabereich helfen kann, die zentralen Konfliktfelder genauer einzugrenzen, findet sich bei Hartmann-Kottek (2004, 200). Auch Kepner (1995, 293f) legt ein eigenes zweiteiliges gestalttherapeutisches Testinstrument zur Einschätzung des Trauma- und Verarbeitungsniveaus vor, mit direkten Ableitungen für sein Traumastufenmodell healing tasks.
Das DSM-IV (1996, 491f) nennt folgende Kriterien für das Vorliegen einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS):
A Die Person wurde mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert, bei dem die beiden folgenden Kriterien vorhanden waren:
1. Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhaltet.
2. Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Beachte: Bei Kindern kann sich dies auch durch aufgelöstes oder agitiertes Verhalten äußern.
B Das traumatische Ereignis wird beharrlich auf mindestens eine der folgenden Weisen wiedererlebt:
1. Wiederkehrende und eindringliche belastende Erinnerungen an das Ereignis, die Bilder, Gedanken oder Wahrnehmungen umfassen können. Beachte: Bei kleinen Kindern können Spiele auftreten, in denen wiederholt Themen oder Aspekte des Traumas ausgedrückt werden.
2. Wiederkehrende, belastende Träume von dem Ereignis. Beachte: Bei Kindern können stark beängstigende Träume ohne wiedererkennbaren Inhalt auftreten.
3. Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiederkehrt (beinhaltet das Gefühl, das Ereignis wiederzuerleben, Illusionen, Halluzinationen und dissoziative Flashback-Episoden, einschließlich solcher, die beim Aufwachen oder bei Intoxikationen auftreten). Beachte: Bei kleinen Kindern kann eine traumaspezifische Neuinszenierung auftreten.
4. Intensive psychische Belastung bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern.
5. Körperliche Reaktionen bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Hinweisreizen, die einen Aspekt des traumatischen Ereignisses symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern.
C Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind oder eine Abflachung der allgemeinen Reagibilität (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens drei der folgenden Symptome liegen vor:
1. Bewusstes Vermeiden von Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen.
2. Bewusstes Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen.
3. Unfähigkeit einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern.
4. Deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten.
5. Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von Anderen.
6. Eingeschränkte Bandbreite des Affektes (z.B. Unfähigkeit, zärtliche Gefühle zu empfinden),
7. Gefühl eine eingeschränkte Zukunft zu haben (z.B. erwartet nicht Karriere, Ehe, Kinder oder ein normal langes Leben zu haben).
D Anhaltende Symptome erhöhten Arousals (vor dem Trauma nicht vorhanden). Mindestens zwei der folgenden Symptome liegen vor:
1. Schwierigkeiten ein- und durchzuschlafen,
2. Reizbarkeit oder Wutausbrüche
3. Konzentrationsschwierigkeiten
4. übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilanz),
5. übertriebene Schreckreaktion.
E Das Störungsbild (Symptome unter Kriterium B, C und D) dauert länger als einen Monat.
F Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
Zeitlich lässt sich die PTSD in drei Typen klassifizieren:
Akut: Wenn die Symptome weniger als 3 Monate andauern.
Chronisch: Wenn die Symptome mehr als 3 Monate andauern
Mit verzögertem Beginn: Wenn der Beginn der Symptome mindestens sechs Monate nach dem Belastungsfaktor liegt.
Meichenbaum 1994 (zit. nach Butollo 2003, 9) unterscheidet Trauma vom Typ I und Typ II.
Typ I : Unerwarteter traumatischer Stressor: Dies ist ein plötzliches, überwältigendes Ereignis von begrenzter Dauer, das sich tief ins Gedächtnis eingräbt, im Detail erinnert wird und zu typischen PTSD-Symptomen wie Intrusionen führt, mit einer wahrscheinlich schnellen Restabilisierung, z.B. Vergewaltigungen, Unfälle, Naturkatastrophen.
Typ II: Anhaltende und wiederholte schwere Stressoren, zuerst wie Typ I, dann wiederholt, das Opfer ist machtlos es zu vermeiden, meist durch Menschen verursacht, mit unvollständigen Erinnerungen, vermehrten Dissoziationen (als Copingmöglichkeit), führt eher zu verändertem Selbstkonzept und Gefühlen der Scham und Wertlosigkeit, sowie lang anhaltenden Persönlichkeitsveränderungen mit emotionalen und sozialen Problemen. Auslösende Situationen sind z.B. physischer und/oder sexueller Missbrauch, Kriegseinsatz, Gefangenschaft, Folter.
Je nach Art und Kontext der Traumaentstehung können verschiedene Bereiche unterschieden werden, die auch noch weiter unterteilt werden können: Durch Menschen verursachte Traumata (man-made), Naturkatastrophen und Unfälle, Krankheiten. Angesichts der noch nicht abgeschlossenen Diskussion um die Diagnostik traumatischer Störungen werden sich weitere Differenzierungen wahrscheinlich in zukünftigen Diagnosemanualen niederschlagen.
Dissoziation
Dissoziation ist die Aufspaltung des Erlebten. Es werden drei Formen unterschieden (nach van der Kolk 2000, 245).
1. Primäre Dissoziation: Dabei wird das, was erlebt wird, nicht vollständig bewusst, sondern sensorisch oder emotional aufgespalten, ohne Integration in eine persönlich verbale Schilderung.
2. Sekundäre Dissoziation: Trennung zwischen einem beobachtenden und einem erlebenden Ich. Im Moment des Traumas wird der Körper verlassen und das Ganze von einer entfernteren Position aus betrachtet.
3. Tertiäre Dissoziation: Deutlich von einander unterscheidbare und z.T. nicht mit einander in Kontakt stehende Ich-Zustände mit jeweils eigenen kognitiven affektiven und Handlungsmustern. Manche dieser Ich-Zustände enthalten die traumatischen Erfahrungen, andere nicht. Dies tritt z.B. bei dissoziativen Identitätsstörungen auf.
Janet (1889, zit. nach van der Kolk 2000, 321) nannte die Dissoziation das Hauptproblem bei Traumata. Die Erinnerung an das, was geschehen ist, kann nicht in die eigenen Schemata integriert werden. Sie wird von den anderen Erfahrungen abgespalten. »Unfähig, die traumatischen Erinnerungen zu integrieren, haben sie anscheinend auch die Fähigkeit verloren, neue Erfahrungen zu assimilieren. Es ist, (…) als wäre ihre Persönlichkeit endgültig an einem bestimmten Punkt stehen geblieben und könnte sich nicht mehr durch Hinzufügung oder Assimilation neuer Bestandteile erweitern. (Janet 1919, zit nach van der Kolk 2000, 322). Auch van der Kolk et al. (2000, 199) nehmen an, dass Dissoziationen zum Zeitpunkt des Traumageschehens ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung einer PTBS sind.
Ausagieren (acting out)
Traumatische Erlebnisse werden häufig wiederholt mit dem impliziten Wunsch, sie nun zu einem guten Abschluss zu bringen. Dabei ist teilweise nur die Handlung der traumatischen Situation durch ihre Wiederholung zugänglich. »Die Wiederholungen sollen dazu dienen eine Gestalt zu schließen« (Perls 1981, 69). Die offen gebliebene Gestalt des traumatischen Erlebnisses führt dabei ähnliche Situationen herbei bzw. greift diese auf, um eine erfolgreiche Lösung zu versuchen. Diese Lösung misslingt in vielen Fällen, da kein Entwicklungsschritt die in der damaligen traumatischen Situation fehlende Sequenz hinzufügen konnte. Durch diese Wiederholungen kann sich die traumatische Verarbeitung des Ereignisses verfestigen, bzw. es kann zu weiteren erneuten Traumatisierungen kommen, den akkumulierten Traumata, die leider häufig zu beobachten sind. Aufgrund der Primärtraumatisierung fehlen zum einen Schutzmechanismen, zum anderen werden Situationen mit viel Aufregung und Wiederholungsmöglichkeiten zur Umkehr, zum Abschluss und zur Heilung dieser Gestalt gesucht. Die Auflösung des Traumas beinhaltet die sinnliche Zugänglichkeit der auslösenden Situation. Durch das bewusste Wiedererleben des Traumas und das damit verbundene innere Zusammenfügen, kann es verwandelt werden, transformiert werden und abgeschlossen werden. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Wieder-Erinnern oder -Erleben einzelner abgespaltener Aspekte. Ein Beispiel für diese Wiederholung ist Perls‹ Erleben der Ablehnung von Freud als Wiederholung der Ablehnung durch seinen Vater und in der Folge als eigene Ablehnung seines Sohnes Steve. Perls hatte das Konzept des oralen Widerstandes ausgearbeitet, um von Freud endlich die ersehnte Anerkennung zu erhalten, und hatte die 4000 km weite Reise aus Südafrika, wo er ein psychoanalytisches Institut aufgebaut hatte, auf sich genommen, um zur Präsentation seiner Hypothesen zu kommen. Perls (1981, 58f) beschreibt dies so: »Ich vereinbarte einen Termin, wurde von einer ältlichen Frau empfangen (ich nehme an, seiner Schwester) und wartete. Dann öffnete sich die Tür etwa einen Meter breit und da war er, vor meinen Augen. Es wirkte seltsam, dass er die Tür nicht verließ, aber damals wusste ich noch nichts von seinen Phobien. »Ich bin aus Südafrika gekommen, um einen Vortrag zu halten und um Sie zu sehen.« »Und wann fahren Sie zurück?« sagte er. Ich erinnere mich nicht an den Rest der (etwa vierminütigen) Unterredung. Ich war schockiert und enttäuscht. Einer seiner Söhne war beauftragt mit mir essen zu gehen. Ich hatte eine schnelle Schockreaktion erwartet, aber ich war lediglich wie betäubt.«
Komorbidität:
Die Folgen traumatischer Erlebnisse können eine Vielzahl psychiatrischer Störungsbilder wie Depressionen, Borderlinestörungen, Dissoziative Identitätsstörungen, Phobien, Panikstörungen, generalisierte Angststörungen, oder süchtiges Verhalten in unterschiedlichen Ausprägungen sein (Butollo, Hagl, Krüsmann 2003, 59f; Butollo & Hagl 2003, 13). Auch van der Kolk (2000) zählt als mögliche Folgen traumatischer Belastungen folgende Störungsbilder auf: Borderlinestörungen, Somatisierungsstörungen, Dissoziative Störungen, Selbstverstümmelung, Essstörungen. Für die Behandlung hat es entscheidende Auswirkungen, ob ein bestimmtes Verhalten als erklärbar und aus bestimmten Einwirkungen heraus entstanden gesehen wird oder ob es lediglich als verrückt angesehen wird.
Protektiv- und Vulnerabilitätsfaktoren
Aus der Entwicklungsforschung ist bekannt, dass die traumatische Verarbeitung bestimmter Erlebnisse von erlebtem Schutz oder erworbener und erlebter Verletzlichkeit beeinflusst wird. Diese Gegenspieler werden Protektiv- und Vulnerabilitätsfaktoren genannt. Wichtige Protektivfaktoren sind das Bestehen zumindest einer sicheren Bindung zu einem anderen Menschen, feinfühlige Erziehungspersonen, ruhiges Temperament, den vitalen Bedürfnissen entsprechende Lebensbedingungen, soziale Zugewandtheit, Wohlstand, Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Erfahrungen von Bewältigung schwieriger Ereignisse. Über den Zusammenhang zwischen Bindung und Trauma gibt Maragkos (2003) Aufschluss. Vulnerabilitätsfaktoren sind Geburtskomplikationen, besonders mit kurzfristigem Sauerstoffmangel des Gehirns, schwieriges Temperament, frühe unsichere und unzuverlässige Bindungs- und Beziehungserfahrungen, Armut, fehlendes Verständnis der Welt, Verlust wichtiger Bezugspersonen, Trennung der Eltern, Schulwechsel, Umzug/Migration, Krankheit, Behinderung, Arbeitslosigkeit. Als potenziell gefährdende Einflüsse können alle Formen kritischer Lebensereignisse angesehen werden.
Neurobiologische Grundlagen der PTSD
Traumatische Erfahrungen beeinflussen das Gedächtnis. Dies kann überdeutliches Erinnern oder aber auch das völlige Vergessen bestimmter Ereignisse zur Folge haben. Oft werden vor allem die sensorischen oder emotionalen Anteile der Ereignisse erinnert. Rauch (1996; in: van der Kolk et al. 2000, 215f) zeigte in einer Positronen-Emmissions-Tomographie, dass bei Traumaüberlebenden, die an das Trauma erinnernde Reize dargeboten bekamen, die Gehirnareale, welche für emotionale Zustände und vegetative Erregung zuständig sind, ganz besonders die Amygdala, stärker durchblutet waren. Gleichzeitig sank der Sauerstoffverbrauch im Broca-Areal, wo Worte für innere Zustände erzeugt werden. Dies kann als ein physiologischer Beleg der Sprachlosigkeit traumatischer Erfahrungen gelten. Weitere Untersuchungen zu Somatisierungsstörungen (van der Kolk et al., 181) und Substanzmißbrauch (ebd., 178) zeigten einen engen Zusammenhang zu Traumatisierungen in der Vorgeschichte. Saxe (1994, in: van der Kolk et al. 2000, 180) fand heraus, dass bei Abwesenheit schwerer Traumata in der Vorgeschichte Somatisierungsstörungen nur selten sind. Das deklarative oder explizite Gedächtnis ist für die Speicherung von Tatsachen und Ereignissen die der Betreffende erlebt hat, zuständig. Das prozedurale oder implizite Gedächtnis speichert Fähigkeiten; Gewohnheiten, emotionale Reaktionsweisen, Reflexhandlungen. Die Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Gedächtnisforschung weisen darauf hin, dass bei starken Emotionen und bei traumatischer Stresseinwirkung die Speicherung von Ereignissen und Tatsachen nicht stattfindet und das explizite Gedächtnis gestört wird. Dies erfolgt vermutlich durch eine Schädigung des für das explizite Gedächtnis verantwortlichen Hippokampus. Er wird durch die für ihn toxisch wirkenden Stresshormone geschrumpft und steht nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Dadurch wird das Erlebte zersplittert in sensorischen, emotionalen Bruchstücken gespeichert, oder in Handlungserfahrungen, die dann im enacting wieder nachgespielt werden. Die Betroffenen sind also in einen Schrecken ohne Sprache eingeschlossen, der in vollem Ausmaß wiedererlebt wird, zu dem aber kein Kontakt herstellbar ist. Dies hat für das psychotherapeutische Handeln größte Bedeutung, da es hier wichtig ist, einen Verständnisrahmen für das zu finden, was vorgefallen ist. Die Amygdala gilt als Schaltstelle für Gefühle im Gehirn zu anderen Verarbeitungsstrukturen und auch für die Weiterverarbeitung im Neokortex. Van der Kolk et al. (2000, 217) nehmen an, dass die Amygdala sich bei besonders starker Aktivierung durch bestimmte Reize von der subjektiven Wahrnehmung abkoppeln kann und sich daher intensive emotionale Reizung hinderlich auf eine angemessene Verarbeitung der Erfahrungen auswirken kann. Solange sich eine Person durch ihre eigenen Kräfte oder fremde Mächte beschützt und sicher fühlt, wird sie keine seelische Beschädigung erfahren. Sobald allerdings die Ohnmachtserfahrung eintritt, ist eine traumatische Verarbeitung der Ereignisse möglich. Diese besteht unter anderem in einer erhöhten Erregbarkeit und Suche nach möglichen Hinweisreizen für eine Wiederholung des Traumas. Diese vermeintlichen Auslöser werden dann im Zuge einer phobischen Abwehr (Butollo 1999, 96) vermieden. Eine weitere Schwierigkeit für traumatisierte Menschen ist, sich emotional neutralen, aber bedeutsamen Dingen zuzuwenden. McFarlane, Weber & Clark (1993, zit. nach van der Kolk 2000, 203) zeigten, dass es für Traumabetroffene schwerer ist, wesentliche, aber emotional nicht erregende Ereignisse von unwesentlichen, aber emotional erregenden zu unterscheiden, bzw. die unwichtigen Stimuli zu neutralisieren. Die Reaktion auf normale Ereignisse ist für traumatisierte Menschen offensichtlich schwieriger. Diese Schwierigkeiten der Emotionsregulation führen zu Problemen im Alltagsleben und zu einer verminderten Teilnahme am normalen Alltagsleben. Die dauerhaften Veränderungen neurophysiologischer Prozesse mit Übererregung, Überreaktionen auf Stimuli, Ängsten, Phobien, sozialem Rückzug mit Veränderungen der kognitiven und emotionalen Schemata sind Auswirkungen, die sich leicht verselbstständigen können. Van der Kolk et al. (2000) nennen die PTBS deshalb auch eine »biopsychosoziale Falle«. Damit ist gemeint, dass die neurophysiologische Beeinträchtigung bezüglich des Herunterregelns von Erregung die spontane Löschung der erworbenen Konditionierungen verhindert oder dass die Vermeidung innerpsychischer Auslöser die mit dem Trauma in Verbindung stehen wirksame Trauerarbeit verhindert. Die sozialen Beeinträchtigungen verhindern auch schützendes und heilendes Interaktionsverhalten mit anderen Menschen.
Verknüpfungen und Querbeziehungen zur Gestalttherapie – Wegbereiter und Wegbegleiter gestalttherapeutischer Traumatherapie
Goldstein: Angst als Katastrophenerwartung
Goldsteins Forschung an Kriegsverletzten des 1. Weltkrieges kann als eine erste klinische Anwendung gestaltpsychologischen Denkens auf konkrete klinische Probleme gesehen werden (vgl. Votsmeier 1995). Die Rehabilitation insbesondere Schädel-Hirn-Verletzter, aber auch die psychologische Begleitung und Aspekte PTSD-bezogener Symptome stand dabei im Vordergrund. Wichtig für hier ist die Angsttheorie von Goldstein. Angst wird hier als eine Erschütterung des Eingewoben-Seins des Organismus in das Umweltfeld gesehen. Goldstein schreibt über die innere Selbstverwirklichungstendenz des Menschen im Organismus-Umweltfeld, dass (1934, 58) »ein Organismus nur sein kann, wenn es ihm gelingt, in der Welt eine adäquate Umwelt zu finden, sie herauszuarbeiten, wozu natürlich die Welt die Möglichkeit geben muss. Und weiter … »beim kranken Menschen … besteht die Grundvoraussetzung der Existenz darin, dass er wieder eine adäquate Umwelt aus der Welt herauszuschälen vermag.« (ebd.). Goldstein (1934, 24) unterscheidet zwei Grundverhaltensweisen: … »geordnetes Verhalten mit dem Gefühl der Leichtigkeit, des Behagens, der Entspannung, Angepasstheit an die Welt, der Freude« im Gegensatz zu »katastrophalen Reaktionen, die sich als ungeordnet, wechselnd, widerspruchsvoll, eingebettet in Erscheinungen körperlicher und seelischer Erschütterung« (erweisen. … Der Kranke … befindet sich (dabei) in einem Zustand, der gewöhnlich als Angst bezeichnet wird. Goldstein (1934, 187f) definiert Angst in Anlehnung an Kierkegard und Heidegger als zusammenhängend mit dem »Nichts«. Goldstein formuliert: »Der Kranke erlebt eine Erschütterung im Bestande der Welt wie des eigenen Ich … Diese Erschütterung ist erlebnismäßig das, was wir Angst nennen.« Der Kranke hat nach Goldstein nicht Angst, »der Kranke ›ist‹ Angst. Die Angst tritt also dann auf, wenn die Verwirklichung der der Wesenheit eines Organismus entsprechenden Aufgaben unmöglich geworden ist. Das ist die Gefährdung bei Angst.« (ebd.) Furcht definiert Goldstein (1934, 191) als Angst vor der Angst und auf Objekte gerichtet, welche Angst eintreten lassen können. Goldstein unterscheidet: »Die Furcht stärkt die Sinne, die Angst macht sie unbenutzbar, die Furcht treibt zum Handeln, die Angst lähmt. Der Angst können wir nur entgehen, indem wir Furchtsituationen vermeiden.« (ebd.)
EMDR
Das EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) wurde von Francis Shapiro in der Arbeit mit Vietnamveteranen entwickelt. Auf die gestalttherapeutischen Wurzeln der Begründerin der EMDR-Therapie Francis Shapiro weist Hartmann-Kottek (2004, 38) hin, sowie auf die inhaltliche Ähnlichkeit zwischen dem EMDR-Ansatz und der Gestalttherapie. Bei der EMDR-Technik wird zuerst imaginativ ein Sicherheitszustand erzeugt, z.B. als sicherer Ort. Dann wird ein bewegter Reiz, meist die Hand des Therapeuten vor den Augen des Klienten, regelmäßig hin- und herbewegt, oder als Berührreiz rhythmisch dargeboten. Gleichzeitig soll in kleinen Zeiteinheiten das Trauma erinnert und in kleinen anschließenden Pausen stichwortartig darüber berichtet werden. Durch dieses erneute, kontrollierte und abgesicherte Durchlaufen des Traumas wird es laut EMDR-Theorie richtig verarbeitet und abgeschwächt. Insbesondere der supportive Anteil der EMDR-Therapie, die Stabilisierungstechniken, wie die innere Helfer-Technik sowie die Distanzierungstechniken, nennt Hartmann-Kottek »genuine Gestalttherapie«. Hartmann-Kottek schlägt für Gestalttherapeuten als Ergänzung das Erlernen der EMDR-Technik vor, sowie die Kenntnis von Indikation und Gegenindikation für die Traumaexposition, verbunden mit einem Gesamtverständnis der Traumaschutzmechanismen.
Reich / Levine
Wilhelm Reich mit seiner genauen Beschreibung und Fokussierung auf Körperprozesse bildet für aktuelle traumatherapeutische Ansätze eine noch immer relevante Basis. Der Körper oder Leib wird als Speicherort traumatischer Erfahrungen begriffen, aber auch als Medium des Zugangs zu versprengten und verschütteten Bruchstücken traumatischer Erlebnisse, sowie als Ort eines Teils einer möglicher Heilung und Integration der Erlebnisse. Fuckert (2002) stellt für den deutschsprachigen Raum eine traumazentrierte Psychotherapie in der Nachfolge Reichs vor, die gerade auch durch Levine inspiriert wurde. Einen der Gestalttherapie verwandten Ansatz legt der in Reichianischer Tradition stehende Traumaforscher Peter Levine (1998, 2005) vor. Bocian (2002, 91, 227f) stellt die interessante Hypothese auf, dass Reich auch bei der Entwicklung seines Ansatzes zur Auflösung von Muskelpanzern vom Motiv der Auflösung seiner eigenen, durch Kriegstrauma bedingten inneren Panzerung geleitet worden sein könnte. Auch Levine betont die wichtige Rolle des Körpers bei der Traumaentstehung. Er betrachtet posttraumatische Symptome als durch Angst unterbrochene physiologische Reaktionen (43), die zu einer Erstarrung oder Immobilität führen. Levine postuliert hier auch das Prinzip der offenen Gestalt, die nach Abschluss drängt. Dazu ist es nötig die Energie, die in der Erstarrung gebunden ist, zu transformieren (ebd., 44). Dazu bedarf es eines unterstützenden Umfeldes: »Wir brauchen die Unterstützung unserer Freunde und Verwandten sowie der Natur.« (ebd., 45) Zentraler Prozess ist bei Levine das Abschütteln des Traumas durch Zittern und Schütteln in Analogie zum Abschütteln der Schockstarre bei Tieren. Levine bezieht bei seiner Traumatherapie die Natur als eine wichtige, uns unterstützende Matrix ein. Dabei benennt er schamanistische Heilungsansätze, die die Wechselwirkung zwischen Natur, der sozialen Gemeinschaft und den Symptomen und Reaktionen des Betroffenen beachteten und nutzen, als eine der Quellen seiner Therapie (ebd., 66, 69). Eine ähnliche Herangehensweise der Integration von schamanistischem, gemeinschaftsorientiertem und naturbasiertem Herangehen liegt auch von St. Just (2005) vor, mit einer stärkeren Betonung feministischer und weiblicher Heilungsperspektiven. Diese Ansätze können als Ausarbeitung ursprünglich gestalttherapeutischer Ansätze genutzt werden. Die Projekte des Gestaltkibuzz bzw. der therapeutischen Gemeinschaften von Fritz Perls an Orten unzerstörter Naturschönheit weisen in eine ähnliche Richtung.
Levine nennt seinen Ansatz »Somatic Experiencing«. Dabei sollen die verloren gegangenen und zersplitterten Teile der Existenz reintegriert werden, ausgelöst durch den starken Wunsch, die Ganzheit wieder zu erreichen. Darin wird durch körperliche Gewahrseinsübungen wie z.B. bewusst sich sanft berühren, duschen oder abklopfen versucht, wieder ein ganzheitliches Körpergefühl herzustellen. Dies hilft, das innere Empfinden als ganzheitliches inneres Gewahrsein zu entwickeln. Wenn dies einigermaßen eingeübt ist, werden klassische Wahrnehmungsübungen wie aus dem Praxisteil von Gestalttherapie eingesetzt (PHG, 1951; das Grundlagenwerk von F. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, (1951/2006) als auch die drei Autoren werden mit PHG wiedergegeben. Wenn nicht ausdrücklich vermerkt, ist damit die Neuübersetzung von 2006 gemeint). In aufeinander folgenden Übungsschritten werden nun einzelne traumatypische Reaktionen identifiziert. Levine betont, dass auf kathartische Lösung ausgerichtete Therapien weniger wirkungsvoll seien und oft Retraumatisierungen auslösen können (ebd., 19). Mittels des gelernten inneren Erlebens wird das traumatische Ereignis in der therapeutischen Situation wieder erlebt und kann danach abgeschüttelt werden.
Traumakompetente Konzepte und Modelle der Gestalttherapie
Traumatherapeutisches Verständnis in PHG
Nicht nur die persönlichen Biographien der Gründer der Gestalttherapie sondern auch die inhaltliche Formulierung des Gründungsbuches »Gestalttherapie« sind geprägt durch die Auseinandersetzung mit der Thematik traumatischer Verarbeitung. Dies ist unter anderem der wenn auch abgrenzenden Orientierung an der Freudschen Neurosenlehre und Ätiologie geschuldet, aus der heraus sich die Gestalttherapie gerade entwickelte. Innerhalb der Psychoanalyse war bekanntermaßen die Entstehung von Neurosen ursprünglich auf ein traumatisches Erlebnis zurückgeführt worden, eine Position, die Freud von Janet und Charcot übernommen hatte, später aber abschwächte und revidierte (Streeck-Fischer, Sachsse & Ökzan 2001, 12). Im Folgenden werden nun die für eine Traumatherapie entscheidenden Begriffe herausgearbeitet. Diese Beschreibungen wurden von PHG nicht explizit für Traumatherapie entwickelt, sondern eher für eine »normale« Neurosentherapie. Und doch ist Gestalttherapie mit Beschreibungen traumatischer Konstellationen reich ausgestaltet und voll tiefen Verstehens traumatheoretischer Prozesse. Gerade die Zeit der Entstehung von Gestalttherapie ist eine zutiefst von den Traumata zweier Weltkriege geprägt Epoche gewesen.
Schöpferische Anpassung
Wir glauben, dass die Konzentration auf eine gegenwärtige Angelegenheit, … zu einer Gestalt führt, die ein tatsächliches Problem löst. (PHG 2006, 47) Diese schöpferische Anpassung wird durch die organismische Selbstregulation vorangetrieben, bzw. ist Ausdruck dieser. PHG schreiben dazu: Wenn man die Dinge sich selbst überlässt, regulieren sie sich auf spontane Weise selbst, und … tendieren …dazu, sich wieder zu korrigieren«. (PHG, 48) Sie können »zu etwas Wertvollem führen«. In diesem Sinne kann beispielsweise die künstlerische Ausdrucksgebung einer Niki de SaintPhalle angesehen werden, oder das hohe soziale Engagement von Menschen, die traumatische Erlebnisse überstanden haben, wie Nelson Mandela. Dort bildete sich zum Teil aus den traumatischen Erfahrungen heraus die Triebfeder ihres wertvollen sozialen Engagements, bzw. dieses soziale Engagement ermöglichte das Weiterleben nach den traumatischen Ereignissen. Menschen, die diese Art der Transformation traumatischer Erfahrungen vollziehen konnten, sind jedem bekannt und üben eine ermutigende Leuchtkraft aus. Die Perls’ selbst, deren Familien teilweise in Konzentrationslagern verschwanden, sind ein Beispiel dafür. In diesem Sinne kann die Gestalttherapie auch als Transformationsleistung traumatisierter Analytiker angesehen werden. Schöpferische Anpassung wird als wesentliche Funktion des Selbst angesehen. »Aber wenn man einmal die schöpferischen Funktionen der Selbstregulation, die für das Neue, für die Zerstörung und Neuintegration der Erfahrung offen sind – wenn man diese einmal ausgelöscht hat, dann bleibt nicht mehr viel übrig, was als Grundlage einer Theorie des Selbst dienen könnte« (PHG, 49). Bedeutsam für die Traumatherapie ist auch der Umgang des Klienten mit Widerstand. Hier versuchen PHG »… den Horizont der Bewusstheit und des Risikos zu vergrößern und es dem Selbst zu erlauben, seine eigene kreative Synthese zu finden …« (PHG, 53).
Wiederaneignung und Identifizierung
Der Klient muss sich die abgesprengten Teile seiner Selbst und seines Lebens wieder aneignen, und die in ihnen liegende Kraft sich wieder zu eigen machen. »Wenn die Vergangenheit des Patienten während der Behandlung wiederentdeckt wurde, muss er sie schließlich als seine eigene Vergangenheit annehmen. Wenn er sich in seinem zwischenmenschlichen Verhalten anpasst, muss er in der sozialen Situation selbst zum Handelnden werden. Wenn sein Körper dazu animiert wurde, lebendig zu reagieren, muss der Patient spüren, dass er es ist, nicht sein Körper, der dies vollzieht.« (PHG, 53)
Kontakt und Unterbrechung
»… im Kontaktgeschehen gibt es nur die Einheit einer die Perzeption anregenden Bewegung, die emotional eingefärbt ist« (PHG, 63). Bei traumatischen Erlebnissen wird dieses Kontaktgeschehen als sehr unangenehm erlebt, der Mensch möchte am liebsten aus der Situation verschwinden, aus dem Felde gehen, nicht dasein, sich nicht spüren. Genau dies wird dann psychologisch z.T. auch gemacht als Dissoziation, während die Person leibhaftig aber in der Situation bleiben muss. Die Dissoziation ist in gestalttherapeutischem Sinne die völlige Unterbrechung des Kontaktes, das Rausgehen aus dem Kontakt, bzw. die Abspaltung des Erlebten als nicht zu sich gehörig. Ein kleines Beispiel für alltägliche Dissoziationen ist das Warten in einer Schlange, wo sich viele Menschen gedanklich an einen völlig anderen Ort versetzen. In Notsituationen gibt es die Schutzfunktionen der sensiblen Oberfläche (65), die in subnormalen oder supernormalen Formen auftreten: »panische Flucht, Schock, Betäubung, Bewusstlosigkeit, Totstellen, partielles Blackout, Amnesie«. (65) »Diese Formen beschützen die Grenze, indem sie sie zeitweise desensibilisieren oder paralysieren und darauf warten, dass die Gefahr vorbei geht. Andererseits gibt es Mittel, die die Spannung abfangen, indem sie die Grenze selbst durch Anteile der Spannungsenergie in Bewegung setzen, beispielsweise durch Halluzination und Traum, lebhafte Imagination, Zwangsgedanken, Grübeln und damit einhergehende Rastlosigkeit. Die subaktiven Mittel scheinen geeignet zu sein, die Grenze vor Überflutungen aus der Umwelt zu schützen, indem sie die Gefahr ausschließen; die superaktiven Mittel haben eher mit propriozeptiver Überlastung, die die Energie abschöpft, zu tun – außer man fällt in Ohnmacht, wenn der Gefahrenpunkt bei Not und Krankheit erreicht ist« (PHG, 65).
»An der Kontaktgrenze gibt es diese beiden Prozesse zur Bewältigung von Notfallsituationen: Auslöschen und Halluzinieren. (





























