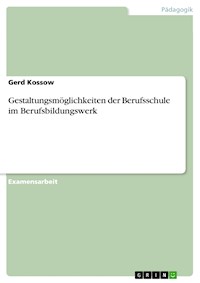
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich Pädagogik - Berufsbildung, Weiterbildung, Note: sehr gut, Landesprüfungsamt für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen, Dortmund, Sprache: Deutsch, Abstract: Im dualen Berufsausbildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland stellen die Berufsbildungswerke als Ausbildungsorte für Behinderte und Lernbeeinträchtigte die Sonderform dar, die wohl am weitestgehendsten versucht, eine institutionelle Verbindung der Lernorte "Betrieb" und "Schule" zu erreichen. Ähnlich eng dürfte die Verbindung der beiden Ebenen allenfalls in den wenigen Betrieben mit eigenen Betriebsberufsschulen bzw. bei den Schulen des Bergbaus sein. Ihre Begründung fand diese "Sonderform" in dem Bestreben, im Rahmen der Ausbildungsmöglichkeiten, die seit 1969 eine gesetzliche Regelung im Berufsbildungsgesetz gefunden hatten, auch für Behinderte qualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen und so zu deren Integration ins Berufsleben beizutragen. Mit Dreisbach kann das 1970 vom Bundesarbeitsminister Walter Arendt verkündete "Aktionsprogramm zur Förderung der Rehabilitation von Behinderten" als die inhaltliche Grundlage gesehen werden, aufgrund derer es zur Planung des Netzes der - zunächst 42, seit dem deutschen Einigungsprozeß 49 - Berufsbildungswerke kam. Im Zuge dieser Planung wurde im Hinblick auf die bestmögliche Integrationschance der Betroffenen die Entscheidung zugunsten einer engen Anbindung der beruflichen Bildung Behinderter an die Regularien des dualen Systems getroffen. Gleichzeitig wurde betont, daß die dort vorgesehene strikte Trennung der Lernorte den besonderen Bedürfnissen bei der Ausbildung dieser Zielgruppe nicht gerecht werden würde und daraus die "Notwendigkeit eines schulischen Ausbildungsteils in den Berufsbildungswerken" (Dreisbach, a.a.O.) abgeleitet. Dies brachte von vornherein institutionelle Schwierigkeiten mit sich. "Der Bund als Koordinator und Initiator mischte sich hier in eine Angelegenheit, die eine Sache der Länder war und auch später für einzelne Einrichtungen viel Unangenehmes brachte, da einige Länder die Schulen wie allgemeine Privatschulen behandelten, obwohl sie von der Aufgabenstellung her anders gelagert waren." Andere Länder wiederum verzichteten ganz auf die Einheitlichkeit der Träger und gliederten öffentliche Schulen bzw. Teile öffentlicher Schulen den Berufsbildungswerken an. In allen Fällen gibt es wesentliche Strukturmerkmale, die die Schulen in und an Berufsbildungswerken1 von den allgemeinen Berufsschulen unterscheiden. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Gestaltungsmöglichkeiten der Berufsschule im Berufsbildungswerk
Schriftliche Hausarbeit
im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik dem Staatlichen Prüfungsamt Dortmund vorgelegt von Gerd - Friedrich Kossow
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zur Entstehung und Geschichte der Berufsbildungswerke und der mit ihnen verbundenen Schulen
2.1. Die Diskussion über das duale System der Berufsausbildung im Vorfeld des Berufsbildungsgesetzes
2.2. Die Thematisierung der beruflichen Integration von Behinderten in den 60er und 70er Jahren
2.3. Zur Geschichte der Berufsbildungswerke
2.3.1. Die Entstehung der Berufsbildungswerke und die Schaffung einer rechtlichen Grundlage
2.3.2. Gemeinsame Charakteristika
2.3.3. Die Ausdifferenzierung des Systems in den 70er und 80er Jahren
2.3.4. Veränderungen nach der Integration des Bildungssystems der DDR
2.3.5. Kritik der Konzepte - alternative Vorstellungen
2.4. Zusammenfassung
3. Berufsschulen in und an Berufsbildungswerken - ein Schultyp eigener Prägung?
3.1. Ausbildung im dualen System in einer Institution - ein Paradox?
Page 2
3.2. Der Stellenwert und das Zusammenspiel einzelner Teilsysteme im Zusammenhang des Berufsbildungswerkes
3.3. Die Berufsschule als Teil des Berufsbildungswerkes
3.3.1. Trägerschaft, dienstliche und fachliche Aufsicht
3.3.2. Die Rolle der Gesamtleitungen und der Träger
3.3.3. Kooperation im Berufsbildungswerk
3.3.3.1. Kooperation auf der Leitungsebene
3.3.3.2. Die Zusammenarbeit bei der Konzeptionsentwicklung
3.3.3.3. Die Zusammenarbeit bei der didaktischen Planung
3.3.3.4. Die Zusammenarbeit bei der Planung von Erziehungsmaßnahmen im Einzelfall
3.3.4. Die Berufsschule in der Sicht der anderen Abteilungen
3.3.4.1. Leitungsebene
3.3.4.2. Mitarbeiter- / Mitarbeiterinnenebene
3.3.5. Die Veränderung der Einbettung und Abgrenzung des Subsystems Berufsschule im Berufsbildungswerk im Entwicklungsprozeß der Berufsbildungswerke
3.4. Die Berufsschule im Berufsbildungswerk als Schule - ihre Verankerung im Schulsystem
3.4.1. Das "Programm" der Schulen im Berufsbildungswerk -Lehrpläne, Richtlinien und sonstige Arbeitsprogramme
3.4.1.1. Die vorläufigen Richtlinien in Nordrhein - Westfalen als Beispiel für institutionalisierte Zielsetzungen der Berufsschulen in Berufsbildungswerken
3.4.1.1.1. Das Spannungsfeld zwischen sonderpädagogischer und berufspädagogischer Zielsetzung
3.4.1.1.2. Allgemeinbildender und berufsbezogener Bildungsauftrag der Berufsschule im Berufsbildungswerk
3.4.1.2. Kenntnisvermittlung im "Lernfeld" Berufsschule und im "Lernfeld" Ausbildungswerkstatt
Page 3
3.4.2. Gewachsene Profile der Schulen
3.4.3. Der pädagogische Auftrag der Berufsbildungswerke und die Zielsetzung der Berufsschule vor dessen Hintergrund
3.4.3.1. Die Rolle der Berufsausbildung als Zertifizierungsinstrument
3.4.4. Zielbestimmungen und Profile der Schulen in den Berufsbildungswerken als Systembedingungen
3.5. Die personellen und materiellen Arbeitsbedingungen an den Berufsschulen in Berufsbildungswerken
3.5.1. Die äußeren Rahmenbedingungen
3.5.1.1. Klassengrößen und Unterrichtsversorgung
3.5.1.2. Die räumliche und technische Ausstattung
3.5.1.3. Materielle Ressourcen als Systembedingungen
3.5.2. Die Lehrkräfte in den Berufsschulen in Berufsbildungswerken
3.5.2.1. Der berufliche Hintergrund der Lehrkräfte
3.5.2.2. Lehrkräfte an der Berufsschule im Berufsbildungswerk -Berufs- und/oder SonderpädagogInnen?
3.5.2.3. Besondere Anforderungen, die an Lehrkräfte in Berufsbildungswerken gestellt werden
3.5.3. Kooperation innerhalb der Lehrerkollegien
3.5.4. Die Problematik der arbeitsrechtlichen Stellung der Lehrkräfte in Schulen an Berufsbildungswerken
3.5.5. Die Arbeitsbedingungen innnerhalb der Berufsbildungswerk - Schulen als Systembedingungen
3.6. Berufsschulen in Berufsbildungswerken und allgemeine Berufsschulen - Gemeinsamkeiten und Differenzen
3.7. Prüfungen, Abschlüsse und Leistungsnachweise als limitierende und determinierende Faktoren
3.8. Zusammenfassung und Bewertung
Page 4
4. Die besonderen Gestaltungsspielräume der Berufsschule in Berufsbildungswerken unter dem Gesichtspunkt ihrer pädagogisch
- didaktischen Aufgabe
4.1. Pädagogische und zielgruppenbezogenene Aufgaben des Unterrichts in der Berufsschule im Berufsbildungswerk
4.1.1. Die besondere Lernsituation behinderter und sozial benachteiligter Jugendlicher in der Ausbildung
4.1.2. Behinderungsspezifische Besonderheiten in der Zielsetzung des Unterrichts an der Berufsschule im Berufsbildungswerk
4.1.3. Zum besonderen Verhältnis berufsbezogener und allgemeinbildender Unterrichtsinhalte an der Berufsschule im Berufsbildungswerk
4.2. Didaktische Handlungsspielräume in der Berufsschule im Berufsbildungswerk
4.2.1. Zielgruppenspezifische Einflüsse auf die didaktische Planung - die Handlungsziele der Schülerinnen und Schüler
4.2.2. Die Bedeutung der Einbindung in die Institution für die didaktische Planung
4.2.3. Didaktische Vorteile, die sich aus der Nähe zur Ausbildungswerkstatt ergeben
4.3. Zur Methodik des Unterrichts in der Berufsschule im Berufsbildungswerk
4.4. Die Bedeutung einzelfallbezogener Förderung
4.5. Didaktische Erneuerungen im Berufsbildungswerk
4.6. Die Berufsschule im Berufsbildungswerk - ein Schultyp mit eigener didaktischer Prägung?
5. Entwicklungsperspektiven der Berufsschulen in Berufsbildungswerken
5.1. Funktionale Vor- und Nachteile der Integration der Berufsschulen im Berufsbildungswerk
5.1.1. Der Stellenwert der Integration der Schulen in den
Page 5
Berufsbildungswerken in berufspädagogisch-didaktischer Hinsicht
5.1.2. Die Bedeutung der Integration der Schulen unter dem Gesichtspunkt eines ganzheitlichen Erziehungsprozesses
5.2. Entwicklungsmöglichkeiten der Schulen im Berufsbildungswerk
5.2.1. Perspektiven für die Verzahnung des Systems Berufsschule im Gesamtsystem Berufsbildungswerk
5.2.2. Perspektiven für das Berufsbild der Lehrkraft an einer Schule im Berufsbildungswerk
5.2.3. Duales System im Berufsbildungswerk - seine Bedeutung unter der Perspektive der Handlungsspielräume und der Entwicklungschancen von Schülerinnen und Schülern
5.3. Berufsbildungswerke und ihre Berufsschulen - ein Modell für Kooperation im dualen System?
5.4. Abschlußüberlegung -Alternative Entwicklungsmöglichkeiten der Berufsausbildung von Behinderten und Benachteiligten
6. Literaturverzeichnis
Abbildungen
Nr. Titel
1Beteiligung der Schulleiter an der Gesamtleitung des BBW
2Durchschnittliche Klassengrößen
3Kleinste und größte Klassen in BBW -Schulen
3Ausbildung der Lehrkräfte
Tabellen
Page 7
1. Einleitung
Im dualen Berufsausbildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland stellen die Berufsbildungswerke als Ausbildungsorte für Behinderte und Lernbeeinträchtigte die Sonderform dar, die wohl am weitestgehendsten versucht, eine institutionelle Verbindung der Lernorte "Betrieb" und "Schule" zu erreichen. Ähnlich eng dürfte die Verbindung der beiden Ebenen allenfalls in den wenigen Betrieben mit eigenen Betriebsberufsschulen bzw. bei den Schulen des Bergbaus sein.
Ihre Begründung fand diese "Sonderform" (Dreisbach) in dem Bestreben, im Rahmen der Ausbildungsmöglichkeiten, die seit 1969 eine gesetzliche Regelung im Berufsbildungsgesetz gefunden hatten, auch für Behinderte qualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen und so zu deren Integration ins Berufsleben beizutragen. Mit Dreisbach kann das 1970 vom Bundesarbeitsminister Walter Arendt verkündete "Aktionsprogramm zur Förderung der Rehabilitation von Behinderten" als die inhaltliche Grundlage gesehen werden, aufgrund derer es zur Planung des Netzes der - zunächst 42, seit dem deutschen Einigungsprozeß 49 -Berufsbildungswerke kam. (vgl.: Dreisbach 1986, S. 23f.) Im Zuge dieser Planung wurde im Hinblick auf die bestmögliche Integrationschance der Betroffenen die Entscheidung zugunsten einer engen Anbindung der beruflichen Bildung Behinderter an die Regularien des dualen Systems getroffen. Gleichzeitig wurde betont, daß die dort vorgesehene strikte Trennung der Lernorte den besonderen Bedürfnissen bei der Ausbildung dieser Zielgruppe nicht gerecht werden würde (vgl. Grupp 1975 zit. bei Dreisbach, S. 29) und daraus die "Notwendigkeit eines schulischen Ausbildungsteils in den Berufsbildungswerken" (Dreisbach, a.a.O.) abgeleitet. Dies brachte von vornherein institutionelle Schwierigkeiten mit sich. "Der Bund als Koordinator und Initiator mischte sich hier in eine Angelegenheit, die eine Sache der Länder war und auch später für einzelne Einrichtungen viel Unangenehmes brachte, da einige Länder die Schulen wie allgemeine Privatschulen behandelten, obwohl sie von der Aufgabenstellung her anders gelagert waren." (Dreisbach, S. 29) Andere Länder wiederum verzichteten ganz auf die Einheitlichkeit der Träger und gliederten öffentliche Schulen bzw. Teile öffentlicher Schulen den Berufsbildungswerken an. In allen Fällen gibt es wesentliche Strukturmerkmale, die die Schulen in und an Berufsbildungswerken1von den allgemeinen Berufsschulen unterscheiden. Sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die didaktischen Spielräume dieser Schulen unterscheiden sich an entscheidenden Punkten. Sie für die Schulen der Berufsbildungswerke zu beschreiben, soll in dieser Arbeit versucht werden.
Interessant erscheint dieser Versuch nicht nur unter dem Gesichtspunkt, daß eine gründliche
Page 8
Bestandsaufnahme die Voraussetzung für die Bestimmung und die Erweiterung institutioneller Handlungspielräume für die in diesem System Tätigen ist, sondern auch unter dem, daß, unter problematischer werdenden Ausbildungsbedingungen auf dem allgemeinen Ausbildungsmarkt, wesentliche Reformen des dualen Ausbildungssystems zu erwägen sind. Der Kooperation in den Berufsbildungswerken könnte dabei ein gewisser Modellcharakter im Hinblick auf die Verzahnung von Schule und betrieblicher bzw. überbetrieblicher Berufsausbildung und besonderen Hilfsmaßnahmen zukommen. Konkrete Ansätze weisen auf die Möglichkeit und die Perspektiven einer stärkeren Vernetzung der verschiedenen Bereiche hin.2
Die Gründungsabsichten der Berufsbildungswerke waren, das deutete sich bei Dreisbach an, zunächst weniger im bildungspolitischen als vielmehr im sozialpolitischen Kontext begründet. Die Schulen hatten dadurch im Hinblick auf die Entwicklung des Konzepts "Berufsbildungswerk" zunächst einen eher marginalen Einfluß. Die Schulpolitik der Länder konnte insgesamt verhältnismäßig wenig Einfluß auf die Entwicklung dieser Systeme nehmen. Diese historische Grundbedingung prägt anscheinend bis heute die Arbeitsstruktur der Schulen in den Berufsbildungswerken und den Interpretationsrahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Systeme. Sie soll deshalb im folgenden Kapitel (Kap. 2) umrissen werden, bevor auf die interne Strukturierung der Berufsbildungswerke durch das duale System und den Stellenwert der Schulen in diesem Rahmen beschreibend näher eingegangen wird. (Kap. 3) Ausgangspunkt soll dabei die von Gerd Pfeiffer vorgetragene These sein, daß die Schulen in Berufsbildungswerken durch ihre Einbettung in den Zusammenhang der Berufsbildungswerke und ihre Verzahnung mit ihnen einen Schultyp eigener Prägung darstellen. In dieses Kapitel ist eine empirisch fundierte Darstellung der Arbeitsbedingungen in diesen Schulen eingebettet. Diese soll unter den Gesichtspunkten der äußeren Rahmenbedingungen institutioneller Art und der Kooperation innerhalb der Gesamtinstitution und innerhalb der Lehrerkollegien das Handlungsfeld umreißen, innerhalb dessen sich die unterrichtliche Arbeit dieser Schulen vollzieht. Im Anschluß an die beiden eher darstellenden Kapiteln werden die didaktischen Handlungsspielräume an den Berufsschulen in den Berufsbildungswerken als Kern ihrer Gestaltungsmöglichkeiten analysiert. Zu untersuchende Bedingungen sind dabei sowohl die behindertenspezifischen Aufgaben und Voraussetzungen der Berufsbildungswerke als auch die berufspädagogischen Anforderungen und der institutionelle Rahmen der Arbeit im Berufsbildungswerk, wie sie einerseits von deren Auftraggebern und den die Berufsbildung regelnden Institutionen gesehen werden und wie sie sich aus der Sicht der Mitarbeiter und
Page 9
Mitarbeiterinnen darstellen. Aus dieser Analyse heraus wird dann versucht, didaktische Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Diese umfassen sowohl mikro- wie makrodidaktische Aspekte, d.h. sowohl mögliche Veränderungen innerhalb der gegebenen institutionellen Bedingungen als auch denkbare institutionelle Veränderungen, die neue didaktische Formen ermöglichen (Kap.4)
Das abschließende Kapitel dient der Evaluation der gewonnenen Ergebnisse. Dabei geht es darum, aus der Analyse der gegenwärtigen Gestaltungsspielräume heraus den Stellenwert und die Angemessenheit einer dual organisierten Ausbildung für die Berufsausbildung bei besonderem pädagogischen Förderungsbedarf aus der Sicht verschiedener Beteiligter zu diskutieren und den Stellenwert der engen Einbindung des schulischen Anteils an die praktische Berufsausbildung zu bewerten. Dabei ist auch die bereits angesprochene Frage zu diskutieren, inwieweit die enge Verbindung von Schule und praktischer Berufsausbildung innerhalb des dualen Systems Modellcharakter haben kann und inwieweit am Beispiel der Schulen in den Berufsbildungswerken Grenzen einer solchen Kooperation deutlich werden. Einen besonderen Aspekt stellt dabei auch die Situation der Lehrkräfte dar. Die Bedeutung der Qualifizierung der Lehrkräfte in der beruflichen Bildung für "schwierige" Zielgruppen von Auszubildenden ist verschiedentlich hervorgehoben worden. (Dietrich 1992, S. 5ff., Kultusministerium NRW 1995, S. 12)) Dieser Aspekt wird deshalb im letzten Kapitel noch einmal aufgegriffen. Dabei wird sowohl die Situation der Schule und ihrer Lehrkräfte problematisiert werden, als auch die möglichen Perspektiven der Qualifizierung der Lehrkräfte.
Beim Versuch, ein in dieser Weise komplex eingebundenes Phänomen mit der Vielzahl der in ihm handelnden Personen und mit der Vielfalt der einwirkenden Faktoren einzuordnen und auf Gestaltungsmöglichkeiten hin zu befragen, ist zu klären, welche wissenschaftliche Zugangsweise dazu geeignet ist. Eine lediglich empiristisch vorgehende Zugangsweise würde zwar eine ganze Reihe von Einzelphänomenen an den Tag legen und deren Analyse, zu einem gewissen Grad auch im Wechselverhältnis, ermöglichen. Sie wird jedoch nur in Grenzen der Komplexität des Handlungsfeldes gerecht und vermag es kaum, Bedingungen für Veränderungen im System ohne weitere empirische Analyse zu benennen.. Eine ausschließlich handlungs- und sinnverstehende Analyse würde demgegenüber die Probleme in dem komplexen Handlungsfeld sehr stark individualisieren und die Analyse des Systems als Handlungszusammenhang vernachlässigen.
Im Gegensatz zu diesen beiden wissenschaftstheoretischen Modellen bieten solche Ansätze, die auf der Grundlage von systemtheoretischen Überlegungen menschliches Handeln im
Page 10
Handlungs-undUmweltzusammenhang begreifen, eine größere Möglichkeit, sich der Komplexität des Handlungsfeldes zu nähern und zugleich die individuellen Handlungsstrukturen im Blick zu behalten. Im Rahmen dieses Ansatzes bietet sich überdies die Möglichkeit einer wissenschaftssystematischen Klammer zwischen den organisationstheoretischen, pädagogisch-didaktischen und psychologischen Verstehensebenen, die es ermöglicht, individuelle pädagogische und institutionelle Gestaltungsspielräume unter den jeweils gegebenen instutionellen und ökologischen (hier im weiten Sinne verstanden als Lebensumwelt) Bedingungen zu erfassen und die Bedingungen von Veränderungen in den jeweiligen Systemen zu reflektieren. (Selvini Palazzoli, 1985; Speck, 1991) Diese Arbeit versucht somit dazu beizutragen, eine Theorie der Schule und des Unterrichts in diesem Arbeitsfeld zu konstruieren, die im Sinne Hilbert Meyers (1981, S. 219) vom Kopf auf die Füße gestellt ist, wenn er schreibt: "Grundlage für eine empirisch gehaltvolle Theorie des Unterrichts müssen die Handlungsvollzüge und Handlungsmöglichkeiten von Lehrern und Schülern im Unterricht sein." Diese sind immer auch eingebunden in den institutionellen und gesellschaftlichen Rahmen der Schule. Folgt man Hilbert Meyer (1981, S. 344f.), so ist das unterrichtliche Handeln und die Planung von Lernsituationen (im Anschluß an Fuhr 1979) abgesehen vom persönlichen Vorverständnis der Lehrkraft im wesentlichen davon abhängig,
welche Handlungsspielräume die Lehrkraft im Hinblick auf fachliche,
gesellschaftliche und institutionell - organisatorische Vorgaben hat und "welches Alltagsbewußtsein und welche Interessen die Schüler dem Thema entgegenbringen." (a.a.O.)
Früher als andere hat Meyer darauf hingewiesen, daß ein handlungsorientierter Unterricht die Chance bietet, Schülerinnen und Schüler stärker aktiv in das Unterrichtsgeschehen mit einzubeziehen und eigentätiges Lernen zu ermöglichen. Meyers Argumente für ein solches Vorgehen waren zunächst überwiegend unterrichtspragmatischer Art und gingen noch nicht näher auf handlungstheoretische Überlegungen ein.
Page 11
Ausgangspunkt für Meyers handlungsorientierten Didaktik - Ansatz, (von einer Theorie spricht er zu dieser Zeit (1980) bewußt noch nicht), ist der Leitbegriff der Schülerorientierung. Schülerorientierung bedingt nach Meyers Auffassung Handlungsorientierung. Im Hinblick auf die Umsetzung dieses didaktischen Programms sieht Meyer aber auch begrenzende Bedingungen, einerseits im Hinblick auf die Anforderungen der Fächer, die beispielsweise lehrgangsmäßiges Arbeiten unumgänglich machen, andererseits aber auch aufgrund der sozialen Bedingungen der Schule, die zum einen institutionell eingebunden ist, in der aber auch von den anderen Lehrern und Lehrerinnen, von Eltern und auch von Schülerinnen und Schülern ausgesprochen werden, die einer handlungsorientierten Arbeit entgegenlaufen. Meyer betont deshalb (1981, S. 347): "Wer handlungsorientierten Unterricht machen will, muß eine besonders gründliche und nüchterne Bedingungsanalyse vornehmen." Zu einer solchen Bedingungsanalyse beizutragen, ist ein Ziel dieser Arbeit. Es ist auch motiviert aus der täglichen Auseinandersetzung mit den besonderen Arbeitsbedingungen in der Schule eines Berufsbildungswerkes in den vergangenen neuneinhalb Jahren.





























