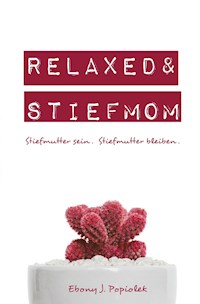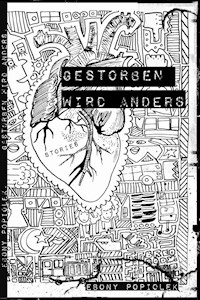
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ist ein Suizid bloß ein Ende mit Schrecken? Kann eine Beziehung das Ende der Liebe und eine Krankheit überdauern? Warum töten sich Brüder? Wovor fürchtet sich der Narzisst? Sind alle Opfer des heiligen Kriegs wirklich seine Opfer? Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Und: werden uns unsere Sünden vergeben? Diesen und anderen Fragen gehen die sieben Kurzgeschichten der Autorin nach, von kurzweilig über spannungsgeladen bis hin zu philosophisch spielt die Autorin mit der Bedeutung des "Sterbens" und regt durch zahlreiche Perspektivwechsel zum Nachdenken an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gestorben wird anders. Stories
Gestorben wird anders STORIESKARL. Die weiße DameSEBASTIAN. Der GraueSVEN. Trio InfernaleTHOMAS. Das BandKAI & ABDEL. BrudermordSEISMO & VAUX. Der TodeszugMARTHA. Schuld und SöhneINHALTEBONY. Die AutorinEbony J. Popiolek
Gestorben wird anders
STORIES
Impressum
© 2019 Ebony June Popiolek
Texte: Copyright by Ebony Popiolek Umschlaggestaltung: Copyright by Ebony Popiolek Illustration: Copyright by Ebony Popiolek Verlag: Ebony Popiolek Raabestraße 10 10405 [email protected]
epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für LillyPhantasie ist unsere Sprache
Die Nachrichten über meinen Todsind stark übertrieben.- Mark Twain
KARL. Die weiße Dame
Dr. Adebowale Abeo Achebe klopfte vorsichtig an die Tür. „Herr Zielinski?“ fragte er sanft im tiefen Bassbariton. Ich bat ihn einzutreten. Die Tür öffnete sich und ein trat der größte, dunkelhäutigste klinische Psychologe, den ich je gesehen hatte. Ich hatte ohnehin noch nie einen farbigen Psychologen gesehen und dieser hier war schwarz wie die Nacht. Seine Zähne und Augen strahlten im Kontrast dazu perlweiß. Der junge Mann, der mich mit seiner Feinfühligkeit und Klugheit immer wieder beeindruckt hatte, schob sich in mein plötzlich zu klein wirkendes Zimmer und blieb unmittelbar hinter der Tür stehen. Ich wusste, was er wollte, ließ mich jedoch nicht beirren. Ich packte in aller Seelenruhe weiter und ließ ihn warten. Er wollte etwas von mir, daher konnte er ruhig den Anfang machen. Doch Dr. Achebe beendete mein psychologisches Spiel nach wenigen schweigsamen Atemzügen, ehe es begonnen hatte. Er war kein Spieler. „Herr Zielinski, heute gibt es Hirschfilet zum Mittagessen“, begann er die Verhandlung um ein paar weitere Wochen meiner Zeit. Ich musste unwillkürlich lachen. „Und das bedeutet für mich was? Dass ich noch ein paar Monate bleiben soll, weil ich sonst das gute Klinikessen verpasse? Doktor – das ist mir tatsächlich gleichgültig.“ Dr. Achebe seufzte. „Na gut. Aber ich bin nur noch zwei Monate hier, ehe ich nach Nigeria fliege. Wir könnten die Zeit nutzen, um weiter zu reden. Wir könnten mehr Arbeit investieren, um zu…“. Ich drehte mich abrupt um und schaute meinem derart um mich besorgten Arzt ernst ins Gesicht: „Mein lieber Dr. Achebe, ich danke Ihnen für Ihre Mühe. Aber auch die Tatsache, dass ich von heute an unsere tiefschürfenden Diskussionen über das Wohl Afrikas und Europas verpassen werde, hält mich – bei allem aufrichtigen Bedauern – nicht von meinem Entschluss ab. Meine Papiere sind unterzeichnet. Ich bleibe nicht.“ Da fiel mein Blick auf das Buch, das er mir vor einiger Zeit geliehen hatte. „Da ist Ihr Toni Morrison Band. Warten Sie, ich gebe ihn zurück. Ein wirkliches bemerkenswertes Buch.“ Dr. Achebe hob die Hand. „Nein, behalten Sie es bitte. Es ist ein Geschenk. Vielleicht geben Sie es ja einmal Ihrer Frau zum Lesen?“ Er lächelte vielsagend. Ich schüttelte den Kopf. „Das wird sie vermutlich nicht. Meine Frau lernt nicht: sie weiß schon alles.“ Ich lächelte schief und wusste nicht, wen dieser Satz mehr beleidigte: meine engstirnige Frau, meinen intellektuellen Gesprächspartner oder mich. Plötzlich fühlte ich mich wieder hohl und leer, weil ich nun wieder an sie dachte. „Werden Sie denn heute gar nicht abgeholt?“ fragte Dr. Achebe. Ich wurde nicht schlau aus seinem indifferenten Tonfall und zuckte fast gleichgültig die Schultern. „Meine Frau kann mich nicht abholen. Sie sagt, sie arbeitet und möchte stattdessen von mir abgeholt werden. Meinen Sohn wollte ich nicht belästigen, er hat die Kleinen und seine Arbeit und genug um die Ohren…es ist schon gut so. Ich schaffe das allein.“ Ich zog den Reißverschluss meines kleinen Koffers zu. Das Buch verstaute ich achtsam in einer Seitentasche. Ich mochte die Ideen dieser Schriftstellerin, von der ich nie zuvor gehört hatte. In den heutigen Zeiten war es eine Bereicherung etwas zu lesen, das sich mit dem Ursprung unserer Konflikte beschäftigt. Die Herkunft der anderen – und das Erforschen unserer eigenen Wurzeln. Das Fremde wirkt demnach bedrohlich, weil wir mit einer bisweilen fatalen Unkenntnis unserer eigenen Fremdheit leben. Spannende Gedanken. Ich überlegte, das Buch daheim auf den Schreibtisch meiner Frau zu legen, ins Arbeitszimmer, damit sie es auch sicher fände. Ich stellte mir vor, wie sie es nehmen und nicht verstehen würde. Weder den Einband, noch den Titel, noch den Inhalt. Sie würde es in Händen drehen und wenden. Und dann – vielleicht – wegwerfen. Oder aussortieren. In eine Kiste voll der Bücher, die an den Gedankenkliffs meiner Frau ungelesen zerschellt waren. So ähnlich wie ich. „Ich habe auch ein Geschenk für Sie“, fiel mir da ein und ich beeilte mich, es zu finden. Der letzte Nietzsche. Ich reichte dem dunklen, ruhigen Mann die Ausgabe. Ein weißes Buch, schmal und abgewetzt. Briefe. Ein Sonderdruck. Es gab nicht viele Exemplare. Ich hatte ihm daraus vorgelesen. „Die Hoffnung ist ein viel größeres Stimulans des Lebens als irgendein Glück“, zitierte ich den pathetischen Philosophen und freute mich, Überraschung auf dem Gesicht meines ebenholzfarbigen Arztes zu sehen. Naturgemäß sträubte er sich zuerst, das Geschenk anzunehmen. „Das ist doch Ihr ständiger Begleiter gewesen! Und ein Sammlerstück, das haben Sie selbst gesagt. Mit Anmerkungen von Rudolf Steiner. Es muss unglaublich wertvoll sein. So etwas gibt man doch nicht weg!“ Ich lächelte. Das waren die Worte, die jeder hören wollte, der spontan einen kleinen Schatz verschenkte. „Doch doch, ich möchte, dass mein Nietzsche Ihnen gehört. Er ist doch ein noch interessanterer Patient als ich. Vielleicht werden Sie durch ihn schlauer, als Sie es ohnehin schon sind.“ Dr. Achebe starrte mich für einen Moment ungläubig an. Der kleine Nietzsche hatte seit meiner Ankunft hier stets in meiner Brusttasche gesteckt. Er war mein Freund gewesen, mein Verbündeter. Ich hatte das Gefühl, ihn bis an sein Ende zu verstehen. Als wären wir Brüder im Geiste. Jedoch mit mir als dem Schwächeren von uns beiden. Ich beobachtete meinen Arzt, der das Buch ehrfürchtig in seinen riesigen Händen hielt und es vorsichtig mit seinen langen Fingern durchblätterte. „Sie haben hier Notizen drin“, bemerkte er und nahm ein paar Zettel heraus. Ich errötete schwach. „Das sind keine Notizen“, räusperte ich mich, „das sind Gedichte. Ich habe sie hier in den letzten Tagen geschrieben.“ Er reichte sie mir unaufgefordert, ohne Neugier. Nicht einmal einen kurzen Blick hatte er auf mein Handgeschriebenes geworfen. Das war so seine Masche. Reden: Das sollte immer ich. Der Patient. Ich nahm die vier Zettel und verstaute sie gefaltet an Stelle des Buches in meiner Hemdtasche. Über die Gedichte würde ich nicht mit ihm reden. Dr. Adebowale Abeo Achebe, dessen klangvollen Namen ich genauso gern dachte, wie sagte, beäugte mich von der Seite, schob das Buch aber endlich wortlos in den Kittel. Er verneigte sich. Der treue Neger, jagte es kurz durch meine Gedanken und ich schämte mich gleich dafür. Doch war er mir auf der Insel der Hoffnungslosigkeit, an der ich gestrandet war, wie ein Freitag vorgekommen. Mein einziger Freund auf einer Insel, die von Nichts umgeben war und von Nichts umgeben blieb, egal wie lang ich mich auf ihr aufhielt, egal wie viele Stunden ich mit ihm und den anderen Fachleuten hier philosophierte. Es gab kein Boot, das kommen würde, mich zu holen. Doch ich war kein Inselmensch. Deshalb ging ich, um mich dem Unbekannten am Rande der Insel zu stellen. „Sind Sie ganz sicher?“, fragte der junge Arzt, der mein Sohn hätte sein können, wäre ich ein beeindruckender afrikanischer Stammesführer gewesen. Ich fühlte so etwas wie Trotz, dass er es wagte, mich immer und immer wieder auf die Probe zu stellen. „Mein Entschluss steht“, sagte ich mit fester Stimme und nahm wie zum Beweis meinen Koffer in die eine und meine Jacke in die andere Hand. „Es geht mir gut genug, um zu gehen. Sie haben alles getan. Wir sind beide fertig hier.“ Als würde er offiziell kapitulieren, verneigte Dr. Achebe sich diesmal tief und reichte mir endlich seine Hand zum Abschied. Ich nahm und schüttelte sie. „Sie dürfen mich als Karl in Erinnerung behalten. Ich danke Ihnen für alles, Doktor…“. „Adebowale, Karl. Behalten Sie mich auch einfach als Adebowale in Erinnerung.“ Ich lachte. „Ade –Adebowale? Beim besten Willen zu schwer, um Sie einfach so zu nennen.“ Er lachte ebenfalls, ein tiefer Bass, der angenehm in meiner Brust vibrierte. „Sie erinnern mich an meinen Vater, Gott hab ihn selig“, sagte Adebowale. Das rührte mich sehr. „Sie sind ein guter Mann und ein guter Arzt“, ließ ich ihn wissen. Und leiser fügte ich hinzu: „Sie haben alles gegeben. Machen Sie sich keine Vorwürfe, dass ich gehe.“ Adebowale schüttelte den Kopf und öffnete die Tür für mich. „Na dann – eine lange Reise geht endlich zu Ende“, stellte ich fest, holte tief Luft und ging langsam den hell erleuchteten Flur entlang auf den Ausgang zu. Ich begegnete niemandem mehr. An der Pforte grüßte ich ein letztes Mal die Empfangsdame. Dann war ich draußen.
Das Wetter begrüßte mich milde mit freundlichen Sonnenstrahlen und nur wenigen Wolken. Ich schaute auf die Uhr. Meine Frau erwartete mich in einer Stunde in ihrer Buchhandlung. Aber ich würde sie nicht abholen. Berge können nicht zum Propheten wandern. Ich setzte meinen Weg also in Richtung Bahnhof fort, um den nächsten Zug nach Hause zu nehmen. Die Sonne schien hell und kräftig vom Himmel herunter. Die alten Backsteingemäuer der Klinik strahlten die Wärme ab und ich fühlte mich sonderbar umarmt von all der Wärme und dem Licht. „Karl Jürgen Zielinski, du bist ein freier Mann“, sagte ich zu mir selbst und fühlte neben der Leere eine Leichtigkeit, wie schon lange nicht mehr.