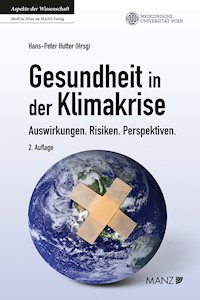
Gesundheit in der Klimakrise E-Book
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MANZ Verlag Wien
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Ratgeber der MedUni Wien
- Sprache: Deutsch
Der Klimawandel und seine Folgen für Körper und Seele
Die Wetterextreme häufen sich, auch in Mitteleuropa: Dürreperioden wechseln sich mit Überschwemmungen bisher unerreichten Ausmaßes ab und Hitzewellen treiben die Übersterblichkeit bei Risikogruppen in die Höhe.
Das Autoren-Team rund um Herausgeber und Mediziner Hans-Peter Hutter erläutert in verständlichen Worten, was die Begriffe Klima und Klimawandel tatsächlich bedeuten. Vor allem die vielfältigen Auswirkungen der Klimakrise auf Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen stehen dabei im Vordergrund.
- Krankheiten durch Klimawandel: Die physischen und psychischen Folgen
- Welche Personengruppen sind besonders von Gesundheitsrisiken betroffen?
- Wie trifft der Klimawandel Österreich im Speziellen?
- Geeignete Maßnahmen zum Klimaschutz, die Sie persönlich umsetzen können
- Welche neuen Infektionskrankheiten drohen durch die Folgen der Erderwärmung?
- Herausgegeben von Hans-Peter Hutter, Experte für Umweltmedizin
Über den vorausschauenden Umgang mit dem Klimawandel: Was kann ich tun?
Von der Wahl des Wohnorts bis hin zum bewussten Verzicht auf unnötige Ressourcenverschwendung – es gibt viele Wege, mit der Erderwärmung umzugehen. Zahlreiche Tipps und Informationen für die notwendigen Anpassungen an den Klimawandel finden Sie zusammengestellt in diesem Ratgeber. Gesundheit und präventive Schutzmaßnahmen stehen dabei ganz besonders im Fokus.
Wer ist besonders betroffen? Welche Vorkehrungen in Bezug auf Wetterextreme machen für jeden Einzelnen Sinn? Wie verhalten Sie sich richtig während einer Hitzewelle? Dieses Klimawandel-Buch richtet seinen Blick auf die medizinischen Auswirkungen der Krise und gibt praktische Ratschläge zum Umgang mit den entstehenden Gesundheitsrisiken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gesundheit in der Klimakrise
GESUNDHEIT IN DER KLIMAKRISE
Auswirkungen. Risiken. Perspektiven.
herausgegeben von
OA Assoz.-Prof. PD Dipl.-Ing. Dr. med. Hans-Peter Hutter
unter Mitarbeit von
Kathrin Lemmerer, Msc, Doz. Dr. med. Hanns Moshammer, Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Poteser, Priv.-Doz. Dr. med. Peter Wallner und MMag. Dr. Lisbeth Weitensfelder
2., aktualisierte Auflage
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr; eine Haftung der Autoren sowie des Verlages ist ausgeschlossen.
Die erste Auflage von Hans-Peter Hutter, Hanns Moshammer und Peter Wallner erschien 2017 unter dem Titel „Klimawandel und Gesundheit“.
Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise.
ISBN Print: 978-3-214-04244-8
ISBN E-Book: 978-3-214-25098-0
© 2023 MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Wien
Telefon: (01) 531 61-0
E-Mail: [email protected]
www.manz.at
Layout und Satz: www.petryundschwamb.com
Druck: FINIDR, s.r.o., Český Těšín
INHALT
Vorwort
Herausgeber und Autoren
1. UNSER KLIMASYSTEM
Einleitung
Wetter, Witterung und Klima
Gefühlte Temperatur und PET
Das Klimasystem
Klimavariabilität, Klimaschwankung und Klimawandel
Natürlicher und vom Menschen verursachter Treibhauseffekt
Argumente gegen Klimaskepsis
Interne Klimaschwankungen, externer Antrieb, Wechsel- wirkungen und Rückkoppelungen
Klimamodellierung
6. Bericht des IPCC
2. KLIMAKRISE IN ÖSTERREICH
Einleitung
Prognosen für Wien
Prognosen für Vorarlberg
Die Auswirkungen des Klimawandels
Gesundheit
Natürliche Ökosysteme/Biodiversität
Exkurs: Biodiversität, Klimawandel und Gesundheit
Wasserwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Energie
Bauen und Wohnen
Verkehrsinfrastruktur
Tourismus
Psychische Effekte der Klimakrise
3. GOING EXTREME
Hochwasser, Lawinen, Muren & Co.
Klimaflucht
Hitze und Kälte
Körpertemperatur
Temperatur im Jahresverlauf und Sterbefälle
Hitzewellen
Tipps zum Umgang mit Hitze
Weitere Maßnahmen zum Schutz bei Hitzewellen
Hitzeschutzpläne
Psychische Folgen von Extremwetterereignissen
Psychische Folgen von Naturkatastrophen
Psychische Folgen von Hitze
4. KLIMAWANDEL UND INFEKTIONSERKRANKUNGEN
Einleitung
Zecken
Stechmücken
Malaria in Mitteleuropa
Sandmücken
Weitere Infektionen
Infektionskrankheiten von Tieren
Psychische Folgen von Infektionskrankheiten
5. KLIMAWANDEL UND LUFTVERUNREINIGUNGEN
Einleitung
Luftschadstoffe und Klimawandel
Weitere Luftverunreinigungen
Ragweed, ein problematischer Profiteur des Klimawandels
COVID-19 und Luftverunreinigungen
Psychische Folgen von Luftschadstoffen
6. SCHUTZ DES KLIMAS UND ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL
Einleitung
Eine Gesundheit: One-Health-Konzept
Klimaschutz
Wer verursacht wie viele Treibhausgasemissionen?
Klimaschutz international und national
Die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Österreich
Herausforderung Klimapolitik
Anpassung an den Klimawandel
Grün in die Stadt
Psychische Aspekte des Klimaschutzes
Psychologische Grundlagen klimaschützenden Verhaltens
Empfehlungen für individuelles klimafreundliches Verhalten
7. TIPPS: WAS MAN SELBST TUN KANN
Klimaschutz
Seien Sie aus eigener Kraft mobil
Sparen Sie Autofahrten und Flüge ein
Reisen Sie sanft
Essen Sie weniger Fleisch
Kaufen Sie klimafreundlich
Verheizen Sie Ihr Geld nicht
Achten Sie auf den Wohnort
Erleben Sie Natur
Achten Sie auf Ihren Fußabdruck
Seien Sie ein Vorbild
Anpassung an den Klimawandel
Hitzewellen
Trockenperioden
Hochwasser und Muren
Schneelasten
8. NÜTZLICHE LINKS
Informationen zum Thema „Klima und Gesundheit“
Weitere nützliche Links
Verwendete und weiterführende Literatur
Bildnachweis
Stichwortverzeichnis
VORWORT
Bereits in der ersten Auflage dieses Buches (2017) haben wir festgestellt: „Keine Frage: Der Klimawandel ist da. Die Oberfläche der Erde hat sich in den letzten 130 Jahren im globalen Durchschnitt um 0,85°C erwärmt.“ In der Zwischenzeit muss von einer Klimakrise gesprochen werden, die zwar verstärkt von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dann jedoch wieder von anderen Problemen – Stichwort Corona – in den Hintergrund gedrängt wurde. Dabei stehen die verschiedenen Krisen, nicht zuletzt auch die Biodiversitätskrise, häufig auf komplexe Art und Weise in Zusammenhang.
Wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, werden wir in Zukunft noch öfter als heute mit Pandemien, internationalen Konflikten, Migrationswellen und Wirtschaftskrisen konfrontiert sein. Die Erderwärmung schreitet rasant voran. Laut aktuellem Bericht des Weltklimarates (2021) hat sich die Oberflächentemperatur inzwischen um rund 1°C (im Vergleich zu den Jahrzehnten vor 1900) erhöht und auch die Geschwindigkeit des Temperaturanstieges hat im letzten Jahrzehnt weiter zugenommen. Diskutiert wird zwar noch, wie stark der Klimawandel im Laufe dieses Jahrhunderts ausfallen wird, aber schon heute steht eindeutig fest, dass es weltweit massive Probleme in vielen Bereichen geben wird.
Für Mitteleuropa werden zunehmende Hitzewellen und Dürrezeiten, aber auch häufigere Starkregenereignisse mit Überschwemmungen prognostiziert. Die katastrophalen Hochwässer 2021, speziell in Deutschland, aber auch in Österreich, verdeutlichen, wie hart und teilweise unvorbereitet uns Hochwässer solcher Größenordnung trotz eines vergleichsweise gut aufgestellten Katastrophenschutzes treffen können. Die – mittlerweile schon ein wenig in Vergessenheit geratenen – Katastrophen in den Jahren 2002 und 2005 (Überschwemmungen) sowie 2003 (Hitzewelle), aber auch die Waldbrände und Dürren von 2022 sind ein Vorgeschmack auf die Folgen des globalen Temperaturanstieges.
Wir beschäftigen uns seit langem mit den gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise. Einerseits auf wissenschaftlicher Ebene, wo wir beispielsweise die Folgen von Hitzewellen auf Risikogruppen (ältere Menschen, sozial benachteiligte Personen) untersuchen. Andererseits unterstützen wir fachlich Entscheidungsträger, z. B. im Rahmen der „Nationalen Anpassungsstrategie an den Klimawandel“, und machen in Aussendungen, Vorträgen usw. auf die vielfältigen Folgen des Klimawandels aufmerksam. Auch dieses Buch soll, unter anderem, der Bewusstseinsbildung dienen.
Das ist dringend notwendig, denn das Bewusstsein rund um Klimawandel und Klimaschutz ist allgemein in der Bevölkerung nach wie vor nicht sehr hoch. Und das, obwohl die Daten aus dem 6. Weltklimabericht höchst alarmierend sind. Ein Grund für das mangelnde Bewusstsein liegt unter anderem darin, dass die gravierenden Folgen des Klimawandels von verschiedenen Interessengruppen, ja sogar von Entscheidungsträgern lange Zeit heruntergespielt bzw. verleugnet wurden – und teilweise immer noch werden.
Interessanterweise sind es oft eher weniger relevante Folgen, die die Bevölkerung aufhorchen lassen – Stichwort Tigermücke. Wenn diese Stechmückenart als Träger exotisch klingender Infektionserreger wie des Chikungunya-Virus nun auch vereinzelt in Mitteleuropa anzutreffen ist und dann auch noch in den Boulevardmedien groß abgebildet wird, herrscht eher Einsicht in puncto Klimaschutz, als wenn bei Hitzewellen ältere, kranke und/oder pflegebedürftige Menschen vorzeitig sterben. Hier erkennt man ein allgemeines Problem von komplexen, mehrschichtigen Bedrohungsszenarien: Es ist leichter, gegen einen klar erkennbaren Gegner zu mobilisieren als gegen einen Fehler im eigenen System.
Dass der Klimawandel für viele Menschen schon heute drastische Folgen hat, wird ebenso gerne negiert wie entsprechende Verpflichtungen durch internationale Abkommen (Paris), die auch von Österreich zum Schutz des Klimas mitunterzeichnet wurden. Wenn dann auf Grundlage dieser Abkommen z. B. vom österreichischen Bundesverwaltungsgericht entsprechende Maßnahmen eingefordert werden, führt dies zu Empörung in vielen Medien, bei Politik und Bevölkerung.
Durch Pandemie, Wirtschaftskrisen, Ukraine-Krieg und Teuerungen hat das Thema Klimaschutz zuletzt an Aufmerksamkeit verloren bzw. ist eine (teils auch nachvollziehbare) „Krisenmüdigkeit“ eingetreten. Allerdings können wir es uns nicht leisten, die dringend nötigen Maßnahmen weiter aufzuschieben.
Es sind jetzt nur noch kritische zehn Jahre, in denen die entsprechende Transformation gelingen muss, sonst schaffen wir die Begrenzung auf einen +2°C-Anstieg nicht und die +1,5°C schon gar nicht. Es ist eine der größten Aufgaben unserer Zeit, das Wasser steht uns sprichwörtlich bis zum Hals.
Die gute Nachricht: Wir wissen, was wir zu tun haben. Jetzt müssen wir dieses Wissen auch endlich umsetzen.
Im vorliegenden Buch werden zunächst die Begriffe „Klima“ und „Klimawandel“ erläutert. Im Anschluss stellen wir einige der vielfältigen (möglichen) Auswirkungen des Klimawandels auf die körperliche und psychische Gesundheit sowie das Wohlbefinden des Menschen dar.
Sie finden in diesem Buch also Antworten auf die Frage, welche Auswirkungen der Wandel des Klimas auf die menschliche Gesundheit haben kann – und diese gehen zumeist weiter als gedacht. Außerdem geben wir Antwort auf Fragen wie: Wer ist besonders betroffen? Welche Maßnahmen sollte ich prophylaktisch setzen, um bei extremen Wetterereignissen gerüstet zu sein? Wie verhalte ich mich richtig bei Hitzewellen?
Weiters finden Sie zahlreiche Informationen und Tipps zu Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel.
Zusätzlich sind zu einzelnen Themengebieten auch Beispiele weiterführender Literatur angeführt, falls Sie sich in manche Fragen weiter vertiefen möchten. Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen, dass Ihnen dieses Buch Nutzen bringt!
Hans-Peter Hutter, Kathrin Lemmerer, Hanns Moshammer, Michael Poteser, Peter Wallner und Lisbeth Weitensfelder
HERAUSGEBER UND AUTOREN
Herausgeber
OA Assoz.-Prof. PD Dipl.-Ing. Dr. med. Hans-Peter Hutter
ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Schwerpunkt Umwelt- und Präventivmedizin am Zentrum für Public Health der MedUni Wien sowie Landschaftsökologe und Landschaftsgestalter. Er ist Vorstand der österreichischen Sektion der International Society of Doctors for the Environment.
Autoren
Kathrin Lemmerer, MSc,
ist Biologin mit Schwerpunkt Ökologie, Natur- und Biodiversitätsschutz. Ihr besonderes Interesse im Bereich der Umweltmedizin liegt auf den Zusammenhängen zwischen Biodiversität und Gesundheit.
Doz. Dr. med. Hanns Moshammer
ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie und Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der MedUni Wien.
Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Poteser
ist Toxikologe, Zellbiologe und habilitierter Pharmakologe. Er beschäftigt sich mit entsprechenden Fragestellungen im umweltmedizinischen Bereich.
Priv.-Doz. Dr. med. Peter Wallner
ist freier Mitarbeiter an der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin des Zentrums für Public Health der MedUni Wien. Er ist Universitätslektor und freier Medizinjournalist.
MMag. Dr. Lisbeth Weitensfelder
studierte sowohl Psychologie als auch Betriebswirtschaft. Postgraduell absolvierte sie die Ausbildungen zur Klinischen und Gesundheitspsychologin sowie zur Arbeits- und Organisationspsychologin, ehe sie im Bereich der Naturwissenschaften promovierte. Sie ist als Umweltpsychologin und Postdoc-Wissenschaftlerin tätig.
Der Herausgeber und alle Autoren sind an der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin des Zentrums für Public Health der MedUni Wien tätig.
1. UNSER KLIMASYSTEM
Abb. 1: Mit dem Begriff „Klima“ werden Wetterzustände zeitlich – meist über 30 Jahre – zusammengefasst.
Das Klima ist ein komplexes System, das in diesem Kapitel näher dargestellt werden soll. Keinesfalls sollten „Klima“ und „Wetter“ verwechselt werden! Mit dem Begriff „Klima“ werden Wetterzustände zeitlich zusammengefasst (meist über 30 Jahre). Eine kühlere Woche im Sommer – das wäre ein Wetterzustand – bedeutet also nicht, dass der Klimawandel „abgesagt“ ist.
Im Folgenden werden die wichtigsten Begriffe und Grundlagen zu Wetter, Witterung und Klima erläutert. Es geht in diesem Kapitel etwa um Klimafaktoren, Klimaelemente und sogenannte Klimatreiber. Die Unterschiede zwischen Klimavariabilität, Klimaschwankung und Klimawandel werden erklärt. Abschließend findet sich ein kurzer Überblick zum Thema „Klimamodellierung“.
EINLEITUNG
Das Wort „Klima“ stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „neigen“: Aus dem Neigungsverhältnis der Erde zur Sonne, das sich mit der Erdrotation ändert, entstehen jahreszeitlich unterschiedliche Einstrahlungsverhältnisse. Wenn auf der Nordhalbkugel Sommer ist (Nordsommer), erhält sie mehr Sonnenstrahlen als die Südhalbkugel – während des Südsommers ist es umgekehrt.
Zwischen dem Äquator und den beiden Polen herrscht ein ausgeprägter Strahlungsunterschied, durch den sich große Temperaturunterschiede ergeben: Daher ist es am Äquator heiß und an den Polen kalt. Daraus resultieren Druckunterschiede, die – gemeinsam mit der Erdrotation und der Schwerkraft – Winde entstehen lassen.
Das Klima der Erde wird geografisch in verschiedene Klimazonen eingeteilt. Diese Einteilung erfolgt weitgehend nach den unterschiedlichen Strahlungsbedingungen. Diese haben wiederum Auswirkungen auf die Entwicklung von Faktoren wie Lufttemperatur und Niederschlag im Jahresverlauf.
Die wechselvolle Geschichte des Klimas und sein veränderlicher Charakter lassen sich heute anhand von Belegen in der Natur nachvollziehen (mithilfe von Jahresringen von Bäumen, fossilen Pollen oder Eisbohrkernen).
Die Grundlage für fossile Brennstoffe, die wir heute etwa in Form von Kohle und Erdgas nutzen und deren Verbrennung maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich ist, wurde schon vor etwa 300 Millionen Jahren gelegt. In diesem Zeitalter – dem Karbon – herrschten völlig andere klimatische und räumliche Bedingungen, die für uns heute nur schwer vorstellbar sind: Amerika und Europa befanden sich zu dieser Zeit in Äquatornähe. Diese Lage bedingte tropisches und schwül-heißes Klima, in dem Riesenfarne und Riesenschachtelhalme gedeihen konnten, die wiederum unsere heutigen fossilen Brennstoffe bildeten.
Abb. 2: „Klima“ stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „neigen“. Aus dem sich im Jahresverlauf ändernden Neigungsverhältnis der Erde zur Sonne ergeben sich die Jahreszeiten.
WETTER, WITTERUNG UND KLIMA
Um die komplexen Zusammenhänge betreffend Klima und Klimawandel gut zu verstehen, ist es hilfreich, die gängigsten Begriffe und ihre Definitionen zu kennen. Oftmals sind die Unterschiede zwischen den Begriffen „Wetter“, „Witterung“ oder „Klima“ nicht ganz klar. Wesentlich bei der Unterscheidung ist die Zeitspanne, um die es geht.
Von „Wetter“ wird gesprochen, wenn man jene Prozesse und Zustände betrachtet,
• die sich hauptsächlich in den unteren zehn Kilometern der Atmosphäre rasch ändern und
• sich auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen.
Zu den Prozessen und Zuständen der Atmosphäre zählen alle meteorologischen Größen (auch „Klimaelemente“ genannt) wie unter anderem Sonnenstrahlung, Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewölkung, Niederschlag oder Wind. Auch sogenannte zusammengesetzte Klimaelemente wie Verdunstung, Trockenheit, gefühlte Temperatur (PT) und physiologisch äquivalente Temperatur (PET) gehören dazu.
Die „Witterung“ erstreckt sich im Gegensatz zum Wetter über einen größeren Zeitraum, etwa über einen ganzen Tag, eine Woche oder eine Jahreszeit. Wetter und Witterung werden von großräumigen Wetterlagen bestimmt.
Mit dem Begriff „Klima“ werden Wetterzustände und Prozesse zeitlich zusammengefasst. Nach der Meteorologischen Weltorganisation (WMO) wird „Klima“ folgendermaßen definiert: „Das Klima ist die Synthese des Wetters über einen Zeitraum, der lange genug ist, um dessen statistische Eigenschaften bestimmen zu können.“ Üblicherweise wird dabei von einem Zeitraum von 30 Jahren ausgegangen.
Grundlegende statistische Eigenschaften, die untersucht werden, sind Mittelwert, Streuung, Extrema und die Häufigkeitsverteilung von meteorologischen Größen. Vor allem die Extrema – also extreme Wetterereignisse – haben hinsichtlich des menschenverursachten (anthropogenen) Klimawandels die größten Auswirkungen auf die Gesellschaft: Wenn Hitzewellen in Zukunft häufiger auftreten, ist dies von essenzieller Bedeutung für jeden Einzelnen und für die gesamte betroffene Volkswirtschaft.
GEFÜHLTE TEMPERATUR UND PET
Die Lufttemperatur wird in der Meteorologie nach vorgegebenen internationalen Richtlinien (strahlungsgeschützt, ventiliert) gemessen. Der Mensch ist jedoch einer Kombination von meteorologischen Größen ausgesetzt:
• Lufttemperatur,
• Strahlungsbedingungen,
• Windgeschwindigkeit und
• Luftfeuchtigkeit.
All diese Faktoren haben Einfluss auf die thermische Wahrnehmung. So bringt uns eisig kalter Wind bekanntlich zum Frösteln, während hohe Luftfeuchte sowie direkte Sonnenstrahlung uns schwitzen lassen. Körperliche Aktivität ist – ebenso wie Gewicht, Körpergröße, Geschlecht und Alter – wesentlich für das thermische Empfinden.
PET (physiologisch äquivalente Temperatur; physiological equivalent temperature) und PT (gefühlte Temperatur; perceived temperature) beziehen sowohl die meteorologischen als auch die thermophysiologischen Einflussfaktoren mit ein, wobei als Grundlage der Berechnungen ein „Modellmensch“ mit bestimmten definierten Eigenschaften dient (also eine „Standardperson“, die eine mittlere thermische Empfindlichkeit repräsentiert). Mit PET und PT lässt sich so die thermische Belastung für den Menschen sehr anschaulich darstellen. Allerdings werden damit nur Richtwerte geliefert, individuelle Faktoren können nicht berücksichtigt werden. Bei höheren PET-Werten liegt eine Wärmebelastung vor, während sich bei tieferen Werten Kältestress ergibt.
PET in °C
Thermisches Empfinden
Physiologische Belastungsstufe
4
sehr kalt
extreme Kältebelastung
8
kalt
starke Kältebelastung
13
kühl
mäßige Kältebelastung
18
leicht kühl
schwache Kältebelastung
20
behaglich
keine Wärmebelastung
23
leicht warm
schwache Wärmebelastung
29
warm
mäßige Wärmebelastung
35
heiß
starke Wärmebelastung
41
sehr heiß
extreme Wärmebelastung
Tabelle: Gegenüberstellung thermisches Empfinden, physiologische Belastungsstufe tagsüber und Bewertungsindex PET.
Auf der Website der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik kann man sich über die aktuelle gefühlte Temperatur informieren: www.zamg.ac.at
DAS KLIMASYSTEM
Die Atmosphäre ist die Lufthülle unserer Erde, in der das Wettergeschehen stattfindet. Sie ist aber nicht isoliert zu betrachten, sondern befindet sich in Wechselwirkung mit den anderen Komponenten des Erdsystems: mit Wasser und Eis, mit Leben und der festen Erde. Daher wird der Begriff „Klimasystem“ verwendet. Das Klimasystem umfasst die
• Atmosphäre,
• Hydrosphäre,
• Kryosphäre,
• Biosphäre und
• Geosphäre.
In dem System laufen komplexe Prozesse ab, die miteinander verwoben sind (siehe Abb. 3).
Wind und große Wasseroberflächen sind direkt verbunden: Wind regt die Oberflächenströmungen der Ozeane an – ein bekanntes Beispiel ist der Golfstrom, der für das bemerkenswert milde Klima an den Küsten Nordeuropas verantwortlich ist. Die Wetterphänomene „El Niño“ und „La Niña“ haben ihren Ursprung im tropischen Pazifik, wirken aber auf das globale Klima.
Überhaupt muss das Klimasystem gesamtheitlich betrachtet werden – insbesondere, wenn man sich auf längere Zeitskalen konzentriert, die Klimaschwankungen und den Klimawandel abbilden.
Abb. 3: Externe Klimatreiber, Klimasystem, Klimaänderung (Quelle: NOAA, leicht geändert).
Sogenannte externe Klimatreiber wirken von „außen“ auf das Klimasystem – sie beeinflussen das Klima, werden selbst aber nicht davon beeinflusst. Die Sonne und die Drift der Kontinente zählen etwa zu diesen externen Klimatreibern, aber auch Vulkanausbrüche sowie menschengemachte Treibhausgas- und Partikelemissionen (Aerosole) haben große Auswirkungen auf das Klima.
Betrachtet man das Klima der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte, wird der Zusammenhang zwischen Klimaveränderungen und äußeren Klimatreibern deutlich: Auf den Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im Jahr 1815 folgte 1816 das „Jahr ohne Sommer“ mit Missernten in weiten Teilen Europas. Während des „Maunder-Minimums“ der Sonnenaktivität 1645 bis 1715 sank die globale Mitteltemperatur um 0,5°C, der Winter 1708/1709 war der kälteste im Europa der letzten 500 Jahre. Global ist die Temperatur seit Beginn der Industrialisierung im Mittel um rund 1°C gestiegen, in Österreich bereits um rund 2°C.
Unter Klimafaktoren versteht man die räumlichen Randbedingungen, die Einfluss auf das Klima haben. Man unterscheidet dabei zwischen kleinräumiger, mittlerer und großräumiger Skala. So bewirken etwa die Land-Meer-Verteilung oder die Entfernung zu großen Wasserflächen entweder ein eher kontinentales oder eher ozeanisch geprägtes Klima (großräumige Skala). Die Ausrichtung von Gebirgen oder die Höhenlage einer Region wirken sich auf das Klima (mittlere Skala) ebenso aus wie Hangexposition, Hangneigung oder Eigenschaften des Untergrundes (kleinräumige Skala). Daran anknüpfend werden drei Klimagrößen unterschieden:
• Das Makroklima beschreibt das Klima einer größeren Region in einem Umkreis von ca. 1.000 bis 10.000 Kilometer (z. B. Kontinent),
• das Regional- oder Mesoklima bezieht sich auf ein Areal von einem bis etwa 1.000 Kilometer Umkreis, und
• das Mikroklima auf ein Areal von einem Kilometer und weniger.
Mit Klimaelementen





























