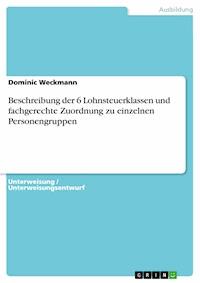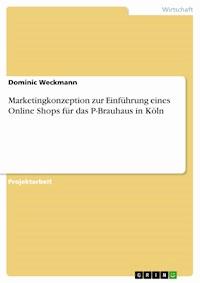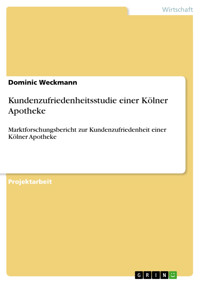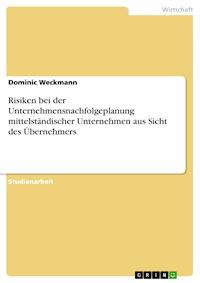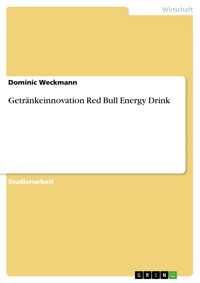
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing, Note: 1,7, Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln, Veranstaltung: Innovationsmanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Begriff Innovation ist ursprünglich aus dem lateinischen, abgeleitet worden aus den Wörtern novus bedeutet „neu“ und innovatio bedeutet „etwas neues schaffen“. „Innovation ist eine Idee oder ein Objekt, das von den Übernehmern als neu angesehen wird“, diese Meinung vertritt Everett M. Rogers. Eine etwas andere Definition macht Joseph Alois Schumpeter. Er definiert „Innovation als die Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung, nicht alleine ihre Erfindung“. Es wird deutlich, dass eine Innovation nicht einfach etwas Neues ist, das es so auf dem Markt noch nicht gegeben hat, sondern dass eine Innovation einige Voraussetzungen erfüllen muss, um wirklich als Innovation anerkannt zu werden. Oft werden Produkte ein wenig verändert, ob es das Design ist, die Verpackung oder ein kleines technisches Detail. Es ist wichtig zu erkennen, dass es sich in diesen Fällen nicht um eine Innovation handelt. Nicht jede Innovation schafft es tatsächlich auch bis zum Endverbraucher und nicht jede neue Idee schafft es tatsächlich sich durchzusetzen. Ein großer Teil von Ideen scheitert alleine bei der Umsetzung vom Kopf bis hin zum fertigen Produkt oder der Dienstleistung. In den vergangenen Jahrzehnten hat es eine ganze Reihe von Innovationen gegeben, einige erfolgreicher und einige weniger erfolgreich. Als ein Beispiel für eine erfolgreiche Getränkeinnovation wird in der folgenden Hausarbeit der Energy Drink von Red Bull erläutert. Zu Beginn wird die Red Bull GmbH, die Geschäftsidee und der Energy Drink kurz vorgestellt. Es folgt eine Erläuterung der vier Merkmale einer Innovation: Neuheitsgrad, Unsicherheit, Komplexität und Konfliktgehalt. Anschließend werden das Zieldreieck der Innovation und der Produktlebenszyklus eingehender betrachtet und es folgt ein abschließendes Fazit, das die Hausarbeit abrundet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Abbildungsverzeichnis
2 Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Red Bull GmbH
2.1 Unternehmensgründung
2.2 Die Geschäftsidee
2.3 Der Red Bull Energy Drink
3 Merkmale einer Innovation
3.1 Neuheitsgrad
3.2 Unsicherheit
3.5 Komplexität
3.3.1 Zeitliche Komplexität
3.3.2 Quantitative und Qualitative Komplexität
3.4 Konfliktgehalt
4 Zieldreieck einer Innovation
4.1 Ergebnis
4.2 Aufwand
4.3 Zeit
5 Produktlebenszyklus
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Website-Verzeichnis
1 Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zusammenhänge zwischen Merkmalen der Innovation
Abbildung 2 : Zieldreieck der Innovation
Abbildung 3: Produktlebenszyklus
2 Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
1 Einleitung
Der Begriff Innovation ist ursprünglich aus dem lateinischen, abgeleitet worden aus den Wörtern novus bedeutet „neu“ und innovatio bedeutet „etwas neues schaffen“.[1]
„Innovation ist eine Idee oder ein Objekt, das von den Übernehmern als neu angesehen wird“, diese Meinung vertritt Everett M. Rogers.[2] Eine etwas andere Definition macht Joseph Alois Schumpeter. Er definiert „Innovation als die Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung, nicht alleine ihre Erfindung“.[3]
Es wird deutlich, dass eine Innovation nicht einfach etwas Neues ist, das es so auf dem Markt noch nicht gegeben hat, sondern dass eine Innovation einige Voraussetzungen erfüllen muss, um wirklich als Innovation anerkannt zu werden. Oft werden Produkte ein wenig verändert, ob es das Design ist, die Verpackung oder ein kleines technisches Detail. Es ist wichtig zu erkennen, dass es sich in diesen Fällen nicht um eine Innovation handelt.
Nicht jede Innovation schafft es tatsächlich auch bis zum Endverbraucher und nicht jede neue Idee schafft es tatsächlich sich durchzusetzen. Ein großer Teil von Ideen scheitert alleine bei der Umsetzung vom Kopf bis hin zum fertigen Produkt oder der Dienstleistung. In den vergangenen Jahrzehnten hat es eine ganze Reihe von Innovationen gegeben, einige erfolgreicher und einige weniger erfolgreich.
Als ein Beispiel für eine erfolgreiche Getränkeinnovation wird in der folgenden Hausarbeit der Energy Drink von Red Bull erläutert.
Zu Beginn wird die Red Bull GmbH, die Geschäftsidee und der Energy Drink kurz vorgestellt. Es folgt eine Erläuterung der vier Merkmale einer Innovation: Neuheitsgrad, Unsicherheit, Komplexität und Konfliktgehalt. Anschließend werden das Zieldreieck der Innovation und der Produktlebenszyklus eingehender betrachtet und es folgt ein abschließendes Fazit, das die Hausarbeit abrundet.
2 Die Red Bull GmbH
2.1 Unternehmensgründung
Die Red Bull GmbH wurde im Jahr 1984 von Dietrich Mateschitz mit Firmensitz in Fuschl am See bei Salzburg /Österreich gegründet. Das Unternehmen Red Bull beschäftigte Ende 2008 in 148 Ländern 5.683 Mitarbeiter (Ende 2007: 4.613 in 144 Ländern).
In der Zentrale Fuschl am See werden die strategischen Entscheidungen getroffen und Leitlinien vorgegeben, Ideen entwickelt und Konzepte bis zur konkreten Umsetzung vorangetrieben. Alle sonstigen unternehmerischen Funktionen mit Ausnahme des Marketings werden outgesourct, das heißt Red Bull besitzt z.B. keine eigenen Produktionsstätten.
Nach der Verfeinerung der Rezeptur und der Entwicklung eines Marketingkonzepts wurde Red Bull 1987 im österreichischen Markt eingeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Europa keinen Markt für Energy Drinks und Red Bull stieß bei seiner Markteinführung auf viel Kritik, weil das Getränk als süchtig machend und gefährlich eingestuft wurde.
Die ersten fünf Jahre wurde das Produkt nur auf dem österreichischen Markt angeboten. Red Bull wurde in einigen Ländern erst nach etlichen klinischen Testreihen freigegeben und wurde 1992 auch nach Ungarn, Großbritannien, Deutschland und in andere europäische Länder exportiert. Mittlerweile wird der Energy Drink weltweit vertrieben - in erster Linie in Bars, Restaurants, Tankstellen und Diskotheken.
Red Bull hat im Geschäftsjahr 2008 seinen Unternehmensumsatz um 7,9 Prozent von 3,079 Mrd. Euro auf 3,323 Mrd. Euro gesteigert. Weltweit wurden 2008 ca. 4,016 Mrd. Dosen Red Bull verkauft, das bedeutet ein Plus von 13,2 Prozent gegenüber 2007.
Die Red Bull GmbH gehört zu 49 Prozent dem Unternehmensgründer Dietrich Mateschitz, weitere 49 Prozent halten der thailändische Geschäftsmann Chaleo Yoovidhya und zwei Prozent dessen Sohn Chalerm. Die Familie Yoovidhya ist demnach mit 51 Prozent zwar Mehrheitseigentümer des Unternehmens, mischt sich operativ aber nicht in die Geschäfte ein.
2.2 Die Geschäftsidee
Der Firmengründer Dietrich Mateschitz hat die Geschäftsidee seinen zahlreichen Geschäftsreisen als Marketing-Manager für Unilever nach Asien zu verdanken, wo er Energy Drinks 1982 kennen lernte, die dort seit den 50er Jahren von allen Bevölkerungsschichten konsumiert werden um gegen die Müdigkeit anzukämpfen.
Dort existierte damals ein Energy Drink namens „Krating Daeng“ („Red Bull“ auf Thailändisch), der sich großer Popularität erfreute. Der Marketing-Manager Dietrich Mateschitz erkannte zwei wesentliche Aspekte: Energy Drinks bieten einen über den herkömmlicher Erfrischungsgetränke hinausgehenden Konsumentennutzen, und für diese Produkte kann auch außerhalb Asiens ein Markt geschaffen werden. Mateschitz erwarb daraufhin vom thailändischen Getränkehersteller TC Pharmaceuticals die Lizenzrechte für die Vermarktung des Energy Drinks in Europa.[4]
Mateschitz versuchte dieses Produkt mit einem eigenen Produkt- und Verpackungskonzept an den europäischen Markt anzupassen. Dazu wurde eine Vielzahl von Marktforschungsuntersuchungen durchgeführt und es wurden mehr als 200 Verpackungsvorschläge getestet, bevor man sich für die blau-silberne Getränkedose entschied. Außerdem wurde das Getränk dem westlichen Geschmack angepasst, indem es verdünnt, der Koffeingehalt reduziert, die Inhaltsstoffe für den europäischen Markt adaptiert und Kohlensäure hinzugefügt wurde.[5]
2.3 Der Red Bull Energy Drink
Mit Red Bull wurde eine völlig neue Getränkekategorie geschaffen: der Energy Drink. Red Bull ist ein alkoholfreies Getränk, das in seiner Zusammensetzung und Wirkung absolut einzigartig ist. Die Inhaltsstoffe haben eine belebende Wirkung. Red Bull ist also ein Funktional Drink und wird zu Unrecht in der Nachbarschaft von Limonade, Cola und isotonischen Mineraldrinks angesiedelt.
Seit 2003 gibt es auch die zuckerfreie Variante Red Bull Sugarfree und man kam damit dem wachsenden Bedürfnis nach zuckerfreien und somit auch kalorienarmen Getränken entgegen.
Anfang 2007 wurde neben der bis dahin üblichen 250-ml-Dose auch eine größere 355 ml fassende Dose auf den Markt gebracht, wobei die hohe, schmale Form beibehalten wurde. Seit den frühen 1990er Jahren wird Red Bull auch in Flaschen angeboten.
Der Red Bull Energy Drink, meist auch nur Red Bull genannt, besteht aus den Inhaltsstoffen Taurin, Koffein, Pantothensäure, B-Vitaminen, Glucuronolacton, Sucralose, Glukose, Acesulfam K sowie Aspartam (in der zuckerfreien Variante). Laut Herstellerangaben soll das Getränk eine belebende Wirkung sowie leistungssteigernde Eigenschaften haben, die sich aus der Zusammensetzung seiner Inhaltsstoffe ergeben sollen.[6]
Sämtliche für Red Bull Energy Drink sowie Red Bull Sugarfree verwendeten Zutaten werden synthetisch hergestellt. Dadurch wird gleich bleibend höchste Qualität gewährleistet.
Red Bull erhebt den Anspruch, kein Soft Drink, sondern ein Energy Drink zu sein, der für Zeiten erhöhten Energiebedarfs entwickelt wurde. Aufgrund seiner Inhaltsstoffe verbessert Red Bull laut eigener Aussage Ausdauer, Wachsamkeit, Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit.[7]
3 Merkmale einer Innovation
Nach einer Definition ist eine „Innovation eine zielgerichtete Durchsetzung von neuen technischen, wirtschaftlichen, organisatorischen oder sozialen Problemlösungen, die darauf gerichtet sind, die Unternehmensziele auf eine neuartige Weise zu erreichen“.[8]
Es lassen sich 4 Merkmale einer Innovation erkennen (Abbildung 1)[9], diese werden nun im Einzelnen anhand des Beispiels des Energy Drinks von Red Bull beschrieben und erläutert.
Abbildung 1: Zusammenhänge zwischen Merkmalen der Innovation
3.1 Neuheitsgrad
Der Neuheitsgrad bezeichnet den Zustand eines Produktes oder einer Dienstleistung im Zusammenhang mit einer Innovation. Das Produkt muss sich in erster Linie von den bereits auf dem Markt existierenden Produkten deutlich unterscheiden und in der angebotenen Form zum ersten Mal in Erscheinung treten.
Als Red Bull 1987 in Österreich eingeführt wurde war dieser Energy Drink eine absolute Neuheit, die es in dieser Form in Europa noch nicht gab. Anfänglich musste Red Bull gegen ein ausgeprägtes Misstrauen ankämpfen. Nach dem Motto: Ist das vielleicht eine Droge, ist das überhaupt legal? Es gab auch Probleme mit der Zulassung von Red Bull, denn einige der Inhaltsstoffe galten als gesundheitsgefährdend. Doch das machte viele Menschen erst recht auf das Getränk mit dem Gummibärchen-Geschmack neugierig. Red Bull löste einen Hype aus und wurde schnell zum Kultgetränk.
Red Bull hat es geschafft, eine vollkommen neue Produktkategorie erfolgreich auf den Märkten der Welt zu etablieren und auch rund zwei Jahrzehnte später noch eine quasi-monopolistische Stellung innezuhaben. Der Energy Drink hat eine Bekanntheit von 93 Prozent und fällt durch sein markantes Design auf. Jeder erkennt eine Red Bull Dose, da man auf der ganzen Welt das gleiche Design verwendet, mit Ausnahme von einigen kleinen farblichen Veränderungen bei dem Produkt Red Bull Sugarfree bleibt die Firma ihrem Konzept treu. Das Symbol der zwei Bullen, mit der aufgehenden Sonne kennt die ganze Welt und ist neben dem Markenname eine gute Markierung.
Der Red Bull Energy Drink ist für den Kunden ein neues funktionelles Produkt, das eigens für Phasen erhöhter mentaler und physischer Beanspruchung entwickelt wurde. Red Bull unterstützt die Leistungsfähigkeit, regt den Stoffwechsel an, verbessert das subjektive Wohlbefinden, erhöht die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit und führt dem Körper rasch verwertbare Energie und zusätzliche Vitamine zu.[10] Das Produkt begann zu florieren, als Barkeeper und Discotheken-Betreiber davon überzeugt werden konnten, dass Red Bull als neuer Bestandteil für Mixgetränke geeignet war.
3.2 Unsicherheit
Der Faktor Unsicherheit ist bei jeder Innovation vorhanden. Dies hängt mit der Einführung des Produktes auf dem Markt zusammen. Ein Unternehmen hat keine Möglichkeiten bei relevanten Ereignissen auf Werte aus der Vergangenheit zurückzugreifen. Weder in subjektiver noch in objektiver Hinsicht. Es gibt keine statistischen Daten oder Erfahrungswerte, dass das Unternehmen als Hilfe heranziehen kann.[11]
Vor Produkteinführung des Energy Drinks herrschte Unsicherheit. Es gab Diskussionen über gesundheitliche Gefahren sowie langwierige Zulassungsverfahren für einzelne Inhaltsstoffe, die zu einer Verzögerung der Marktzulassung zuerst in Österreich, später auch in Deutschland und anderen Ländern führten und in manchen Medien als Verbot kolportiert wurden.
Der vergleichsweise hohe Koffeingehalt ist einer der Gründe, weshalb eine Zulassung in Deutschland kritisch gesehen wurde: das Lebensmittelrecht sah bisher eine Obergrenze von 250 mg/l vor, während die Energy Drinks 320 mg/l enthalten. Diese Mengen relativieren sich auf dem Hintergrund anderer koffeinhaltiger Lebensmittel: In einer Tasse Kaffee sind zwischen 60 und 120 mg Koffein enthalten, in einem Liter bis zu 300 bis 600 mg. Beim Konsum der Energy Drinks kann also kein wesentlich anderer Effekt als bei gesüßtem Kaffee erwartet werden.
Die Zulassung des Energy Drinks in Deutschland war jedoch 1994 unumgänglich, weil in Großbritannien das Getränk zugelassen worden war. Nach EU-Recht durfte die Zulassung in anderen EU-Ländern nicht versagt werden. Die Herstellung ist in Deutschland allerdings weiterhin nicht erlaubt. Die Dosen werden aus Österreich importiert. Auf ihnen warnt ein Hinweis wegen des erhöhten Koffeingehaltes vor übermäßigem Genuss.
Einige Jahre vor Produkteinführung herrschte eine gewisse Unsicherheit bei Red Bull, ob das Produkt von den Kunden angenommen und gekauft wird. Diese Unsicherheit hat man versucht abzuwenden, indem man Marktforschung betrieb und bei den Zielgruppen Produkttests durchführte.
Eine weitere Gefahr für Red Bull könnte entstehen, wenn sich das EU Recht ändern würde und die Zulassung in einigen europäischen Ländern versagt wird. Meiner Meinung nach ist diese Gefahr jedoch nicht allzu groß, da sich Red Bull stark etabliert hat und lange genug auf dem europäischen Markt ohne große Skandale aktiv ist.
3.5 Komplexität
Im Hinblick auf eine Innovation muss auch die Komplexität betrachtet werden. Dabei wird nach der zeitlichen, sowie der quantitativen und der qualitativen Komplexität unterschieden.[12]
3.3.1 Zeitliche Komplexität
Im Hinblick auf die zeitliche Komplexität, auch als Dynamik beschrieben, hat Red Bull einen Vorsprung gegenüber anderen Herstellern von Energy Drinks, die auf dem europäischen Markt tätig sind.
Durch ein hohes Werbebudget vor, während und nach der Produkteinführung und einer stetig steigenden Markenbekanntheit und der Tatsache, dass Red Bull als erstes Unternehmen einen Energy Drink auf den europäischen Markt brachte hat sich Red Bull einen Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten erarbeitet und beherrscht den Markt mit einem Marktanteil von 70 %.
Als Energy Drink gehört das Getränk zum Zukunftsmarkt der „funktionalen Nahrungsmitteln“, die über ihre normale Funktion hinaus (Durst bzw. Hunger zu stillen) den Anspruch weiterer nützlicher Funktionen für den Organismus erheben.
3.3.2 Quantitative und Qualitative Komplexität
Hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Komplexität war Red Bull zu Beginn an sicherlich nicht sehr komplex. Es gab zu der Zeit, als Red Bull zum ersten Mal auf den Markt kam, kein Angebot an Energy Drinks auf dem europäischen Markt.
Red Bull musste eine Zielgruppe definieren und sich einen Kundenstamm aufbauen. Die Zielgruppe von Red Bull sind Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die in ihrem Beruf und in ihrer Freizeit ein Energiedefizit kompensieren wollen, um ihrer Tätigkeiten länger und ausdauernder ausführen zu können. Sie verknüpfen mit diesem Produkt einen Lebenswandel, der von sportlicher Leistung und beruflichem Erfolg geprägt ist und dadurch glauben erhöhte Konzentration und Wachheit zu benötigen.
Bis Red Bull einen Kundenstamm aufgebaut hatte und die Fehler, die gerade zu Beginn auftraten beseitigen konnte, musste Red Bull in erster Linie durchhalten und versuchen die Prozesse zu optimieren.
Außerdem war es wichtig im Unternehmen für eine breite Transparenz zu sorgen und den Mitarbeitern begreiflich zu machen, was von dem Erfolg bzw. scheitern abhängig war. Da alle Bereiche in einem Unternehmen an diesem Prozess beteiligt sind, war dies ein unablässiger Faktor. Gerade zu Beginn mussten Marktbarrieren durchbrochen werden und das Unternehmen musste sehr kundenorientiert arbeiten.
3.4 Konfliktgehalt
Mit dem Konfliktgehalt bezeichnet man den Zustand der verschiedenen, unvereinbaren Zustände von Objekten oder Subjekten. Im Zusammenhang mit einer Innovation beinhaltet der Konfliktgehalt in erster Linie die Unsicherheit und Unklarheit.[13]
Der Verkauf von Red Bull als normales Getränk ist in Dänemark und Norwegen verboten. Lokale Behörden haben dort das Getränk aufgrund des Inhaltsstoffes Taurin als Medikament eingestuft und empfehlen daher vor dem Genuss einen Arzt zu konsultieren.
Der übermäßige Genuss von Energy Drinks birgt einige Gesundheitsrisiken, weshalb die zum Verkauf zugelassenen Dosen einen Warnhinweis tragen:
Achtung: Enthält Koffein. Nicht empfohlen für Kinder, schwangere oder stillende Frauen, Personen mit Koffeinsensibilität; nicht mit Alkohol mischen. Nicht mehr als 500 Milliliter pro Tag konsumieren.
Derartige Warntexte sind auf den in den USA oder in Großbritannien verkauften Dosen nicht angebracht. Personen, die mehr als 2–5 Dosen innerhalb von 24 Stunden konsumiert haben, empfanden Symptome wie Unwohlsein, Übelkeit, Kopfschmerzen, Magenschmerzen oder Schlaflosigkeit.
Ärzte und Ernährungswissenschaftler warnen vor den Gefahren eines übermäßigen gemeinsamen Genusses von Alkohol und Red Bull. Ihre Warnungen werden oft ignoriert, da Red Bull insbesondere bei intensivem Alkoholgenuss häufig als Mittel gegen Müdigkeit eingesetzt wird.
Ein Test der Zeitschrift Ökotest kam im Jahr 2007 zu dem Ergebnis, dass das Getränk zu viel Zucker, überflüssige Vitamine und problematische Inhaltsstoffe aufweist. Die Gesamtnote des Tests war Mangelhaft. Unter anderem betonte die Zeitschrift, dass das Getränk wie die meisten Produkte seiner Klasse für Sportler ungeeignet ist, da der hohe Zuckergehalt die Flüssigkeitsaufnahme in den Körper blockiert.
Red Bull belastet wie auch andere moderne Getränke den Zahnschmelz und kann einen Beitrag zu dessen Schädigung leisten.
Für Red Bull könnten Konflikte entstehen, wenn z.B. eine Person zusammenbricht und Ärzte feststellen würden, dass dies durch den Genuss von Red Bull passiert ist. Gelangt dieser Vorfall in die Öffentlichkeit, kann es sein, dass Red Bull einen Imageschäden erleidet und gegebenenfalls verklagt wird.
Ein weiterer Konflikt könnte entstehen, wenn andere Energy Drink Hersteller ihr Marketing verstärken und bekannter werden, dies kann zu Marktanteilsverlusten von Red Bull führen, indem die Kunden zu den Wettbewerbern abwandern.
4 Zieldreieck einer Innovation
Das Zieldreieck einer Innovation besteht aus den drei Kernpunkten Ergebnis, Aufwand und Zeit (Abbildung 2).[14]
Abbildung 2 : Zieldreieck der Innovation
Für Unternehmen, die mit einem innovativen Produkt auf den Markt treten, sind diese Merkmale zu beachten und zu verbinden, um möglichst die positiven Eigenschaften Produktivität, Effizienz und Intensität zu sichern. Auch wenn sich dieses häufig als schwierig darstellt.[15]
4.1 Ergebnis
Das Ergebnis beinhaltet die Qualität eines Produktes und den Nutzen den der Kunden aus einer Innovation ziehen kann. Es sollte in erster Linie zu einer Verbesserung der Produkte und der Prozesse beitragen und für den Kunden einen besseren Nutzen bringen, als mit den bereits vorhandenen Produkten.[16]
Dietrich Mateschitz positionierte seinen Energy Drink mit dem Slogan „Belebt Körper und Geist.“ Dieses Claim veranschaulicht den Kernnutzen des Produktes in leicht verständlicher Weise. Laut Mateschitz ist Red Bull dazu geeignet, dem Konsumenten zu jeder Tageszeit einen Energieschub zu verleihen. Auf diese Weise wird der Konsum von Red Bull nicht auf bestimmte Anlässe oder Aktivitäten eingeschränkt, wie es bei vielen anderen energiebezogenen Erfrischungsgetränken der Fall ist.
Red Bull besitzt ein hohes Qualitätsniveau, weil ansonsten der Markenname schaden nehmen würde. Red Bull ist ein Markenartikel, weil das Getränk eine eindeutige Markierung hat, eine weite Verbreitung im Absatzmarkt und einen hohen Bekanntheitsgrad, gleich bleibende Aufmachung, gleich bleibende Abpackmenge und gleich bleibende oder stetig steigende Qualität.
4.2 Aufwand
Der Aufwand bezeichnet die Kosten und den Preis im Zusammenhang mit einem Produkt. Kosten werden als Geldeinheiten betrachtet, die für den Verbrauch der Güter anfallen und die für die Produktion der Innovation entstanden sind.
Red Bull hat ein hohes Preisniveau gegenüber anderen Energy Drinks, weil das Produkt einer Markenfirma angehört und der Name mitbezahlt wird. Somit bestimmt Red Bull die Obergrenze der Energy Drinks und ist in dieser Branche Preisführer. Red Bull möchte auf Dauer beim Konsumenten eine psychologische Distanz zu anderen Energy Drinks aufrechterhalten. Da es für Red Bull auf dem Markt viele Ersatzprodukte gibt ist die Nachfrage relativ elastisch.
Bei Red Bull gibt es zwei grosse Gruppen von Abnehmern. Zum einen Privatpersonen, welche das Produkt z.B. in einem Supermarkt beziehen und zum andern der Handel, Restaurants und Diskotheken. Im Supermarkt kostet eine 250 ml Dose Red Bull zwischen 1,50 € und 1,90 €. Zwischen Red Bull und Red Bull Sugarfree gibt es keine Preisunterschiede.
Die räumliche Preisdifferenzierung ist bei Red Bull die Unterteilung in Inland und Ausland. Dabei wandeln sich die Preise von Land zu Land. Eine zeitliche Differenzierung findet nicht statt, da Red Bull im Sommer und Winter getrunken wird.
4.3 Zeit
Neben den Kernpunkten Ergebnis und Aufwand, ist die Zeit eine wichtige Bestimmungsgröße für den Erfolg einer Innovation. Neben dem Zeitpunkt des Markteintritts und der Produktlebenszeit auf dem Markt, spielt auch das Zeitfenster für die Erzielung von Gewinnen eine entscheidende Rolle.[17]
Da es sich bei Red Bull, um das erste Unternehmen handelte, dass Energy Drinks in Europa absetzte, ist nicht bekannt, ob der Markteintritt 1987 in Österreich gezielt darauf ausgerichtet war oder ob Red Bull zu diesem Zeitpunkt die Auffassung vertrat, den richtigen Zeitpunkt gefunden zu haben. Zu Beginn hatte Red Bull, wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, erhebliche Probleme mit den Zulassungsvoraussetzungen, die erst im Laufe der Zeit behoben werden konnte.
Die Produktlebenszeit und die Erzielung von Gewinnen sind bei dem Energy Drink noch lange nicht abgeschlossen. Red Bull konnte in den letzten 20 Jahren den Umsatz stetig steigern.
Im Jahr 2008 setzte Red Bull 4,016 Mrd. Dosen ab. Nach den etwas schwierigen Zeiten nach der Produkteinführung konnte sich der Red Bull kontinuierlich steigern. Eng mit der Produktlebenszeit verbunden ist die Erzielung von Gewinnen. Durch die steigenden Absatzzahlen verzeichnete Red Bull im Laufe der letzen Jahre ein deutliches Plus in der Abschlussbilanz.
5 Produktlebenszyklus
Der Produktlebenszyklus beschreibt den „Lebensweg“ eines Produktes in fünf Phasen. Beginnend mit der Einführung, über das Wachstum, die Reife, die Sättigung und die Degeneration (Abbildung 3).[18]
Abbildung 3: Produktlebenszyklus
In den fünf Jahren vor der Markteinführung, entwickelte Mateschitz das Red Bull Markenkonzept vom Packaging bis zur Kommunikation. Das Produkt- und Verpackungskonzept wurde umfangreichen Entwicklungsphasen unterzogen um es an den europäischen Markt anzupassen. Es wurden eine Vielzahl von Marktforschungsuntersuchungen durchgeführt und mehr als 200 Verpackungsvorschläge getestet.
Die Einführungsphase begann im Jahr 1987, als Red Bull den österreichischen Markt betrat. Diese Phase charakterisiert sich durch erste Erlöse, die das Unternehmen erzielte, aber in der noch keine Gewinne erwirtschaftet wurden. Gekennzeichnet ist die Phase durch hohe Marketingkosten, einen noch geringen Bekanntheitsgrad und Anlaufverluste. Die Einführungsphase bei Red Bull dauerte verhältnismäßig lange, da das Unternehmen lange mit einigen Schwierigkeiten zu Recht kommen musste. Diese wurden bereits in Kapitel 3 dargestellt.
Im internationalen Markt ist der Energy Drink in der Wachstumsphase. Der Umsatz steigt jährlich immer mehr an, doch die Konkurrenz nimmt auch jährlich zu.
Das Produkt geht um die Welt, es wird bereits in ca. 115 Ländern angeboten, und diese Zahl nimmt jährlich zu. Damit ist Red Bull im internationalen Markt sehr weit verbreitet und bekannt.
National ist das Produkt Red Bull in der Reifephase, der maximale Gewinn wird erzielt. Aber die Umsatzwachstumsraten nehmen langsam ab.
Die Sättigungs- und Degenerationsphase wurden von Red Bull noch nicht erreicht. Das Unternehmen verzeichnet weiter steigende Absatzzahlen und einen steigenden Bekanntheitsgrad.
Trotz des sehr schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeldes sind die Wachstums- und Investitionspläne auch für das Geschäftsjahr 2009 sehr ambitioniert.
Den Fokus zukünftiger Expansion legt Red Bull auf die Märkte in Afrika, Russland, Indien, Japan und den Roll-Out von dem neuen Produkt Red Bull Cola.
6 Fazit
Nach der Aufschlüsselung der Innovationsmerkmale kann Red Bull durchaus als erfolgreiche Getränkeinnovation verstanden werden. Red Bull ist seit über 20 Jahren in der Getränkebranche tätig und nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr erfolgreich.
Mit jährlich mehr als 4 Mrd. Dosen Absatz im Jahr 2008 setzte der Rote Bulle seinen Höhenflug ungebremst fort. So gibt man sich denn auch zuversichtlich, dass Red Bull kein kurzlebiges Trendgetränk ist, sondern eine langfristig erfolgreiche Produktinnovation mit Inhaltsstoffen, die eine Geist und Körper belebende Wirkung haben.
Literaturverzeichnis
Hauschildt, Jürgen; Salomo, Sören: Innovationsmanagement, 4. Auflage, München: Vahlen Verlag, 2007.
Franken, Swetlana: Skript Innovationsmanagement, Teil 1: Innovation Grundlagen und Teil 2: Merkmale und Ziele der Innovation, http://www.wi.fh-koeln.de/homepages/s-franken/index.htm (Stand: 12.04.2009)
Keller, Kevin Lane: Strategic Brand Management - Best Practice Cases in Branding Lessons from the World′s Strongest Brands, 2. Auflage, New Jersey, Pearson Education, 2003.
Website-Verzeichnis