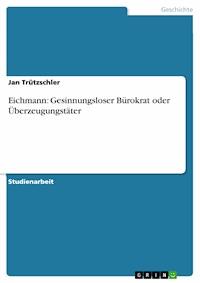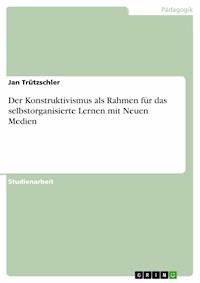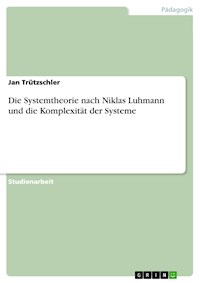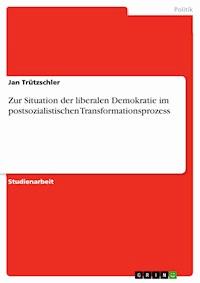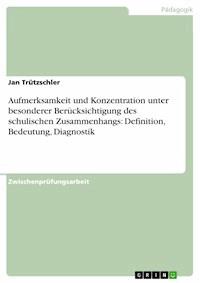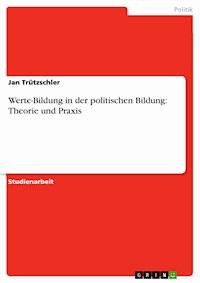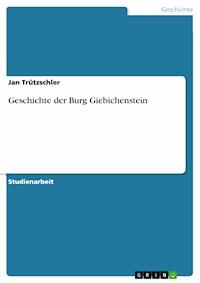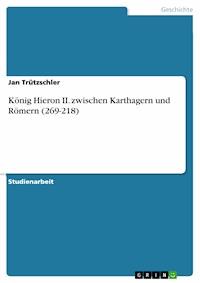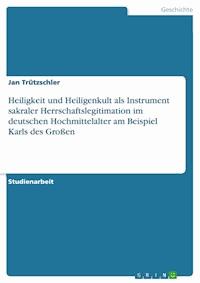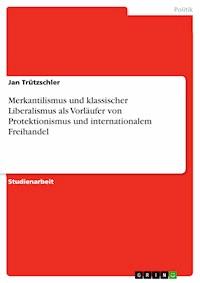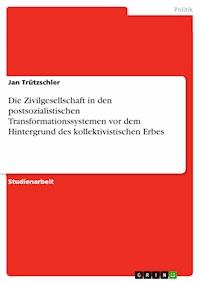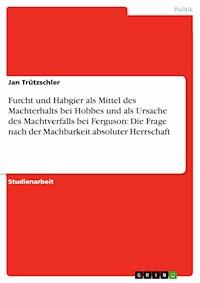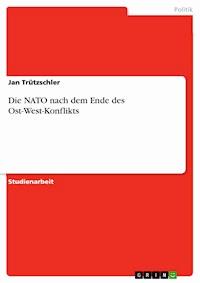15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Didaktik - Politik, politische Bildung, Note: 1, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Institut für Politikwissenschaft), Veranstaltung: Einführung in die Didaktik der politischen Bildung, Sprache: Deutsch, Abstract: Wolfgang Giesecke entwickelte die Konfliktorientierung in starker Anlehnung an das Emanzipationspostulat der Kritischen Erziehungswissenschaft, welches Mollenhauer, seinerseits beeinflusst durch die Kritische Theorie der Frankfurter Schule, folgendermaßen definiert: „Für die Erziehungswissenschaft konstitutiv ist das Prinzip, das besagt, daß Erziehung und Bildung ihren Zweck in der Mündigkeit des Subjekts haben; dem korrespondiert, dass das erkenntnisleitende Interesse der Erziehungswissenschaft das Interesse an Emanzipation ist.“1 Ziel dieser Arbeit ist es nicht diesen Ansatz zu bewerten und Partei für oder gegen Prinzipien der Kritischen Erziehungswissenschaft zu ergreifen. Ziel ist es vielmehr Gieseckes Umsetzung dieser Prinzipien für den Sozialkundeunterricht zu betrachten. Zu diesem Zweck werden in einem ersten Schritt theoretische Grundlagen konfliktorientierten Unterrichts und dessen Methode der Konfliktanalyse erläutert. Anschließend wird die Anwendung eben dieser Methode an einem praktischen Beispiel demonstriert. Herangezogen wird hierfür der Konflikt um den Internationalen Strafgerichtshof. Ausgewählt wurde dieser Streitfall in dem Bewusstsein, dass obwohl kaum ein Schüler direkt vom Ausgang dieses Konflikts betroffen ist, doch relativ schnell eine hohe moralische Identifikation mit einer der verschiedenen Auffassungen zum Thema stattfinden kann, dass Interesse auf Schülerseite also recht hoch sein dürfte. Hinzukommt, dass sich an diesem Beispiel das Funktionieren Internationaler Beziehungen gut erschließen lässt und sich Einblicke in Organisation und Arbeitsweise der Vereinten Nationen bieten. Um die im Unterricht schon wegen des engen Zeitrahmens nötige Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wird dieser Konflikt nur aus Sicht der beiden Hauptakteure USA und EU betrachtet. 1 Mollenhauer, Klaus: Erziehung und Emanzipation: polemische Skizzen, München 1968, S.10
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
Deckblatt für Hausarbeit
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg Institut für Politikwissenschaft
Hausarbeit
Übung: Einführung in die Didaktik der Sozialkunde Semester: SS 2002
Thema:Gieseckes Konfliktanalyse: Theorie und Praxis
Vorgelegt von: Jan Trützschler
Datum: 14. Dezember 2002
Page 1
I. Einleitung
Wolfgang Giesecke entwickelte die Konfliktorientierung in starker Anlehnung an das Emanzipationspostulat der Kritischen Erziehungswissenschaft, welches Mollenhauer, seinerseits beeinflusst durch die Kritische Theorie der Frankfurter Schule, folgendermaßen definiert: „Für die Erziehungswissenschaft konstitutiv ist das Prinzip, das besagt, daß Erziehung und Bildung ihren Zweck in der Mündigkeit des Subjekts haben; dem korrespondiert, dass das erkenntnisleitende Interesse der Erziehungswissenschaft das Interesse an Emanzipation ist.“1Ziel dieser Arbeit ist es nicht diesen Ansatz zu bewerten und Partei für oder gegen Prinzipien der Kritischen Erziehungswissenschaft zu ergreifen. Ziel ist es vielmehr Gieseckes Umsetzung dieser Prinzipien für den Sozialkundeunterricht zu betrachten. Zu diesem Zweck werden in einem ersten Schritt theoretische Grundlagen konfliktorientierten Unterrichts und dessen Methode der Konfliktanalyse erläutert. Anschließend wird die Anwendung eben dieser Methode an einem praktischen Beispiel demonstriert. Herangezogen wird hierfür der Konflikt um den Internationalen Strafgerichtshof. Ausgewählt wurde dieser Streitfall in dem Bewusstsein, dass obwohl kaum ein Schüler direkt vom Ausgang dieses Konflikts betroffen ist, doch relativ schnell eine hohe moralische Identifikation mit einer der verschiedenen Auffassungen zum Thema stattfinden kann, dass Interesse auf Schülerseite also recht hoch sein dürfte. Hinzukommt, dass sich an diesem Beispiel das Funktionieren Internationaler Beziehungen gut erschließen lässt und sich Einblicke in Organisation und Arbeitsweise der Vereinten Nationen bieten. Um die im Unterricht schon wegen des engen Zeitrahmens nötige Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wird dieser Konflikt nur aus Sicht der beiden Hauptakteure USA und EU betrachtet.
II. Theorie
1. Hauptziel politischen Unterrichts
Nach Giesecke ist Mitbestimmung „[…] oberstes Lernziel und Gegenstand der politischen Bearbeitung, also auch Ziel und Gegenstand des Unterrichts selbst.“2Grundlage dieser Auffassung ist eine „historisch-dynamische Interpretation“3des Grundgesetzes, der zufolge selbiges eine Aufforderung zur fundamentalen______________________________________________________________________________________________
1 Mollenhauer, Klaus: Erziehung und Emanzipation: polemische Skizzen, München 1968, S.10
2 Giesecke, Hermann: Didaktik der politischen Bildung, München 1972, S.140
3 ebd., S. 158
Page 2
Demokratisierung sämtlicher Bereiche „in denen Menschen - notwendigerweise oder freiwillig - miteinander kommunizieren.“4beinhaltet. Ziel ist es demnach, Mitbestimmung bei jeder Entscheidung für jeden der von der Entscheidung betroffen ist zu ermöglichen. Wobei Mitbestimmung als „planmäßige Veränderung in Richtung auf zunehmende Demokratisierung der Gesellschaft.“5definiert wird. Mitbestimmung ist also Mittel und Ziel des „historisch-dynamischen“ Ansatzes zugleich. Historisch ist er, da bestehende demokratische Strukturen genutzt und ausgebaut werden sollen anstatt sie neu zu erfinden, dynamisch ist er, da dieser Ausbau nicht im Zuge einer einzigen Handlung stattfinden soll, sondern vielmehr Produkt einer kontinuierlich um sich greifenden Entwicklung sein muss.6
Zusammengefasst lässt sich sagen, Giesecke fordert eine Gesellschaft, in der jeder Einzelne seine Interessen wirksam vertreten darf und zwar nicht nur auf staatlicher Ebene sondern auch „[…] in der Familie, im Betrieb, oder in Schule und Hochschule.“7Gleichzeitig erkennt Giesecke aber auch, dass um dies zu realisieren jeder Einzelnen in die Lage sein muss seine Interessen zu erkennen, zu formulieren und zu vertreten und dies dann auch permanent tut. Aus dieser Einsicht heraus definiert er Befähigung und Anregung zur Mitbestimmung als primäres Ziel politischen Unterrichts. Um es zu erreichen entwickelt er das didaktische Prinzip der Konfliktorientierung. Durch sie rückt er den Konflikt in das Zentrum des Unterrichts.