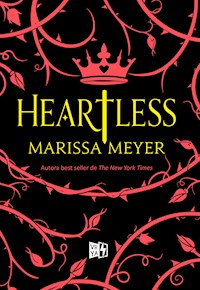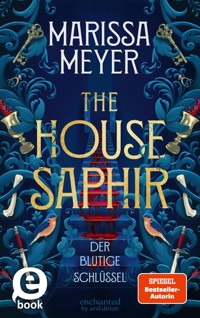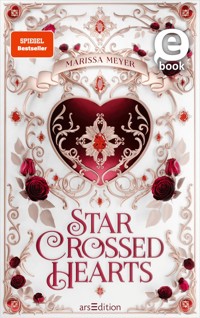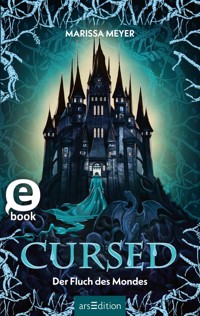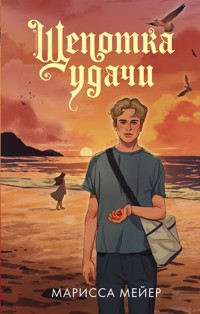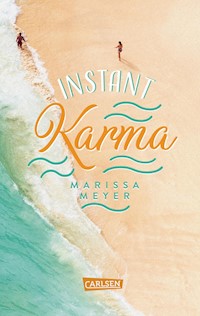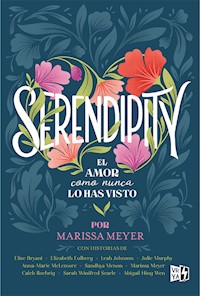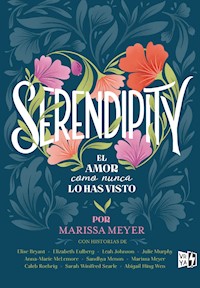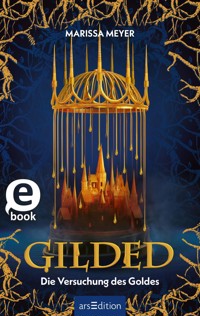
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: arsEdition GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein neues Retelling der Märchen-Queen: düster und romantisch Serilda liebt Geschichten. Und vor allem liebt sie es, Geschichten zu erzählen. Doch im Königreich gelten Fiktion und Fantasie als Lüge und sind verboten. Als eines Tages auch der Erlkönig von ihren fesselnden Märchen hört, entführt er sie in sein düsteres Schloss, um einen unmöglichen Handel vorzuschlagen: Sie soll Stroh zu Gold spinnen oder sie muss sterben. In ihrer Verzweiflung bittet Serilda einen geheimnisvollen Mann um Hilfe, der im Schloss sein Unwesen treibt. Doch sie hat nicht mit den Gefühlen gerechnet, die er in ihr weckt ... Band 1: Gilded - Die Versuchung des Goldes Band 2: Cursed - Der Fluch des Mondes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MARISSA MEYER
Gilded
Die Versuchung des Goldes
Aus dem Englischenvon Anne Brauner
arsEdition
Du möchtest noch mehr von uns kennenlernen?
Vollständige eBook-Ausgabe der Softcoverausgabe München 2024
Text copyright © Marissa Meyer, 2021
Cover copyright © Macmillan Publishers, 2021
Titel der Originalausgabe: Gilded
Die Originalausgabe ist 2021 bei Feiwel & Friends (Macmillan Publishers),
New York, erschienen.
© 2024 arsEdition GmbH, Friedrichstraße 9, D-80801 München
Alle Rechte vorbehalten
© Text: Marissa Meyer
Übersetzung: Anne Brauner
Lektorat: Katja Korintenberg
Cover: Grafisches Atelier arsEdition, unter Verwendung
von Bildmaterial von Roberto Castillo / Shutterstock, Peratek /
Shutterstock und Anton Dzyna / Shutterstock
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN eBook 978-3-8458-6083-1
ISBN Printausgabe 978-3-8458-5721-3
www.arsedition.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Für Jill und Liz –zehn gemeinsame Jahre undfünfzehn gemeinsame Bücher.Eure unermüdliche Unterstützung undErmunterung sowie eure Freundschaft sindunendlich wertvoller als Gold.
Prolog
Also gut, ich erzähle euch die Geschichte, wie sie sich wirklich zugetragen hat.
Zunächst möchte ich vorausschicken, dass meinen Vater keine Schuld trifft. Weder am Pech noch an den Lügen. Mit Sicherheit nicht an dem Fluch. Einige Leute werden versuchen, ihm das alles in die Schuhe zu schieben, aber er hatte so gut wie nichts damit zu tun.
Und ich war auch nicht schuld, das will ich ebenfalls klarstellen. Weder am Pech noch an den Lügen. Mit Sicherheit nicht an dem Fluch.
Na ja.
Gelogen habe ich vielleicht doch hin und wieder.
Aber ich sollte damit beginnen, wie alles angefangen hat. Ganz von vorn.
Der Ursprung unserer Geschichte ereignete sich vor neunzehn Jahren zur Wintersonnenwende, während eines seltenen Endlosmondes.
Allerdings ließe sich der Anfang auch in der Vorzeit vermuten, als Ungeheuer ungestört und frei vor dem Schleier lebten, der sie nun von den Sterblichen trennt. In dieser Vorzeit, in der sich manchmal sogar Dämonen verliebten.
Doch unsere Geschichte begann im Laufe dieses Endlosmondes. Der Himmel war schiefergrau und das Donnern der Hufe, das Heulen der Hunde, das einem das Mark in den Knochen gefrieren ließ, kündigten einen Schneesturm an. Die Wilde Jagd war ausgebrochen, hatte es aber in diesem Jahr nicht nur auf verlorene Seelen und verirrte Trunkenbolde und unartige Kinder abgesehen, die sich zu einer höchst unglückseligen Zeit danebenbenahmen. In diesem Jahr war es anders, da der Endlosmond nur erscheint, wenn die Wintersonnenwende auf einen strahlenden Vollmond fällt. Nur in dieser Nacht sind die großen Götter gezwungen, ihre monströse Tiergestalt anzunehmen. Sie sind gewaltig, sie sind stark, und es ist fast unmöglich, sie zu fangen.
Doch wer das Glück oder das Geschick hat, einen solchen Schatz dingfest zu machen, dem muss der Gott einen Wunsch erfüllen.
Einem solchen Wunsch jagte der Erlkönig in jener schicksalshaften Nacht nach. Seine Höllenhunde heulten, angespornt von Gier, als sie eins dieser Monster in die Enge trieben, und der Erlkönig schoss höchstpersönlich den Pfeil ab, der den mächtigen goldenen Flügel des Biests durchbohrte. Er war sicher, dass ihm der Wunsch gewährt werden würde.
Doch mit bemerkenswerter Kraft und Anmut konnte die göttliche Kreatur den Kreis der Hunde durchbrechen, die sie umzingelt hatten. Sie flüchtete tief in den Aschenwald. Die Jäger nahmen die Verfolgung auf, doch es war zu spät. Das Ungeheuer blieb verschwunden, und angesichts des nahenden Sonnenaufgangs war die Wilde Jagd gezwungen, hinter den Schleier zurückzukehren.
Als das Licht des Morgens auf der Schneedecke schimmerte, wollte es das Schicksal, dass ein junger Müller früh aufstand, um nach dem Fluss zu sehen, der sein Wasserrad antrieb. Er machte sich Sorgen, dass er in der Kälte zufrieren könnte. Stattdessen entdeckte er das Ungeheuer, das sich im Schatten des Rades versteckt hatte. Wenn Götter sterben könnten, wäre es wohl dem Tod geweiht gewesen. Es war sehr schwach, und der Pfeil mit der goldenen Spitze ragte noch aus dem blutverschmierten Gefieder.
Der verängstigte Müller war zwar vorsichtig, aber auch mutig, und ging auf die Tiergestalt zu. Es kostete ihn einige Mühe, den Pfeil herauszuziehen. Im nächsten Moment verwandelte sich das Tier in die Göttin der Geschichten. Sie dankte dem Müller überschwänglich und versprach, ihm einen Wunsch zu erfüllen.
Nach langem Nachdenken gestand der Müller der Göttin schließlich, dass er in eine Magd aus dem Dorf verliebt war – in ein Mädchen, das gutherzig und gleichzeitig ein Freigeist war. Er wünschte sich, dass die Göttin ihnen ein gesundes, kräftiges Kind bescherte.
Die Gottheit neigte den Kopf und versprach, so solle es geschehen.
Als die nächste Wintersonnenwende nahte, hatte der Müller die Dorfmagd geheiratet und mit ihr ein Baby in die Welt gesetzt. Ihre Tochter war tatsächlich gesund und kräftig und die Göttin hatte den Wunsch in dieser Hinsicht erfüllt.
Doch jede Geschichte hat zwei Seiten. Es gibt den Helden und den Bösewicht. Hell und Dunkel. Segen und Fluch. Und der Müller hatte nicht begriffen, dass die Göttin der Geschichten auch die der Lügen ist.
Eine betrügerische Gottheit.
Das Mädchen, das mit diesem Paten gesegnet war, war für immer mit Augen gezeichnet, deren Blick niemand Glauben schenkte. Die Iris waren pechschwarz und darüber lag ein goldenes Rad mit acht winzigen goldenen Speichen: das Rad des Schicksals und des Glücks. Und wenn ihr klug seid, wisst ihr, dass es die größtmögliche Täuschung verkörpert.
Man sah dem Mädchen also an, dass es von alter Magie berührt worden war. In ihrer Kindheit und Jugend wurde sie von den misstrauischen Dorfbewohnern wegen ihres sonderbaren Blicks und der unglückseligen Ereignisse, die ihr auf dem Fuße zu folgen schienen, häufig ausgeschlossen. Es gab verheerende Winterstürme. Dürren im Sommer. Von Schädlingen vernichtete Ernten und abhandengekommenes Vieh. Dazu kam, dass ihre Mutter eines Nachts ohne Erklärung verschwunden war.
All das und sämtliche anderen Missgeschicke wurden dem mutterlosen Kind mit den sündhaften Augen angelastet.
Am verwerflichsten erschien vielleicht eine Angewohnheit, die das Mädchen sich zugelegt hatte, sobald es die ersten Wörter gelernt hatte. Wenn es sprach, konnte es sich kaum zurückhalten und erzählte die aberwitzigsten Geschichten, als würde seine Zunge keinen Unterschied zwischen Dichtung und Wahrheit kennen. Das Mädchen gab sich den Geschichten und Lügen hin, und während die Kinder entzückt dem launigen Zauber lauschten, waren die Älteren auf der Hut.
Sie lästere Gott, behaupteten sie. Eine abscheuliche Lügnerin sei sie, was, wie jeder weiß, fast so schlimm ist, als wäre man ein Mörder oder jemand, der sich wiederholt zu einem Glas Bier einladen lässt, ohne den Gefallen je zu erwidern.
Mit anderen Worten: Das Kind war verflucht und alle wussten Bescheid.
Und da ich euch das nun erzählt habe, befürchte ich, dass ich euch bereits aufs Glatteis geführt habe.
Rückblickend war mein Vater vielleicht doch ein bisschen schuld. Möglicherweise hätte er sich hüten sollen, die Gunst eines Wunsches von einer Gottheit anzunehmen.
Aber schließlich würdet ihr doch genau das auch tun … oder nicht?
NeujahrDer Schneemond
Kapitel 1
Fräulein Sauer war eine Hexe. Eine echte Hexe – nicht das, womit dumme Menschen eine unsympathische Frau mit hutzeligem Äußeren bezeichnen, obwohl auch das auf sie zutraf. Nein, Serilda war überzeugt davon, dass Fräulein Sauer uralte Kräfte verbarg und sich in der Dunkelheit jedes Neumonds freudig mit Feldgeistern unterhielt.
Sie hatte kaum Beweise, es war mehr ein Bauchgefühl. Denn was sollte die alte Lehrerin mit dem verdrießlichen Wesen und den gelblichen, spitzen Zähnen sonst sein? (Ernsthaft – bei näherem Hinschauen war deren Ähnlichkeit mit Nadeln nicht zu übersehen, zumindest in einem gewissen Licht, oder wenn sie sich mal wieder über ihre miserablen Schülerinnen und Schüler beschwerte.) Auch wenn die Dörfler Serilda für jedes kleinste Missgeschick verantwortlich machten, wusste sie es doch besser. Wenn jemand schuld war, dann Fräulein Sauer.
Vermutlich braute sie Zaubertränke aus Zehennägeln und hatte einen Bergmolch als Vertrauten. Eklige schleimige Dinger, das hätte genau zu ihr gepasst.
Nein, nein, nein. So meinte sie das nicht. Serilda mochte Bergmolche und würde ihnen niemals so etwas Entsetzliches wie eine spirituelle Verbindung mit dieser grässlichen Frau an den Hals wünschen.
»Serilda«, sagte Fräulein Sauer mit dem verkniffenen Gesichtsausdruck, den sie so gern aufsetzte. Das vermutete Serilda jedenfalls, denn sehen konnte sie die Hexe nicht, da sie den Blick unterwürfig auf den schmutzigen Boden des Schulgebäudes gesenkt hatte.
»Du bist nicht«, fuhr die Frau fort und sprach jedes Wort betont langsam und scharf aus, »die Patentochter von Wyrdith. Oder irgendeiner anderen alten Gottheit. Und wenn dein Vater ein noch so angesehener und ehrbarer Mann ist, so hat er niemals ein sagenhaftes Tier gerettet, das von der Wilden Jagd verletzt wurde! Was du da den Kindern erzählst, das ist … das ist …«
Ein Unding?
Absurd?
Oder doch ein bisschen lustig?
»… von Grund auf böse!« Als Fräulein Sauer damit herausplatzte, flogen Speicheltröpfchen auf Serildas Wange. »Das lässt sie glauben, dass du etwas Besonderes bist. Dass deine Geschichten das Geschenk einer Gottheit sind, während wir ihnen die Tugenden der Ehrsamkeit und Demut einpflanzen sollten. In der einen Stunde, die sie dir zugehört haben, hast du bereits alles befleckt, worum ich mich das ganze Jahr lang bemüht habe!«
Serilda kniff die Lippen zusammen und wartete einen Augenblick. Sobald es den Anschein hatte, als wären Fräulein Sauer die Anschuldigungen ausgegangen, atmete sie tief ein und wollte zu ihrer Verteidigung ansetzen. Es ging doch nur um eine Geschichte, und was wusste Fräulein Sauer schon darüber? Möglicherweise hatte Serildas Vater die Gottheit der Lügen tatsächlich an der Wintersonnenwende befreit. Er hatte ihr persönlich erzählt, was sich zugetragen hatte, als sie noch jünger gewesen war, und sie hatte die astronomischen Tabellen überprüft. In jenem Jahr hatte es tatsächlich einen Endlosmond gegeben – genau wie es für den nächsten Winter erneut erwartet wurde.
Doch bis dahin war es noch ein gutes Jahr. Ein ganzes Jahr, in dem sie sich ergötzliche, raffinierte Geschichten ausdenken konnte, um die kleinen Grünschnäbel, denen der Besuch dieser seelenlosen Schule aufgezwungen wurde, zum Staunen und Fürchten zu bringen.
Arme Dinger.
»Fräulein Sauer, …«
»Kein Wort!«
Serilda schloss erbittert den Mund.
»Aus deinem gotteslästerlichen Maul habe ich fürs Leben genug gehört«, kreischte die Hexe und schnaubte empört. »Hätten die Götter mich doch bloß vor so einer Schülerin bewahrt!«
Serilda räusperte sich und bemühte sich um einen ruhigen, vernünftigen Tonfall. »Ich bin genau genommen keine Schülerin mehr, und Sie haben anscheinend vergessen, dass ich hier freiwillig im Einsatz bin. Ich sehe mich mehr als Hilfskraft, außerdem … müssen Sie das aus unerfindlichen Gründen zu schätzen wissen, weil Sie mir noch nicht verboten haben herzukommen. Oder?«
Sie wagte es, hoffnungsvoll lächelnd den Blick zu heben.
Serilda konnte die Hexe nicht ausstehen und wusste, dass es auf Gegenseitigkeit beruhte. Doch es zählte zu den wenigen Dingen, die ihr Freude bereiteten, die Schulkinder zu besuchen, ihnen beim Lernen zu helfen – und ihnen Geschichten zu erzählen, wenn Fräulein Sauer gerade nicht zuhörte. Falls Fräulein Sauer ihr verbot, weiterhin zu kommen, wäre sie am Boden zerstört. Die fünf Kinder waren die Einzigen im Städtchen, die Serilda nicht als Makel an ihrer ansonsten ehrbaren Gemeinde ansahen.
Im Grunde gab es hier nur wenige Menschen, die Serilda überhaupt eines Blickes würdigten. Die goldenen Speichen, die in ihren Augen strahlten, verunsicherten die meisten. Hin und wieder hatte sie sich gefragt, ob die Gottheit ihre Iris auf diese Weise gezeichnet hatte, weil man beim Lügen den anderen nicht in die Augen sehen sollte. Doch Serilda hatte noch nie Probleme damit gehabt, Blicken standzuhalten, ob sie nun log oder nicht. Es waren die anderen im Ort, die damit ihre Schwierigkeiten hatten.
Nur die Kinder nicht.
Sie konnte nicht gehen, sie brauchte sie. Und sie gefiel sich in der Vorstellung, dass die Kinder sie ebenfalls brauchten.
Dazu kam, dass sie sich eine Arbeit in der Stadt suchen musste, wenn Fräulein Sauer sie fortschickte. Und soweit sie wusste, gab es da nur … das Spinnen.
Bah!
Doch Fräulein Sauer wirkte ernst. Unterkühlt. Ja beinahe wütend. Die Haut unter ihrem Auge zuckte – ein sicheres Zeichen, dass Serilda zu weit gegangen war.
Mit einer schnellen Handbewegung ergriff Fräulein Sauer die Weidenrute, die immer auf ihrem Pult lag, und hielt sie in die Höhe.
Serilda wich instinktiv zurück, ein Überbleibsel aus der Zeit, als sie tatsächlich noch ihre Schülerin gewesen war. Obwohl sie seit Jahren keine Schläge mehr auf den Handrücken bekommen hatte, spürte sie noch den Phantomschmerz durch die Weidenrute, wann immer sie diese zu Gesicht bekam. Sie erinnerte sich sogar an die Worte, die sie bei jedem sausenden Schlag hatte aufsagen müssen.
Lügen ist böse.
Lügen ist das Werk der Dämonen.
Meine Geschichten sind Lügen, also bin ich eine Lügnerin.
Das wäre noch nicht einmal so schlimm gewesen, aber wenn die Menschen davon ausgingen, dass man die Unwahrheit sagte, verloren sie auch sonst das Vertrauen. Sie befürchteten, bestohlen zu werden. Sie schrieben ihr betrügerische Absichten zu. Sie glaubten nicht, dass sie verantwortungsbewusst und überlegt handelte. Es betraf alle Aspekte des guten Rufs auf eine Weise, die Serilda ausgesprochen ungerecht fand.
»Glaub ja nicht«, sagte Fräulein Sauer, »dass ich dir das Böse nicht austreibe, nur weil du kein Kind mehr bist. Einmal meine Schülerin, immer meine Schülerin, Fräulein Moller.«
Serilda senkte demütig den Kopf. »Entschuldigung. Es wird nicht wieder vorkommen.«
Die Hexe schnaubte. »Leider wissen wir beide, dass dies auch nur noch eine Lüge ist.«
Kapitel 2
Serilda schlang den Umhang fest um ihren Körper, als sie die Schule verließ. Es würde noch eine Stunde hell bleiben – das reichte, um zur Mühle zurückzukehren –, aber der Winter war kälter als alle, an die sie sich erinnern konnte. Der Schnee lag kniehoch und die Straßen waren stellenweise gefährlich glatt, wo die Wagenräder sulzige Furchen gegraben hatten. Lange bevor sie zu Hause ankäme, würde die Nässe ihre Stiefel durchweichen und in ihre Strümpfe dringen, und vor diesem Ungemach graute ihr so sehr, wie sie sich auf das Kaminfeuer freute, das ihr Vater entfacht haben würde, sowie auf die dampfende Brühe, die sie zu trinken bekäme, während sie ihre Zehen aufwärmte.
Nur wenn sie sich wie jetzt im tiefsten Winter auf den Heimweg machen musste, bedauerte Serilda, dass sie so weit draußen wohnten.
Nun wappnete sie sich gegen die Kälte, zog die Kapuze über und marschierte mit gesenktem Kopf und verschränkten Armen möglichst schnell voran, während sie gleichzeitig darauf achtete, bloß nicht auf dem tückischen Glatteis auszurutschen, das unter der frischen, federweichen Schneedecke lauerte. Die kalte Luft roch nach dem Rauch der Holzfeuer, der aus den nahe gelegenen Schornsteinen entwich.
Immerhin sollte es in der Nacht nicht noch einmal schneien. Am klaren Himmel waren keine bedrohlich grauen Wolken zu sehen. Der Schneemond würde makellos leuchten, und selbst wenn es nicht derart bemerkenswert war, wie das Zusammenfallen eines Vollmonds und der Wintersonnenwende, spürte Serilda, dass auch der Vollmond in der ersten Nacht des neuen Jahres mit einem Zauber verbunden war.
Die Welt war voller kleiner Verzauberungen, wenn man bereit war hinzuschauen. Und Serilda hielt stets die Augen auf.
»Die Wilde Jagd wird den Jahreswechsel ebenso feiern wie wir alle«, flüsterte sie, um sich abzulenken, weil ihre Zähne klapperten. »Nach dem Dämonenritt gibt es ein Festmahl aus den Tieren, die sie erbeutet haben, und dazu trinken sie warmen Gewürzmet mit dem Blut …«
Mit einem Mal wurde sie zwischen den Schulterblättern von einem harten Gegenstand getroffen. Sie schrie auf, drehte sich um und rutschte aus. Taumelnd fiel sie rückwärts und landete weich auf einem Kissen aus Schnee.
»Hab sie!«, hörte sie kurz darauf Anna entzückt rufen. Darauf folgte fröhliches Gelächter und Gejohle, während die Kinder aus ihren Verstecken hervorkamen: fünf kleine Gestalten, die mit verschiedenen Woll- und Fellschichten bekleidet waren. Sie tauchten hinter Baumstämmen, Wagenrädern und einem Busch auf, der von Eiszapfen niedergedrückt wurde.
»Wo warst du denn so lange?«, fragte Fricz mit einem wurfbereiten Schneeball in seiner behandschuhten Hand, während Anna rasch einen neuen zusammenkratzte. »Wir liegen seit fast einer Stunde auf der Lauer. Nickel hat schon über Frostbeulen geklagt!«
»Es ist gnadenlos kalt hier«, sagte Nickel, Fricz’ Zwillingsbruder, und hüpfte von einem Bein aufs andere.
»Ach, halt den Schnabel! Nicht mal das Baby jammert, du Mimose.«
Gerdrut, mit fünf Jahren die Jüngste, drehte sich mit einem genervten Gesichtsausdruck zu ihm um. »Ich bin kein Baby!«, schrie sie und warf einen Schneeball nach ihm. Obwohl sie gut gezielt hatte, landete er mit einem traurigen Platschen vor seinen Füßen.
»Ups, ich wollte dir nur eins überbraten«, sagte Fricz. Näher würde er einer Entschuldigung nie kommen. »Ich weiß, dass du bald eine große Schwester wirst.«
Damit war Gerdruts Wut rasch besänftigt und sie reckte mit einem stolzen Schnauben das Kinn. Sie wurde nicht nur als das Baby der Gruppe angesehen, weil sie die Jüngste war, sondern auch, weil sie sehr klein für ihr Alter war. Außerdem war sie mit den Sommersprossen auf ihren runden Wangen und den rotblonden Löckchen, die sich nie zu verheddern schienen, obwohl sie Annas Akrobatik nacheiferte, sehr zart.
»Tatsache ist und bleibt«, zischte Hans, »dass wir alle bibbern. Kein Grund, den sterbenden Schwan zu spielen.« Mit seinen elf Jahren war Hans der Älteste der Gruppe und neigte in der Nähe der Schule dazu, es in seiner Rolle als Anführer und Beschützer zu übertreiben. Dabei waren die anderen gar nicht unbedingt mit seiner Rolle einverstanden.
»Das sagst du«, sagte Anna und streckte den Arm, um einen neuen Schneeball auf das verlassene Wagenrad am Straßenrand zu werfen. Sie traf genau in die Mitte. »Mir ist nicht kalt.«
»Klar, weil du in der letzten Stunde ein Rad nach dem anderen geschlagen hast«, murrte Nickel.
Als Anna grinste, zeigte sie ihre Zahnlücken und machte einen Purzelbaum. Gerdrut quietschte entzückt – Purzelbäume waren ihr bisher als Einziges gelungen – und spielte mit. Sie hinterließen Spuren im Schnee.
»Und wieso habt ihr euch meinetwegen auf die Lauer gelegt?«, fragte Serilda. »Wartet denn zu Hause kein schönes warmes Kaminfeuer auf euch?«
Gerdrut hielt inne. Sie hatte die Beine vor sich ausgestreckt und in ihrem Haar glitzerte der Schnee. »Wir wollen hören, wie die Geschichte ausgeht.« Ihr gefielen die gruseligen Erzählungen noch mehr als den anderen, obwohl sie beim Zuhören stets das Gesicht an Hans’ Schulter vergrub. »Über die Wilde Jagd und die Gottheit der Lügen und …«
»Nein.« Serilda schüttelte den Kopf. »Nein, nein und abermals nein. Fräulein Sauer hat mit mir geschimpft und mich verwarnt. Ich höre auf mit dem Geschichtenerzählen. Von heute an bekommt ihr nur noch langweilige Neuigkeiten und absolut belanglose Tatsachen von mir zu hören. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man einen Dämon heraufbeschwören kann, indem man drei bestimmte Töne auf dem Hackbrett spielt?«
»Das hast du erfunden, das merkt doch jeder«, sagte Nickel.
»Falsch, es stimmt, da kannst du fragen, wen du willst. Oh, und einen Nachzehrer kann man nur töten, indem man ihm einen Stein ins Maul stopft. Dann kann er nicht mehr sein eigenes Fleisch kauen, wenn du ihm den Kopf abschlägst.«
»Solche Sachen zu lernen kann irgendwann wirklich nützlich sein«, sagte Fricz mit einem verschmitzten Lächeln. Obwohl er und sein Bruder sich mit ihren blauen Augen, dem Blondschopf und den Grübchen im Kinn glichen wie ein Ei dem anderen, konnte man sie gut auseinanderhalten. Fricz warf sich in jedes Abenteuer und Nickel schämte sich, weil sie verwandt waren.
Serilda nickte weise. »Es zählt zu meinen Aufgaben, euch auf das Erwachsenendasein vorzubereiten.«
»Huch«, sagte Hans. »Machst du einen auf Lehrerin, oder was?«
»Ich bin eure Lehrerin.«
»Nein, das bist du nicht. Du bist nicht einmal wirklich Fräulein Sauers Gehilfin. Sie duldet dich nur in der Schule, weil du die Kleinen beruhigen kannst – im Gegensatz zu ihr.«
»Meinst du etwa uns?«, fragte Nickel und zeigte auf sich und die anderen Kinder. »Wir sollen die Kleinen sein?«
»Wir sind fast so alt wie du!«, betonte Fricz.
»Ihr seid neun«, schnaubte Hans. »Das sind zwei Jahre, eine reine Ewigkeit.«
»Nicht ganz«, sagte Nickel und zählte mit den Fingern ab. »Wir haben im August Geburtstag und du …«
»Ja, ja«, unterbrach ihn Serilda, die diese Diskussion schon häufig miterlebt hatte. »Für mich seid ihr alle klein, und es ist höchste Zeit, dass ich eure Ausbildung ernster nehme, statt eure Köpfe mit Unsinn vollzustopfen. Ich fürchte, die Zeit des Geschichtenerzählens ist vorbei.«
Diese Ankündigung rief einen Chor melodramatischen Stöhnens sowie Geheul und flehentliche Bitten hervor. Nickel ließ sich sogar mit dem Gesicht in den Schnee fallen und strampelte in einem Trotzanfall mit den Beinen – möglicherweise in Nachahmung von Gerdrut an einem ihrer schlechteren Tage.
»Diesmal meine ich es ernst«, sagte Serilda.
»Als ob«, sagte Anna und lachte herzhaft. Sie hatte mit den Purzelbäumen aufgehört und prüfte jetzt die Stärke einer jungen Linde, indem sie sich an einen der tieferen Äste hängte und mit den Beinen schaukelte. »So wie letztes Mal. Und das Mal davor.«
»Aber diesmal knicke ich nicht ein.«
Die Kinder starrten sie nicht überzeugt an.
Serilda konnte es ihnen nicht verübeln. Wie oft hatte sie ihnen bereits gesagt, sie würde keine Geschichten mehr erzählen und eine vorbildliche Lehrerin werden? Eine feine, ehrwürdige Dame, und das ein für alle Mal.
Sie hatte es nie durchgehalten.
Nur noch eine Lüge, wie Fräulein Sauer gesagt hatte.
»Aber Serilda«, sagte Fricz, rutschte auf Knien durch den Schnee auf sie zu und blickte mit seinen großen, bezaubernden Augen zu ihr auf. »Der Winter in Märchenfeld ist so schrecklich langweilig. Worauf sollen wir uns denn freuen, wenn nicht auf deine Geschichten?«
»Auf ein Leben mit Schwerstarbeit«, murmelte Hans. »Darauf, Zäune zu reparieren und Äcker zu pflügen.«
»Und aufs Spinnen«, seufzte Anna verzweifelt, zog die Beine an und hängte sich kopfüber an den Ast. Die Hände und Zöpfe ließ sie baumeln, ohne dem bedrohlichen Ächzen des Baumes Beachtung zu schenken. »So viel Spinnerei.«
Serilda fand, dass Anna ihr von all den Kindern am ähnlichsten war, erst recht, seit Anna ihr langes braunes Haar zu zwei Zöpfen flocht, wie Serilda es fast ihr Leben lang getan hatte. Doch Annas Haut war deutlich brauner als Serildas und ihre Haare waren noch nicht so lang wie die ihren. Dazu kamen die ausgefallenen Milchzähne … und die wenigsten hatte sie auf natürliche Weise verloren.
Beiden Mädchen war die harte Arbeit des Spinnens zuwider. Mit ihren acht Jahren hatte Anna vor Kurzem diese Kunst am Spinnrad ihrer Familie lernen müssen. Serilda hatte ihr Mitgefühl ausgedrückt, als sie davon erfahren hatte, und die Arbeit als Inbild der Langeweile bezeichnet. Diese Bezeichnung hatten die Kinder in jener Woche ständig wiederholt, sehr zu Serildas Belustigung und zum Ärger der Hexe, die eine Stunde lang auf sie eingeredet und die Bedeutung ehrlicher Arbeit betont hatte.
»Bitte, Serilda«, bettelte Gerdrut. »Deine Geschichten sind irgendwie auch Spinnerei. Weil du aus nichts etwas Schönes machst.«
»Also wirklich, Gerdrut, was für eine aufgeweckte Metapher!« Serilda war beeindruckt, weil Gerdrut auf diesen Vergleich gekommen war, aber das liebte sie an den Kindern. Sie überraschten sie stets aufs Neue.
»Du hast vollkommen recht, Gerdi«, sagte Hans. »Serildas Geschichten verwandeln unsere dumpfe Lebenswelt in etwas Besonderes. Als würde sie … Stroh zu Gold spinnen.«
»Jetzt schmiert ihr mir aber wirklich Honig ums Maul«, schimpfte Serilda, während sie nach oben zum Himmel schaute, der sich rasch verdunkelte. »Schön wär’s, wenn ich Stroh zu Gold spinnen könnte. Das wäre sehr viel nützlicher als dieses … Spinnen alberner Geschichten. Beziehungsweise das Verderben eurer Gemüter, wie Fräulein Sauer es ausdrücken würde.«
»Das verfluchte Fräulein Sauer!«, rief Fricz. Sein Bruder warf ihm einen warnenden Blick zu, weil er so ausfällig geworden war.
»Hüte deine Zunge, Fricz«, sagte Serilda, die eine Ermahnung für angebracht hielt, obwohl sie sich insgeheim freute, dass er auf ihrer Seite war.
»Das meine ich ernst. Ein paar Geschichten schaden doch nicht. Sie ist nur neidisch, weil sie uns höchstens etwas über tote Könige und ihre zwielichtigen Nachfolger erzählen kann. Sie würde eine gute Geschichte nicht einmal erkennen, wenn sie sie in die Nase beißen würde.«
Die Kinder lachten, bis der Ast, an dem Anna hing, plötzlich knackte und Anna im Schnee landete.
Serilda schrie auf und rannte zu ihr. »Anna!«
»Ich lebe noch!«, sagte Anna. Das war ihr Lieblingssatz, den sie häufig aussprechen musste. Sie befreite sich von dem Ast, setzte sich auf und strahlte die anderen an. »Gut, dass Solvilde für all den Schnee gesorgt hat, um meinen Sturz abzufedern.« Kichernd schüttelte sie den Kopf, sodass zahllose Schneeflocken auf ihre Schultern fielen. Als sie fertig war, sah sie blinzelnd zu Serilda auf. »So. Du erzählst uns jetzt, wie die Geschichte ausgeht, nicht wahr?«
Serilda bemühte sich um ein missbilligendes Stirnrunzeln, wusste aber selbst, dass sie ihre Rolle als reife Erwachsene mehr schlecht als recht ausfüllte. »Ihr lasst nicht locker und ich muss zugeben, dass ihr ziemlich überzeugend seid.« Sie seufzte schwer. »Na gut. Na gut! Eine schnelle Geschichte, denn heute Nacht ist die Wilde Jagd los und wir sollten alle rechtzeitig nach Hause gehen. Kommt her.«
Sie pflügte eine Gasse durch den Schnee zu einem kleinen Hain, wo sich unter den Bäumen ein Ruhekissen aus trockenen Kiefernnadeln befand und die herabhängenden Äste ein wenig Schutz vor der Kälte boten. Eifrig scharten sich die Kinder um Serilda, setzten sich zwischen die Wurzeln und schmiegten die Schultern aneinander, um die geringe Wärme zu teilen.
»Erzähl uns mehr von der Göttin der Lügen!«, bat Gerdrut und rutschte für den Fall, dass sie Angst bekam, vorsichtshalber neben Hans.
Doch Serilda schüttelte den Kopf. »Heute will ich euch eine andere Geschichte erzählen, die besser zum Vollmond passt.« Sie wies zum Horizont, wo der kürzlich aufgegangene Mond die Farbe von sommerlichem Heu angenommen hatte. »Es handelt sich um eine Geschichte über die Wilde Jagd, die bei Vollmond mit ihren Nachtrössern und Höllenhunden durch die Landschaft stürmt. Heutzutage wird die Jagd nur von einem angeführt: vom bösen Erlkönig. Doch vor Jahrhunderten stand nicht der Erlkönig an der Spitze, sondern seine Geliebte Perchta, die berühmte Jägerin.«
Die Neugier der Kinder war geweckt, sie beugten sich mit strahlenden Augen und immer breiterem Lächeln zu ihr vor. Trotz der Kälte wurde Serilda von ihrer eigenen Aufregung gewärmt. Sie erschauerte vor Vorfreude, denn bevor ihr die Worte über die Lippen kamen, wusste sie oft selbst nicht, welche Drehungen und Wendungen ihre Geschichten nehmen würden. Immer wieder staunte sie gemeinsam mit ihren Zuhörern über die Enthüllungen, und auch darum zog sie das Geschichtenerzählen magisch an – weil sie nicht wusste, wie es ausgehen würde oder was als Nächstes passierte. Für sie war es genauso ein Abenteuer wie für die Kinder.
»Die beiden waren sehr verliebt«, fuhr sie fort. »Ihre Leidenschaft ließ Blitze vom Himmel herabfahren. Wenn der Erlkönig seine wilde Geliebte anschaute, war sein schwarzes Herz dermaßen gerührt, dass Stürme über die Meere fegten und Erdbeben die Berggipfel erschütterten.«
Die Kinder verzogen das Gesicht. Sie stöhnten bei jeglicher Andeutung von Romantik – sogar der schüchterne Nickel und die verträumte Gerdrut, obwohl Serilda davon überzeugt war, dass sie es insgeheim genossen.
»Doch ein Schatten lag über ihrer Liebe. Perchta wünschte sich verzweifelt ein Kind. Aber die Finsteren haben mehr Tod als Leben im Blut und können deshalb keine Kinder in die Welt setzen. Ihr Wunsch würde also nicht in Erfüllung gehen – zumindest war Perchta davon überzeugt.« Serildas Augen glänzten, als die Geschichte sich vor ihren Augen entrollte.
»Es schmerzte den Erlkönig in seinem verdorbenen Herzen, dass seine Geliebte Jahr für Jahr unter der Sehnsucht litt, ein Kind ihr Eigen zu nennen. Wenn sie weinte, sammelten sich ihre Tränen zu Regenstürmen, die die Felder unter Wasser setzten. Wenn sie stöhnte, gingen ihre Schreie wie Donner auf die Hügel herab. Als der Erlkönig es nicht mehr ertrug, fuhr er ans Ende der Welt, um die Göttin der Fruchtbarkeit Eostrig anzuflehen, ein Kind in Perchtas Bauch zu pflanzen. Doch Eostrig, die über alles neue Leben wachte, merkte, dass Perchta eher grausam als mütterlich war, und wagte es nicht, einem Kind eine solche Mutter zuzumuten. Der Erlkönig konnte betteln, so viel er wollte – Eostrig ließ sich nicht erweichen. Daraufhin machte sich der Erlkönig auf den Heimweg durch die Wildnis und ihm graute davor, wie enttäuscht seine Geliebte auf diese Nachricht reagieren würde. Aber als er durch den Aschenwald ritt …« Serilda legte eine Kunstpause ein und sah den Kindern nacheinander in die Augen, nachdem diese Worte sie erneut aufgestachelt hatten. Im Aschenwald spielten zahlreiche Märchen, nicht nur ihre.
Hier lag der Ursprung für mehr überlieferte Geschichten, mehr Nachtängste und Aberglauben, als sie zählen konnte, insbesondere hier in Märchenfeld. Der Aschenwald lag unmittelbar nördlich ihrer kleinen Stadt, nur einen kurzen Ritt über die Felder entfernt, und übte seine unheimliche Wirkung vom Kleinkindalter an auf alle Einwohner aus. Früh wurden sie gewarnt vor den Kreaturen, die in diesem Wald hausten, von albernen Wesen, die nur auf Streiche aus waren, bis zu jenen, die verdorben und grausam waren.
Nun wurden die Kinder allein von diesem Namen verzaubert. Serildas Geschichte von Perchta und ihrem Erlkönig war keine Geschichte aus der Ferne mehr. Jetzt spielte sie sich praktisch vor ihrer Haustür ab.
»Während er durch den Aschenwald trabte, hörte der Erlkönig ein höchst unangenehmes Geräusch. Ein Schniefen, ein Schluchzen. Feucht, blubbernd, widerlich, das zumeist einherging mit … feuchten, blubbernden, widerlichen Kindern. Schließlich sah er den armen Bengel, der auf seinen pummeligen Beinen gerade erst laufen gelernt hatte. Ein von Kopf bis Fuß zerkratzter, verdreckter Menschenjunge, der heulend nach seiner Mutter rief. Und plötzlich hatte der Erlkönig eine abscheuliche Idee.«
Als Serilda lächelte, lächelten die Kinder zurück, denn auch sie konnten sich denken, wohin die Reise ging.
Dachten sie zumindest.
»In diesem Sinne packte der Erlkönig das Kind an seinem schmutzigen Nachthemd und warf es in einen der großen Säcke, die an den Flanken seines Pferdes hingen. Und dann galoppierte er los und raste zur Burg Gravenstein zurück, wo Perchta ihn sehnsüchtig erwartete.
Als er seiner Geliebten das Kind zeigte, freute sie sich so sehr, dass sogar die Sonne heller strahlte. Monate vergingen, und Perchta verwöhnte das Kind, wie es nur eine Königin vermochte. Sie nahm den Jungen auf Ausflüge in die abgestorbenen Moore mit, die tief im Wald lagen. Sie badete ihn in Schwefelquellen und kleidete ihn in die Häute der feinsten Tiere, die sie je erlegt hatte: in das Fell eines Rasselbocks und die Federn eines Stoppelhahns. Sie wiegte ihn in den Ästen von Weiden und sang ihn in den Schlaf. Sie schenkte ihm sogar einen eigenen Höllenhund, auf dem er reiten und seine jagende Mutter auf ihren monatlichen Ausritten begleiten durfte. Jahrelang war Perchta zufrieden.
Doch im Laufe der Zeit fiel dem Erlkönig auf, dass seine Geliebte erneut von Melancholie befallen wurde. Als er sie eines Nachts fragte, was sie auf dem Herzen habe, zeigte Perchta mit einem kummervollen Schrei auf den kleinen Jungen – der kein Baby mehr war, sondern sich zu einem drahtigen, willensstarken Kind entwickelt hatte – und sagte: ›Ich habe mir nichts mehr gewünscht als ein eigenes Baby. Aber ach, dieses Wesen, das da vor mir steht, ist kein Baby mehr. Es ist zum Jungen herangewachsen und wird bald ein Mann sein. Ich will ihn nicht mehr haben.‹«
Nickel schrie vor Entsetzen auf, dass eine scheinbar so zugewandte Mutter so etwas sagen konnte. Er war ein sensibler Junge, und Serilda hatte ihm vielleicht noch nicht genug alte Sagen erzählt, die häufig damit begannen, dass Eltern oder Stiefeltern äußerst ungehalten über ihren Nachwuchs waren.
»Und deshalb brachte der Erlkönig den Jungen in den Wald zurück, gaukelte ihm vor, dass er mit ihm Bogenschießen üben wolle und dass sie einen Wildvogel für einen Festschmaus mit nach Hause bringen würden. Doch als sie tief genug im Wald waren, zog der Erlkönig sein langes Jagdmesser aus dem Gürtel, schlich sich von hinten an den Jungen an, …«
Die Kinder wichen erschrocken vor Serilda zurück und Gerdrut vergrub ihr Gesicht in Hans’ Arm.
»… schnitt ihm die Kehle durch und ließ ihn sterbend in einem kalten Bach zurück.«
Serilda wartete kurz, bis Schock und Abscheu nachließen, und fuhr dann fort. »Anschließend machte sich der Erlkönig auf die Suche nach frischer Beute. Keine wilden Tiere diesmal, sondern ein neues Menschenkind für seine Geliebte. Und seitdem verschleppt der Erlkönig verirrte kleine Kinder in seine Burg.«
Kapitel 3
Serilda war fast zu einem Eiszapfen gefroren, als das Licht des Häuschens in Sicht kam, das den Schnee in ein goldenes Licht tauchte. Der volle Mond sorgte für so viel Helligkeit, dass sie auch die Getreidemühle dahinter und das Wasserrad am Ufer des Flusses Sorge gut erkennen konnte. Als sie den Holzrauch roch, gab ihr das neuen Schwung für die letzten Meter über das Feld.
Sicherheit.
Wärme.
Zu Hause.
Sie riss die Haustür auf und taumelte mit einem theatralischen Seufzer der Erleichterung in die Stube. Dann lehnte sie sich an den Holzrahmen und zog rasch ihre durchweichten Stiefel und Strümpfe aus, die sie halb durch den Raum warf, wo sie mit einem nassen Platscher neben dem Kamin landeten.
»Mir … ist so … k-kalt.«
Ihr Vater sprang von seinem Sessel am Kamin auf, in dem er ein Paar Socken gestopft hatte. »Wo warst du bloß? Die Sonne ist schon vor über einer Stunde untergegangen!«
»T-tut mir leid, Papa«, stammelte sie und hängte ihren Umhang an einen Haken an der Tür. Dann zupfte sie mit spitzen Fingern den Schal von ihrem Hals und hängte ihn dazu.
»Und wo sind deine Handschuhe? Jetzt sag ja nicht, du hast sie schon wieder verloren.«
»Nicht verloren«, hauchte sie und zog den zweiten Sessel näher ans Feuer heran.
Serilda legte einen Fuß über ihr Knie und massierte Gefühl in ihre Zehen. »Ich war noch lange bei den Kindern und wollte sie nicht allein im Dunkeln nach Hause gehen lassen. Also habe ich sie nacheinander begleitet. Und die Zwillinge wohnen weit weg auf der anderen Flussseite und dann – oh, es ist schön, zu Hause zu sein.«
Ihr Vater runzelte die Stirn. Er war noch kein alter Mann, aber die Sorgenfalten hatten sich schon vor langer Zeit in seine Züge gegraben. Vielleicht lag es daran, dass er allein ein Kind großziehen und den Klatsch der übrigen Städter abwehren musste, oder er hatte von jeher die Veranlagung, sich Sorgen zu machen, berechtigt oder nicht. Als Serilda klein gewesen war, hatte sie ihm ständig Geschichten erzählt, in welch gefährliche Situationen sie sich gebracht hatte, und sich an seinem Entsetzen ergötzt, bevor sie ihm lachend gestanden hatte, dass sie sich das alles nur ausgedacht hatte.
Mittlerweile sah sie ein, dass dies nicht das Beste für den Menschen war, den sie am meisten liebte.
»Und die Handschuhe?«, fragte er noch mal.
»Ich habe sie gegen magische Löwenzahnsamen getauscht.«
Er warf ihr einen bösen Blick zu.
Serilda lächelte kleinlaut. »Nein, ich habe sie Gerdrut geschenkt. Wasser, bitte? Ich habe schrecklichen Durst.«
Kopfschüttelnd grummelte ihr Vater vor sich hin, während er zu dem Eimer schlurfte, in dem sie Schnee sammelten, der nachts am Kaminfeuer schmolz. Mit einer Kelle, die er vom Kaminsims nahm, schöpfte er Wasser und reichte es ihr. Es war noch kalt und schmeckte nach Winter.
Ihr Vater kehrte zum Kamin zurück und rührte in dem Hängetopf. »Ich mag es überhaupt nicht, wenn du bei einem Vollmond wie diesem allein draußen bist. Da passiert so einiges, wie du weißt. Kinder gehen verloren.«
Damit brachte er sie unweigerlich zum Lächeln. Die Geschichte von heute war inspiriert gewesen von den über Jahre wiederholten Warnungen vor ungeahnten Schrecken.
»Ich bin kein Kind mehr.«
»Es sind doch nicht nur Kinder. Erwachsene Männer wurden am nächsten Tag benommen aufgefunden und redeten von Kobolden und Nixen. Komm nicht auf die Idee, Nächten wie diesen die Gefahr abzusprechen. Ich dachte, ich hätte dir mehr Verstand mitgegeben.«
Serilda strahlte ihn an, da sie beide wussten, dass seine unablässigen Warnungen und abergläubischen Vorstellungen mehr als alles andere ihre Fantasie angeregt hatten, statt den Selbsterhaltungstrieb zu wecken, den er ihr hatte einimpfen wollen.
»Mir geht es gut, Papa. Ich wurde weder entführt noch von einem Ghul verschleppt. Wer sollte mich denn schließlich auch wollen?«
Er sah sie verärgert an. »Jeder Ghul würde vor Glück zerspringen, wenn er dich bekommen könnte.«
Serilda streckte ihre verfrorenen Finger aus und legte sie auf seine Wangen. Obwohl er zusammenzuckte, wich er nicht zurück und ließ sie gewähren, als sie seinen Kopf neigte und ihm einen Kuss auf die Stirn gab.
»Falls mal einer reinschneit«, sagte sie und ließ ihren Vater wieder los, »teile ich ihm mit, dass du das gesagt hast.«
»Darüber macht man keine Witze, Serilda. Wenn du das nächste Mal befürchtest, bei Vollmond zu spät zu kommen, nimm bitte das Pferd.«
Sie sparte es sich zu betonen, dass Zelig, ihr alter Gaul, der mittlerweile eher zur Dekoration gehörte, als sich auf dem Hof nützlich zu machen, nicht die geringste Chance gegen die Wilde Jagd hätte.
»Das mache ich gern, Papa«, sagte sie stattdessen, »wenn es dich beruhigt. Und jetzt lass uns essen, es riecht köstlich.«
Ihr Vater holte zwei Holzschalen von einem Regal. »Braves Mädchen. Gehen wir lieber vor der Geisterstunde schlafen.«
Die Geisterstunde war da und die Jagd brauste über das Land …
Diese Worte schimmerten in Serildas Gedanken, als sie die Augen aufriss. Im Kamin lagen nur noch glühende Kohlen, die den Raum in ein trübes Licht tauchten. Seit sie denken konnte, stand ihr schmales Bett in der Ecke des ersten Raums an der Haustür, während ihr Vater in dem einzigen anderen Zimmer schlief, das nach hinten rausging. Auf der anderen Seite der Rückwand stand die Getreidemühle. Sie hörte ihn durch die Tür schnarchen und überlegte einen Augenblick lang, ob sie davon wach geworden war.
Plötzlich zerbrach ein glühendes Stück Kohle in sprühenden Funken, die das Mauerwerk versengten, bevor sie schwarz erloschen.
Und dann – ein Geräusch, das so weit entfernt klang, dass sie es sich eingebildet haben konnte, wäre ihr nicht ein eiskalter Schauer über den Rücken gelaufen.
Geheul.
Beinahe wie von einem Wolf, was nicht ungewöhnlich war. Die Nachbarn gaben sich alle Mühe, ihre Herden vor den Raubtieren zu schützen, die ständig auf Beutezug waren.
Doch dieses Aufheulen war anders, irgendwie ruchlos, und wild.
»Höllenhunde«, flüsterte Serilda. »Die Jagd.«
Mit großen Augen saß sie zitternd eine Weile im Bett und lauschte, um festzustellen, ob sie näher kamen oder sich entfernten, doch sie hörte nur das Knacken der Glut und das laute Schnarchen im Nebenzimmer. Allmählich fragte sie sich, ob es nicht doch nur ein Traum gewesen war und sie mit ihren irrlichternden Gedanken nichts als Unruhe schuf.
Serilda legte sich wieder hin und zog die Bettdecke ans Kinn, doch ihre Augen wollten sich nicht schließen. Starr blickte sie auf die Tür, unter der das Mondlicht hereindrang.
Ein weiteres Heulen und noch eins in rascher Abfolge rissen sie wieder in die Höhe. Ihr Herz klopfte wie wild in ihrer Brust. Das Geheul war laut gewesen, viel lauter als zuvor.
Die Jagd kam näher.
Erneut zwang Serilda sich, sich wieder hinzulegen, und sie kniff diesmal die Augen so fest zu, dass ihr Gesicht sich krampfhaft zusammenzog. An Schlaf war nicht mehr zu denken, doch sie musste wenigstens so tun. Dafür hatte sie zu viele Geschichten von Dorfbewohnern gehört, die von der Jagd dazu verführt worden waren, aus ihren Betten zu steigen, nur um in der Morgendämmerung zitternd in ihren Nachthemden am Waldrand aufgefunden zu werden.
Und jene, die Pech hatten, wurden nie wieder gesehen. Wenn sie zurückblickte, hatten Serilda und das Glück nicht viel miteinander zu schaffen. Sie durfte kein Risiko eingehen.
Sie schwor sich zu bleiben, wo sie war, sich nicht zu rühren und nur leise zu atmen, bis die geisterhafte Parade vorübergezogen war. Sollten sie sich doch einen anderen unglückseligen Landmann zur Beute nehmen. So verzweifelt sehnte sie sich dann doch noch nicht danach, dass endlich einmal etwas Spannendes geschah.
Sie machte sich ganz klein, krampfte die Finger in die Bettdecke und wünschte, die Nacht wäre bereits vorbei. Was für eine gute Geschichte sie danach den Kindern erzählen konnte! Selbstverständlich gibt es die Jagd wirklich, ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört …
»Nein – Mädesüß! Hier lang!«
Eine Mädchenstimme, bebend und schrill.
Serilda riss erneut die Augen auf.
Die Stimme war so deutlich gewesen, als käme sie direkt von draußen vor dem Fenster über ihrem Bett, das ihr Vater zu Beginn des Winters als Schutz gegen die Kälte mit einem Brett vernagelt hatte.
Die Stimme ertönte erneut, noch verängstigter: »Schnell! Sie kommen!«
Etwas schlug gegen die Wand.
»Ich versuche es ja«, weinte eine andere Stimme. »Es ist abgeschlossen!«
Sie waren so nah, als könnte Serilda die Hand durch die Wand strecken und sie berühren.
Erschauernd begriff sie, dass jemand in den Keller unter dem Haus eindringen wollte.
Sie wollten sich verstecken.
Wer auch immer sie waren, sie wurden gejagt.
Serilda nahm sich nicht die Zeit nachzudenken oder zu erwägen, ob es sich um einen Trick der Jäger handelte, um frische Beute vor die Tür zu locken. Um sie aus ihrem sicheren Bett zu locken.
Sie strampelte sich frei und rannte zur Tür. In Sekundenschnelle hatte sie den Umhang über ihr Nachthemd gezogen und die Füße in die noch immer feuchten Stiefel gesteckt. Sie schnappte sich die Lampe vom Regal und machte sich ungeschickt mit einem Streichholz zu schaffen, bis der Docht aufflammte.
Als Serilda die Tür aufriss, wurde sie von einem starken Windstoß, wirbelnden Schneeflocken und einem überraschten Aufschrei begrüßt. Sie schwenkte die Lampe zur Kellertür. Dort kauerten zwei Gestalten an der Mauer, hielten sich mit langen Armen eng umschlungen und sahen sie mit ihren ungeheuer großen Augen an.
Serilda blinzelte ebenfalls, so staunte sie. Obwohl sie gewusst hatte, dass hier draußen jemand war, hatte sie nicht damit gerechnet, dass es doch eher etwas war.
Diese Wesen waren keine Menschen. Ihre Augen waren wie riesige schwarze Tümpel, ihre Gesichter zart wie die Blüten des Pfaffenhütchens und ihre Ohren lang und spitz und flauschig wie Fuchspinsel. Ihre Glieder bestanden aus gertenschlanken Zweigen und ihre Haut leuchtete im Schein der Laterne goldgelb – Haut, die sie weitestgehend zur Schau stellten. Auch im tiefsten Winter bedeckten die Pelzstücke, die sie trugen, nur wenig mehr als nötig war, um den Anstand zu wahren. Ihr Haar war kurz und wild und bestand, wie Serilda mit ehrfürchtigem Schwindel feststellte, gar nicht aus Haar, sondern aus Flechten- und Moosbüscheln.
»Moosweiblein«, hauchte sie. Trotz ihrer zahlreichen Geschichten über die Finsteren, die Naturgeister und alle möglichen Geister und Ghule war Serilda in ihren achtzehn Lebensjahren nur schlichten, langweiligen Menschen begegnet.
Eins der beiden Mädchen sprang auf und stellte sich schützend vor das andere.
»Wir sind keine Diebinnen«, sagte sie scharf. »Wir bitten nur um eine Zuflucht.«
Serilda zuckte zusammen. Sie wusste, dass die Menschen dem Waldvolk mit tiefem Misstrauen begegneten. Es galt als sonderbar. Bestenfalls hier und da hilfreich, schlimmstenfalls vermutete man Diebe und Mörder. Bis zu diesem Tag bestand die Bäckersfrau darauf, dass ihr ältestes Kind ein Wechselbalg war. (Wechselbalg hin oder her, dieses Kind war mittlerweile ein erwachsener und glücklich verheirateter Mann mit vier Kindern.)
Schon wieder hallte Geheul über die Felder, als käme es aus allen Richtungen gleichzeitig.
Serilda erschauerte und sah sich rasch um, doch obwohl die Felder hinter der Mühle vom Vollmond hell erleuchtet dalagen, sah sie keinen Hinweis auf die Jagd.
»Silie, wir müssen los«, sagte die Kleinere der beiden, sprang auf und packte die andere am Arm. »Sie sind gleich hier.«
Silie nickte heftig, hielt aber den Blickkontakt mit Serilda. »Dann ab in den Fluss. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, unseren Duft abzuwaschen.«
Sie verschränkten die Hände und wandten sich zum Gehen.
»Wartet!«, rief Serilda. »Wartet!«
Nachdem sie die Lampe neben die Kellertür gestellt hatte, tastete sie unter der Holzplanke nach dem Schlüssel, den ihr Vater dort aufbewahrte. Obwohl ihre Hände bald taub waren von der Kälte, hatte sie im nächsten Moment aufgeschlossen und riss schwungvoll die breite Falltür auf. Währenddessen musterten die Mädchen sie argwöhnisch.
»Der Fluss führt um diese Jahreszeit wenig Wasser und ist an der Oberfläche schon halb zugefroren. Er würde euch nur wenig Schutz bieten. Kommt herein und reicht mir eine Zwiebel. Ich werde sie an der Tür verreiben; hoffentlich wird euer Geruch genügend überdeckt.«
Die Mädchen starrten sie an, und einen unangenehmen Augenblick lang befürchtete Serilda, sie würden sie wegen des lächerlichen Versuchs, ihnen beizustehen, auslachen. Sie waren das Waldvolk. Wozu brauchten sie die erbärmlichen Bestrebungen von Menschen?
Doch dann nickte Silie. Das kleinere Weiblein – Mädesüß, wenn sie richtig gehört hatte – stieg in die pechschwarze Dunkelheit des Kellers und reichte eine Zwiebel aus einer Kiste nach oben. Kein Wort der Dankbarkeit – stattdessen tiefes Schweigen.
Kaum waren beide drinnen, schloss Serilda die Tür und legte erneut den Riegel vor das Schloss.
Dann riss sie die Zwiebelhaut ab und rieb das Zwiebelfleisch über die Ränder der Falltür. Als ihre Augen tränten, ermahnte sie sich, sich nicht mit unwichtigen Dingen aufzuhalten, wie zum Beispiel dem Schnee, der von der Kellertür gefallen war, als sie sie geöffnet hatte, oder ob die Spur der Moosweiblein die Höllenhunde schnurstracks zu ihr nach Hause führen würde.
Spur … Fußspuren.
Sie wirbelte herum und ließ vor Angst, zwei Paar Fußspuren zu entdecken, die direkt auf sie zuliefen, den Blick über das Feld schweifen.
Doch da war nichts.
Es fühlte sich alles so unwirklich an, dass sie sich in einem lebhaften Traum wähnen würde, hätten ihre Augen nicht so getränt.
Sie warf die Zwiebel mit aller Kraft in den Fluss, wo sie mit einem lauten Platscher landete.
Keine Sekunde später hörte sie das Knurren.
Kapitel 4
Sie stürzten sich auf sie wie der Tod höchstpersönlich – kläffend und mit gefletschten Zähnen rasten sie über die Felder. Sie waren doppelt so groß wie alle Jagdhunde, die sie je gesehen hatte, ihre Ohren reichten ihr fast bis zu den Schultern. Doch sie waren bis auf die Haut abgemagert und die Rippen schienen durch ihr gesträubtes Fell zu stechen. Der Speichel hing in langen Fäden an den vorstehenden Reißzähnen. Am meisten verstörte sie das Glühen, das durch ihre Kehlen, Nüstern und Augen leuchtete – selbst dort, wo sich die räudige Haut zu dünn über ihre Knochen spannte. Als würde kein Blut durch ihre Adern fließen, sondern die Feuer von Verloren.
Serilda blieb kaum Zeit zu schreien, als eine der Bestien sich auf sie warf und vor ihrem Gesicht mit den Kiefern schnappte. Gigantische Pfoten drückten gegen ihre Schultern und warfen sie rücklings in den Schnee. Instinktiv bedeckte sie das Gesicht mit den Armen, während der Höllenhund auf allen vieren über ihr landete und nach Schwefel und Fäulnis stank.
Zu ihrer Überraschung packte er sie nicht mit den Zähnen, sondern wartete. Zitternd wagte Serilda einen Blick durch die Lücke zwischen ihren Armen. Die Augen des Hundes loderten, als er gemächlich witterte und die Luft die Glut hinter den ledrigen Nüstern anfachte. Etwas Nasses tropfte auf ihr Kinn. Serilda schrie auf und versuchte, es wegzuwischen. Sie konnte ein Wimmern nicht unterdrücken.
»Loslassen«, befahl eine Stimme – ruhig und doch scharf.
Der Höllenhund wich zur Seite und ließ Serilda bebend und nach Luft schnappend zurück. Sobald sie sicher war, dass sie von dem Hund befreit war, kam sie auf alle viere und kroch zum Häuschen. Dort schnappte sie sich die Schaufel, die an der Mauer lehnte, und wirbelte herum. Ihr Herz raste, als sie sich wappnete, das böse Tier zu schlagen.
Doch vor ihr standen nicht mehr die Höllenhunde.
Blinzelnd blickte sie zu dem Pferd empor, das nur wenige Schritte von der Stelle, an der sie eben noch gelegen hatte, zum Halten gekommen war. Das muskelbepackte schwarze Kriegsross blies gewaltige Dampfwolken durch seine Nüstern.
Der Reiter wurde vom Mond beschienen. Schön und schrecklich zugleich hatte er eine mattsilberne Haut und Augen in der Farbe dünnen Eises über einem tiefen See. Sein langes schwarzes Haar fiel ihm locker auf die Schultern. Er trug eine elegante Lederrüstung mit zwei schmalen Gürteln an den Hüften, in denen mehrere Dolche und ein gekrümmtes Horn steckten. Über der einen Schulter hing ein Köcher mit Pfeilen. Der Reiter hatte die Ausstrahlung eines Königs, der das Tier, auf dem er saß, selbstbewusst beherrschte. Er war sich des Respekts jeder Person, der er begegnete, sicher.
Er war gefährlich.
Er war prunkvoll.
Und er war nicht allein. Hinter ihm drängten sich mindestens zwei Dutzend Pferde, die bis auf ihre blitzweißen Mähnen und Schweife sämtlich kohlrabenschwarz waren. Jedes Ross trug einen Reiter – Männer und Frauen, jung und alt, die einen in eleganten Gewändern, die anderen in zerrissenen Lumpen.
Es gab auch Geister unter ihnen. Serilda erkannte es daran, wie ihre Umrisse vor dem Nachthimmel waberten.
Andere gehörten den Finsteren an, erkennbar an ihrer überirdischen Schönheit. Unsterbliche Dämonen, die vor langer Zeit aus Verloren entsprungen und ihrem einstigen Herrscher, dem Gott des Todes, entronnen waren.
Und nicht nur sie beobachteten sie, sondern auch die Hunde. Sie hatten dem Kommando ihres Herrn gehorcht, liefen nun hungrig im Hintergrund der Wilden Jagd und erwarteten die nächsten Befehle.
Serilda lenkte ihren Blick wieder auf den Anführer. Obwohl sie wusste, wer er war, wagte sie aus Angst, sie könnte recht behalten, seinen Namen nicht einmal zu denken.
Er sah sie durchdringend an, so wie man einen von Flöhen befallenen Köter ansieht, der einem gerade das Abendessen gestohlen hat. »In welche Richtung sind sie geflohen?«
Serilda lief ein Schauer über den Rücken. Diese Stimme. Heiter. Schneidend. Hätte er in Versen zu ihr gesprochen statt ihr eine einfache Frage zu stellen, wäre sie bereits verhext gewesen.
Doch im Gegenteil, es gelang ihr sogar, einen Teil des Zaubers zu verscheuchen, den er durch sein plötzliches Auftauchen bewirkt hatte. Sie dachte an die Moosweiblein, die in diesem Augenblick nur wenige Schritte von ihr entfernt unter der Kellertür verborgen waren, und sie dachte an ihren Vater im Haus, der hoffentlich noch immer tief und fest schlief.
Sie war mutterseelenallein und hatte die Aufmerksamkeit dieser Kreatur auf sich gelenkt, die mehr Dämon als Mensch war.
Zögerlich stellte sie die Schaufel zurück und fragte: »In welche Richtung ist wer geflüchtet, Mylord?«
Denn er zählte mit Sicherheit zum Adel, wie die Hierarchie auch immer aussah, die unter den Finsteren galt.
Ein König, flüsterte eine Stimme in ihrem Hinterkopf, die sie rasch zum Schweigen brachte. Es war einfach undenkbar.
Er kniff die bleichen Augen zusammen. Die Frage schwebte eine Weile zwischen ihnen in der bitterkalten Luft, während Serilda von Kopf bis Fuß unkontrolliert zitterte. Schließlich trug sie nur ein Nachthemd unter ihrem Umhang und ihre Zehen verloren schnell wieder jegliches Gefühl.
Der Erl–, nein, der Jägersmann, so wollte sie ihn nennen. Der Jäger gab zu ihrer Enttäuschung keine Antwort. Denn hätte er die Moosweiblein gesagt, hätte sie zurückfragen können. Wieso machte er Jagd auf das Waldvolk? Was wollte er von den Weiblein? Sie waren keine wilden Tiere, die man abschlachten und enthaupten und deren Häute und Felle man zur Zierde in ein Burggewölbe hängen konnte.
Jedenfalls hoffte sie, dass er das nicht vorhatte. Allein bei der Vorstellung wurde ihr übel.
Doch der Jäger schwieg und hielt unverdrossen Blickkontakt, während sein Ross vollkommen unnatürlich stillhielt.
Serilda, die Stille grundsätzlich nicht gut ertragen konnte, eine Stille zumal, in der sie von Phantomen und Geistererscheinungen umgeben war, schrie gespielt bestürzt auf. »Oh, ich bitte um Vergebung! Stehe ich Euch im Weg? Bitte …« Sie wich zurück, sank in einen Knicks und winkte ihnen, weiterzureiten. »Beachtet mich gar nicht. Ich wollte mich nur um die Mitternachtsernte kümmern, aber das kann warten, bis Ihr fortgeritten seid.«
Der Jäger rührte sich nicht vom Fleck. Einige andere Rösser, die einen Halbkreis um sie gebildet hatten, stampften mit den Hufen und schnaubten ungeduldig.
Nachdem wieder lange Stille geherrscht hatte, fragte der Jäger: »Willst du dich uns nicht anschließen?«
Serilda musste schlucken. Sie wusste nicht, ob es eine Einladung oder eine Drohung war, doch bei der Vorstellung, mit dieser gespenstischen Gesellschaft zu reiten und an der Jagd teilzunehmen, ergriff hohles Entsetzen ihre Brust.
Sie gab sich große Mühe, bei ihrer Antwort nicht ins Stammeln zu geraten. »Ich würde Euch nichts nützen, Mylord. Zur Jagd bin ich nicht zu gebrauchen und kann mich kaum im Sattel halten. Am besten reitet Ihr weiter und lasst mich meine Arbeit tun.«
Als der Jäger daraufhin den Kopf neigte, empfand sie zum ersten Mal eine Veränderung in seiner kalten Mimik. So etwas wie Neugier.
Zu ihrer Überraschung schwang er ein Bein über den Pferderücken und landete vor ihr auf dem Boden, bevor sie Luft holen konnte.
Im Vergleich zu den meisten anderen Mädchen im Ort war Serilda groß, doch der Erlkö–, der Jägersmann überragte sie beinahe um eine Kopflänge. Sein Körperbau, rank und schlank wie ein Schilfrohr, brachte sie aus dem Gleichgewicht.
Oder wie ein Schwert, dachte sie – vielleicht passte dieser Vergleich besser.
Sie japste, als er noch einen Schritt auf sie zuging.
»Sag bloß«, sagte er leise, »welche Arbeit gedenkst du zu dieser Stunde in solch einer Nacht zu verrichten?«
Sie blinzelte mehrmals und einen grauenerregenden Augenblick lang fiel ihr nichts ein. Sie war nicht nur sprachlos, auch in ihren Gedanken herrschte vollkommene Leere. Dort, wo normalerweise Geschichten, Erzählungen und Lügen lagerten, war nichts mehr vorhanden. Eine solche Ödnis der Gedanken hatte sie noch nie erlebt.
So viel dazu, dass sie aus Stroh Gold spann.
Der Jäger sah sie mit schief gelegtem Kopf herausfordernd an. Er wusste, dass er sie ertappt hatte. Und als Nächstes würde er erneut nach den Moosweiblein fragen. Was blieb ihr anderes übrig, als sie zu verraten? Welche Möglichkeiten blieben ihr?
Denk. Denk nach.
»Wenn ich mich nicht irre, sprachst du vom … Ernten?«, sagte er provozierend und derart leichthin, dass die sanfte Neugier trügerisch klang. Es war ein Trick – eine Falle.
Serilda gelang es, ihren Blick von ihm loszureißen und auf eine Stelle auf dem Feld zu richten, wo sie mit ihren Stiefeln den Schnee aufgewühlt hatte, als sie am Abend nach Hause geeilt war. Geknickte Halme gelblichen Roggens ragten aus dem Matsch.
»Stroh!«, sagte sie, ja, sie schrie es beinahe heraus und überrumpelte damit den Jäger. »Selbstverständlich ernte ich Stroh, was sonst, Mylord?«
Er zog die Augenbrauen zusammen. »In der Neujahrsnacht? Unter einem Schneemond?«
»Aber sicher doch. Jetzt ist der beste Zeitpunkt. Ich meine … also nicht an Neujahr, sondern … bei Vollmond. Sonst ist es eher ungeeignet zum … Spinnen.« Sie schluckte, bevor sie ziemlich nervös hinzufügte: »Zu Gold?«
Sie rundete diese absurde Aussage mit einem frechen Lächeln ab, das der Jäger nicht erwiderte. Er fixierte sie nach wie vor, misstrauisch, aber auch … irgendwie interessiert.
Serilda schlang die Arme um ihren Körper, zugleich als Schild gegen seinen durchtriebenen Blick und gegen die Kälte. Sie zitterte so sehr, dass ihre Zähne klapperten.
Schließlich ergriff der Jäger erneut das Wort, doch was auch immer sie gehofft oder erwartet hatte, das jedenfalls nicht:
»Du trägst das Mal von Hulda.«
Ihr Herz setzte einen Schlag aus. »Hulda?«
»Göttin der Arbeit.«
Sie starrte ihn mit offenem Mund an. Selbstverständlich wusste sie, wer Hulda war. Schließlich gab es nur sieben Götter – die konnte man schon im Kopf behalten. Hulda wurde zumeist mit guter, ehrlicher Arbeit in Verbindung gebracht, wie Fräulein Sauer sagen würde. Von der Landwirtschaft über die Zimmerei und insbesondere das Spinnen.
Sie hatte gehofft, die nächtliche Dunkelheit würde ihre merkwürdigen Augen mit den Speichen des goldenen Rades verbergen, doch der Jäger hatte vielleicht die scharfen Augen einer Eule, wie es einem durch und durch nächtlichen Jäger anstand.
Er hatte das Mal als Spinnrad gedeutet. Serilda wollte schon den Mund öffnen und ausnahmsweise die Wahrheit sagen, nämlich, dass sie nicht von der Göttin des Spinnens, sondern von der Göttin der Lügen gezeichnet war. Das Mal, das er betrachtete, war das Rad des Schicksals und des Glücks – oder Unglücks, wie es doch häufiger der Fall zu sein schien.
Es war ein naheliegender Irrtum.
Doch als sie merkte, dass diese Deutung ihres Mals ihrer Lüge, Stroh zu ernten, eine gewisse Glaubwürdigkeit verlieh, zuckte sie wegen der Zauberei, die ihr zugetraut wurde, ein wenig verschämt mit den Schultern.
»Ja«, sagte sie plötzlich recht schwächlich, » Hulda gab mir ihren Segen vor meiner Geburt.«
»Zu welchem Zweck?«
»Meine Mutter war eine begabte Schneiderin«, log Serilda. »Sie schenkte Hulda einen eleganten Umhang, und die Göttin war so begeistert, dass sie meiner Mutter versprach, ihr erstgeborenes Kind mit wundersamen Fähigkeiten zu segnen.«
»Stroh zu Gold zu spinnen«, näselte der Jäger ungläubig.
Serilda nickte. »Ich sage es nicht so gern weiter. Die anderen Maiden könnten neidisch werden, die Männer gierig. Ich vertraue darauf, dass Ihr mein Geheimnis bewahrt.«
Einen kurzen Moment lag wirkte der Jäger belustigt, doch dann trat er noch einen Schritt näher. Kein Lüftchen regte sich mehr, es wurde sehr, sehr kalt. Serilda spürte die Berührung des Frostes und merkte jetzt erst, dass der Jäger beim Atmen keine Dampfwolke ausstieß.
Etwas Spitzes drückte unter ihr Kinn. Serilda schrie leise auf. Sie hätte es doch bemerkt, wenn er eine Waffe gezückt hätte, doch sie hatte weder gesehen noch gefühlt, dass er sich auch nur bewegt hatte. Und doch hielt er ihr ein Jagdmesser an die Kehle.
»Ich frage dich noch einmal«, sagte er beinahe freundlich. »Wo sind die Waldwesen?«
Kapitel 5
Serilda hielt dem seelenlosen Blick des Jägers stand und fühlte sich zu zart, zu verletzlich.
Dennoch regte sich ihre Zunge – ihre dumme, verlogene Zunge – und plapperte drauflos. »Mylord«, sagte sie mit einem Hauch von Sympathie, als wäre es peinlich, das sagen zu müssen, da ein derart erfahrener Jäger sicherlich nicht gern einfältig dastand, »das Waldvolk lebt im Aschenwald, westlich von der Großen Eiche. Und … auch ein bisschen weiter nördlich, glaube ich. So heißt es jedenfalls in den Legenden.«
Zum ersten Mal flackerte so etwas wie Wut über die Züge des Jägers. Wut – aber auch Verunsicherung. Er wusste nicht, ob sie sich über ihn lustig machte oder nicht.
Nicht einmal ein mächtiger Tyrann wie er hatte ein Gefühl dafür, ob sie log.
Serilda hob die Hand und legte ihre Finger sehr sanft auf sein Handgelenk.
Bei dieser unerwarteten Berührung zuckte der Jäger zusammen.
Und sie staunte darüber, wie sich seine Haut anfühlte.
Obwohl sie an den Fingern fror, strömte doch noch warmes Blut hindurch.
Im Gegensatz zu der Haut des Jägers, die geradezu mit Frost überzogen war.
Ohne Vorwarnung riss er sich los und befreite sie somit von der unmittelbaren Bedrohung durch sein Jagdmesser.
»Ich möchte nicht respektlos erscheinen«, sagte Serilda, »aber ich muss wirklich mit meiner Arbeit fortfahren. Der Mond zieht bald vorüber und dann ist das Stroh nicht mehr biegsam. Wenn möglich, nehme ich nur die besten Zutaten.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, packte sie erneut die Schaufel und einen Eimer, aus dem der Schnee quoll. Diesen kippte sie sogleich aus und wagte es, mit erhobenem Kopf an dem Jäger und seinem Ross vorbei aufs Feld hinauszugehen. Die übrige Jagdgesellschaft wich zurück, um ihr Platz zu machen, während Serilda die oberste Schneeschicht abtrug und das darunterliegende zerdrückte Getreide zum Vorschein brachte – die wenigen traurigen Halme, die von der Herbsternte geblieben waren.
Wie Gold sahen sie nicht aus.
In welch lächerliche Lüge das alles mündete.
Doch Serilda wusste, dass nur der größtmögliche Einsatz jemanden von der Unwahrheit überzeugen konnte. Deshalb zog sie die Halme mit gleichmütiger Miene und ihren nackten, frierenden Händen heraus und warf sie in den Eimer.
Lange Zeit war außer ihren Machenschaften, dem gelegentlichen Scharren der Pferdehufe und dem leisen Knurren der Hunde nichts zu hören.
»Ich habe Geschichten über Goldspinnerinnen gehört, die von Hulda gesegnet waren«, sagte plötzlich eine helle, raue Stimme.
Serilda schaute zu dem Ross, das ihr am nächsten war. Die Reiterin war blass, an den Rändern leicht verschwommen und hatte ihr Haar zu einer hohen Krone geflochten. Sie trug Reithosen und eine Lederrüstung mit einem dunkelroten Fleck, der sich über die ganze Länge der Tunika zog. Ekelerregend viel Blut – das zweifellos aus der tiefen Schnittwunde an ihrem Hals stammte.
Sie erwiderte Serildas Blick – vollkommen gefühllos – und sah dann den Anführer der Jagdgesellschaft an. »Ich glaube, sie sagt die Wahrheit.«
Der Jäger reagierte nicht. Stattdessen hörte Serilda das Knirschen seiner Stiefel, als er durch den Schnee stapfte, bis er hinter ihr stand. Sie senkte den Blick und konzentrierte sich auf ihre Arbeit, obwohl die Roggenhalme in ihre Hand stachen und der Matsch bereits unter ihren Fingernägeln trocknete. Warum hatte sie die Handschuhe nicht mitgenommen? Kaum hatte sie das gedacht, fiel ihr wieder ein, dass sie sie Gerdrut geschenkt hatte. Sie musste überaus närrisch wirken.
Stroh scheffeln, um es zu Gold zu spinnen. Ehrlich, Serilda, von allen gedankenlosen und absurden Dingen, die du hättest sagen können …
»Wie schön zu hören, dass Huldas Gabe nicht verschwendet wurde«, säuselte der Jäger. »Wirklich eine seltene Kostbarkeit.«