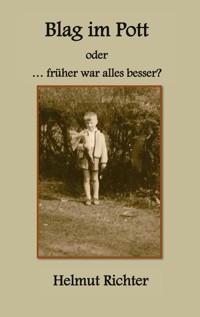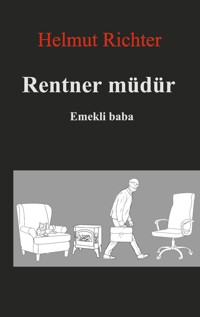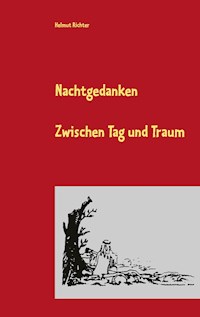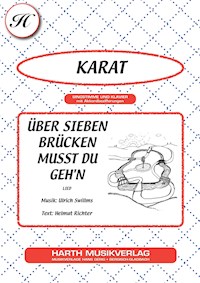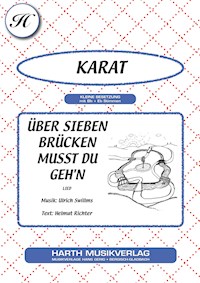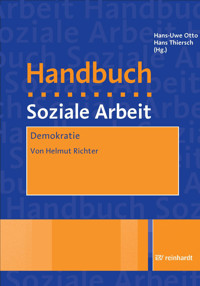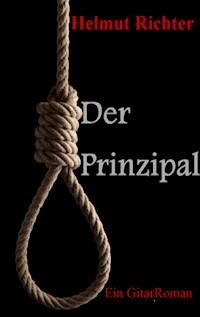Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Konzertgitarre erlebte ab der Mitte der 1960er Jahre in Deutschland, aber auch weltweit, einen bis dahin ungekannten "Boom", der sich im Lauf der 1970er-Jahre immer weiter aufbaute und bis in die heutigen Tage nachwirkt. Hauptsächlich spielte sich das Geschehen in den damaligen Zentren der Gitarrenmusik wie Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin und München ab, aber auch in der "Provinz" wurde die rasante Entwicklung deutlich spürbar. In diesem Buch wird diese Zeit aus dem Blickwinkel eines autodidaktischen Anfängers auf der Konzertgitarre im Ruhrgebiet humorvoll beschrieben, wie sie sicher auch viele seiner Gitarre spielenden Zeitgenossen oder auch Gitarren-Aficionados (span.: Gitarrenliebhaber) so oder ähnlich erlebt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Die Konzertgitarre erlebte ab der Mitte der 1960er Jahre in Deutschland, aber auch weltweit, einen bis dahin ungekannten „Boom“, der sich im Lauf der 1970er-Jahre immer weiter aufbaute und bis in die heutigen Tage nachwirkt. Hauptsächlich spielte sich das Geschehen in den damaligen Zentren der Gitarrenmusik wie Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin und München ab, aber auch in der „Provinz“ wurde die rasante Entwicklung deutlich spürbar. In diesem Buch wird diese Zeit aus dem Blickwinkel eines autodidaktischen Anfängers auf der Konzertgitarre im Ruhrgebiet humorvoll beschrieben, wie sie sicher auch viele seiner Gitarre spielenden Zeitgenossen oder auch Gitarren-Aficionados (span.: Gitarrenliebhaber) so oder ähnlich erlebt haben.
Autor
Helmut Richter (*1955) absolvierte mit 15 Jahren nach seinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Anschließend besuchte er ein Sterkrader Gymnasium, legte sein Abitur ab und studierte Gitarre am Robert-Schumann-Institut in Düsseldorf sowie Maschinenbau, Erziehungswissenschaften und Physik an der Universität Duisburg. 1982 Prüfung zum Musikerzieher, 1983 erstes Staatsexamen in Maschinenbau und Physik. Später zusätzliche Studien in Psychologie und Neurobiologie.
Promotion zum Dr. phil. (Berufspädagogik). Zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen, Buchveröffentlichungen und Veröffentlichungen eigener Kompositionen. Bundesgeschäftsführer der European Guitar Teachers Association. Bis zur Pensionierung 2021 Schulleiter eines Berufskollegs in Duisburg-Rheinhausen.
Inhalt
Vorwort
Der Start
Neue Horizonte
Biermann und der Gitarrentraum
Szeneeinstieg
Konzertgitarre
Schallplatten
Auf der Suche nach einer Gitarre
Siegfried Behrend
Neustart
Erstes Geld
Inner Circle
Gitarrenboom
Abschluss
Weißgerber und andere
Epilog
Weitere Bücher und Cds
Gitarre (Deutsch); Substantiv, f
Alternative Schreibweisen: Guitarre
Worttrennung: Gi·tar·re, Plural: Gi·tar·ren
Aussprache: IPA: [ɡiˈtaʁə]
Bedeutungen: ein populäres Zupfinstrument mit vier bis zwölf Saiten. Abkürzungen: Git.
Herkunft: Stammt von dem griechischen Wort κιθάρα (kithara☆) → grc „Kithara“, ein Saiteninstrument der
Antike. Über Arabisch ة راثيق(qīṯārah) → ar, dann Spanisch guitarra → es in andere europäische Sprachen.
Das Wort ist seit dem 17. Jahrhundert belegt.
Synonyme: umgangssprachlich: Klampfe, Zupfgeige
Oberbegriffe: Zupfinstrument, Saiteninstrument (…)
Unterbegriffe: Akustikgitarre, Bassgitarre, Hawaiigitarre, Konzertgitarre, Leadgitarre, Mondgitarre, Rhythmusgitarre, Westerngitarre, E-Gitarre, Zwölfsaiter Charakteristische Wortkombinationen: an einer Gitarre tüddeln, akustische Gitarre, elektrische Gitarre, das Geschrammel einer Gitarre, Gitarre spielen, Gitarre stimmen, Gitarre zupfen
Ruhrpott, Substantiv, m.
Aussprache: [ˈʁuːɐ̯ ˌpɔt]
Bedeutungen: umgangssprachlich: Ballungsraum in
Nordrhein-Westfalen, der Kernbereich liegt zwischen
Duisburg und Dortmund begrenzt durch Rhein, Lippe und Ruhr mit etwa 5,3 Millionen Einwohnern
Herkunft: Determinativkompositum aus dem Namen
Ruhr und dem Substantiv Pott
Synonyme: Kohlenpott, Revier, Ruhrgebiet
Kurzformen: Pott
(Vgl.: www.de.wiktionary.org/wiki)
Vorwort
Ursprünglich hatte ich seit vielen Jahren immer wieder einmal vor, ein Buch über den „Gitarrenboom“ in Deutschland seit dem Anfang der 1970er-Jahre zu schreiben. Schon in den 1960er-Jahren spielten einige Gitarristen auf nationalen und internationalen Bühnen auf sehr hohem technischen und künstlerischen Niveau, zu nennen sind hier insbesondere der Spanier Andrés Segovia, die Franzosen Ida Presti und Alexandre Lagoya und der junge Brite Julian Bream. In den 1970er-Jahren jedoch baute sich förmlich eine Welle der Begeisterung für die Konzertgitarre auf, die bis weit in die 1980er-Jahre hinein dauerte und deren Ausläufer noch heute zu spüren sind.
Sehr schnell stellte ich bei der Recherche jedoch fest, dass die Entwicklungen in der Gitarrenszene in Deutschland sehr heterogen, manchmal sogar konträr verliefen, sodass eine intensive, wissenschaftsorientierte Betrachtung der Gitarre in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, wenn man allen Seiten und deren Protagonisten auch nur ansatzweise gerecht werden will.
Als Lösung des Dilemmas bot sich für mich an, meine eigene,1sicher nicht untypische, Entwicklung an und auf der Gitarre und deren Umfeld niederzuschreiben, aus der Sicht eines vollkommen naiven und ahnungslosen Anfängers, der sich als Autodidakt allmählich in die kleine Welt der Konzertgitarre hineinfindet. In dieser Hinsicht ging es nämlich mir genauso, wie vielen anderen Altersgenossen auch: Ausbildungsmöglichkeiten für die Konzertgitarre waren kaum vorhanden; die einzigen Maßstäbe, an denen man sich messen konnte, waren die Schallplatten (die man übrigens mühevoll suchen musste) der damals schon großen Protagonisten der Konzertgitarre. Wir alle fummelten uns ohne ein weiteres Regulativ wie Lehrer oder andere Musiker irgendwie in die Literatur hinein, gingen falsche Wege, korrigierten, scheiterten, korrigierten erneut, so lange, bis wir den richtigen Weg gefunden hatten.
Das war im Vergleich zu den heutigen Ausbildungsmöglichkeiten mühsam und aufwändig und manchmal auch deprimierend, aber auch immer wieder spannend und anregend. Heute hingegen besteht ein vielfältiges Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten für angehende Gitarristen, aber leider auch ein viel größeres Angebot am gitarristischen Musikmarkt, das diesen Vorteil zu großen Teilen wieder zunichtemacht. Viele Absolventen der Musikhochschulen, ja, teilweise sogar schon Landessieger im Wettbewerb „Jugend musiziert“ spielen heute auf technisch höherem Niveau als die damaligen Inhaber von Hochschulstellen für die Konzertgitarre, aber im Gegenzug ist das Angebot an sehr guten Gitarristen und damit auch der Konkurrenzdruck extrem gewachsen.
Das vorliegende Buch mag sich an vielen Stellen wie eine Autobiografie lesen, ist aber – wie schon erwähnt – überhaupt nicht so gemeint, denn so wichtig fühle ich mich weder auf der Welt noch in der Gitarrenszene. Ich habe nur an meiner eigenen gitarristischen Biografie festgemacht, wie ich „in der Provinz“ die Entwicklung der Konzertgitarre im (West-) Deutschland der 1970er und 1980er-Jahre erlebt habe, mehr nicht. Aber – nochmals – ich bin mir sicher, dass viele Gitarristen meiner Generation solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen meiner kleinen, persönlichen Zeitreise durch die kleine Welt der Konzertgitarre, die mir aber – um im Bild zu bleiben – viele große Reisen und Erlebnisse ermöglichte.
Oberhausen, im Dezember 2024
P.S.: Alles Beschriebene ist wirklich so geschehen. Namen wurden geändert oder auf Vor- oder Spitznamen beschränkt.
1971 – 1983
Adivinanza De La Guitarra
von
Federico García Lorca
El Polifemo de Oro
En la redonda
encrucijada,
seis doncellas
bailan.
Tres de carne
y tres de plata.
Los sueños de ayer las buscan
pero las tiene abrazadas
un Polifemo de oro.
¡La guitarra!
Sechs Jungfern tanzen
wo sich die Wege
auf der Rundung
kreuzen.
Drei aus Fleisch
und drei aus Silber
es suchen sie des Gestern Träume
doch hält sie fest in seinen Armen
ein goldner Polyphem:
Die Gitarre
(Übersetzung von L. Beck)
1 So, wie ich es in meinem Buch „Blag im Pott“ getan habe.
Der Start
September 1971.
Dieter, Udo, Klaus und ich standen während der Zigarettenpause des Kirchenchores, in dem ich in der Bassstimme mitbrummte, vor dem Gemeindehaus. Schon seit einigen Tagen waren wir wild entschlossen, eine Band zu gründen und berühmt zu werden. Einen Namen für die Combo hatten wir schon: „The Outsiders“. Udo spielte Akkordeon (!), Dieter konnte leidlich singen und Mundharmonika (!) spielen, Klaus traute sich zu, ein Schlagzeug zu bedienen, weil er meinte, ein gutes Taktgefühl zu haben – nur ich war mit meinen Blockflötenkenntnissen aus dem Musikunterricht an der Realschule wohl eher etwas fehl am Platze. Uns allen war klar, dass zu einer „richtigen“ Band noch die Gitarre fehlte. Also blieb mir – wenn ich als zukünftiges Bandmitglied mit im Rennen bleiben wollte – nichts anderes übrig, Gitarre spielen zu lernen.
Unsere Chorleiterin, Fräulein Oberhoff (sie bestand auf diese Anrede), war eine sehr rührige und kompetente Kirchenmusikerin, die ihr ganzes Leben der Musik gewidmet hatte. Hauptamtlich spielte sie natürlich auf der Orgel, aber sie besaß wohl noch aus Studienzeiten eine Wandergitarre der Firma Höfner und erklärte sich nach intensiver Bearbeitung durch unseren Akkordeonspieler bereit, mir das Instrument für eine gewisse Zeit leihweise zur Verfügung zu stellen.
Ich hatte gerade – mehr schlecht als recht – die Realschule verlassen und war seit dem 1. September Schlosserlehrling bei der Gutehoffnungshütte GHH, in Oberhausen schlicht „Hütte“ genannt. In meiner Freizeit sang ich im Kirchenchor und machte im „Sing- und Spielkreis“ mit, das war sozusagen die Jugendabteilung des Kirchenchores.
Es war die Zeit, in der in Oberhausen noch Kohle gefördert und Stahl gekocht wurde. In den Wintermonaten färbte sich der Schnee nach kurzer Zeit schwarz, so schmutzig war die Luft. In den Abendstunden leitete die Ruhrchemie die nach faulen Eiern stinkenden Abgase in die Luft, die gesamte Stadt war verpestet, dreckig und roch nach Arbeit und Schweiß. Die Essener Straße, heute Zubringerstraße zu einem riesigen Einkaufstempel, galt als die schmutzigste Straße Deutschlands, wenn nicht sogar Europas.
Das Gitarrespielen versprach mir eine schöne Abwechslung zum tristen täglichen Feilen, Bohren und Hämmern in der Lehrwerkstatt, zumal ich als Kind schon gerne auf diesem Instrument spielen gelernt hätte. Meine Eltern meinten jedoch, es wäre sinnvoller, mit der Blockflöte anzufangen. Welcher Weg von der Blockflöte zur Gitarre führen sollte, ist mir nie so richtig klar geworden, aber immerhin konnte ich mit meiner Überei meinen älteren Bruder nerven. Das war doch schon mal etwas.
Abb.1: Wandergitarre „Höfner“
Nun war es denn soweit: Ich holte meine erste – zwar geliehene – Gitarre bei Fräulein Oberhoff ab und hoffte, nach zwei bis drei Tagen üben die ersten Lieder in der noch zu gründenden Band mitspielen zu können. (Wir hatten uns „Hier ist ein Mensch“ von Udo Jürgens als erste Nummer vorgenommen, weil Dieter den Text auswendig konnte.)
Zu Hause angekommen stellte ich erst einmal fest, dass die Saiten der Gitarre ganz locker waren – sie mussten wohl irgendwie gestimmt werden. Von meinem Schulkollegen Otmar – der in der freikirchlichen Gemeinde Gitarrespielen mit dem Schwerpunkt der christlichen Liedbegleitung lernte – wusste ich, dass man zum Stimmen eine Stimmpfeife2brauchte. Also stellte ich die Gitarre in die Ecke und ging zum Musikhaus Möller, nicht ahnend, dass dieser kleine Tante-Emma-Laden der Musik mit seinen bestenfalls 20 Quadratmetern Verkaufsfläche sehr bald zu einem Zentrum meines Lebens werden sollte.
Fräulein Möller (sie bestand ebenfalls auf diese Anrede), die Inhaberin, eine ältliche Dame mit lauter Stimme und nicht enden wollender Redseligkeit, verkaufte mir für ein paar Mark eine Stimmflöte und ein dünnes Heftchen mit 700 Gitarrenakkorden. Ich war davon überzeugt, dass mit dieser umfassenden Grundausstattung der Weg zum perfekten Gitarrespiel inklusive internationaler Berühmtheit nicht mehr weit sei.
Als erste Akkorde nahm ich mir den a-moll und den e-moll vor, sicher eine gute Wahl, sie sind – so wurde mir von Fräulein Oberhoff mit auf den Weg gegeben – recht einfach zu spielen. So einfach war das aber nicht, die Finger immer an der richtigen Stelle auf die Saiten zu setzen, aber – ich wollte ja in der Band mitspielen – vor den Erfolg haben die Götter nun einmal den Fleiß gesetzt, das ahnte ich auch schon mit meinen 15 Lenzen. Also übte ich wie verrückt den Wechsel zwischen den Akkorden e-moll und a-moll, deren Griffbilder ich dem Heftchen entnommen hatte.
Leider klappte das mit dem richtigen Stimmen der Gitarre nicht so ganz gut. Deshalb beschwerten sich meine Eltern und mein großer Bruder immer, wenn ich die Gitarre in die Hand nahm, mein Bruder drohte mir auch manchmal Prügel an, wohl (und zu Recht) ahnend, dass der Wechsel von der Blockflöte zur Gitarre keine auditive Erleichterung seines Alltags versprach.
In der Lehrwerkstatt der Hütte war ich von morgens sieben Uhr bis vier Uhr nachmittags. Das bedeutete, dass ich als geborener Langschläfer um halb sechs mich aus dem Bett herausquälen musste, und nach der Arbeit kam ich um fünf Uhr nachmittags müde und hungrig zurück nach Hause. So hatte ich nur wenig Zeit, mich der Gitarre zu widmen, aber diese spärliche Zeit nutzte ich buchstäblich bis zur letzten Sekunde. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit nahm ich die kleine Höfner von der Wand, an der ich sie aufgehängt hatte, und übte wie besessen die Akkorde e-moll und a-moll. Der Klang der Gitarre hielt mich gefangen, ihr galt mein erster Griff, wenn ich nach Hause kam und die letzten Töne spielte ich, als ich schon fast im Bett lag.
Mein Vater – der von meiner Realschulzeit her keine guten Erfahrungen mit meinem Lernverhalten hatte – beäugte das alles mit allergrößtem Misstrauen. Er meinte, ich solle mich lieber mit der Berufsschule beschäftigen und „etwas Ordentliches“ werden.
Bis Weihnachten hatte ich dann schon einige Griffwechsel sicher ‚drauf‘, nur mit dem Stimmen der Gitarre war es aber immer noch schwierig. Mein einziger Weihnachtswunsch war klar! eine eigene Gitarre, die mein Vater (meine Mutter lag in dieser Zeit mit einem schweren Krebsleiden im Krankenhaus) mir dann tatsächlich im Musikhaus Möller kaufte. Es war eine kleine, vergleichsweise preisgünstige und für Anfänger konzipierte Wandergitarre „Modell „Amateur“ von Framus3