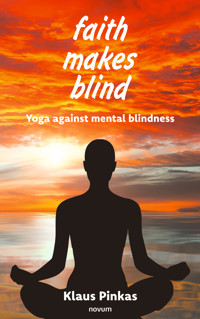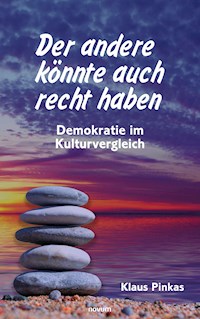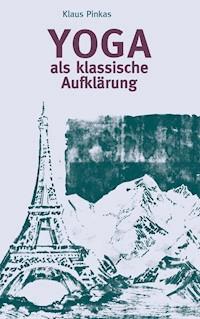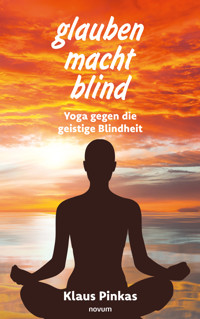
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Menschheit hat sich von ihrer eigenen Natur entfremdet und steuert sehenden Auges auf den Abgrund zu. Denn während das Christentum es verabsäumte, neben dem Glauben auch der Rationalität einen Platz einzuräumen und somit glaubhaft zu sein, hat die Aufklärung es verabsäumt, der puren Rationalität die Spiritualität an die Seite zu stellen. Das Ergebnis ist eine euro-amerikanische Kultur, die keine Wertschätzung für die Natur empfindet und unter der Illusion der Unendlichkeit der Welt leidet. Die Gesellschaft ist jedoch mehr als nur die Summe der gerade lebenden Menschen. Nur wenn wir den Generationenvertrag einhalten, hat die Menschheit in dieser begrenzten Welt eine Überlebenschance. Einen Ausweg aus dieser Sackgasse kennt die Yoga-Philosophie mit der Besinnung als ihrem Kernstück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-751-9
ISBN e-book: 978-3-99146-752-6
Lektorat: Sandra Fantner
Umschlagabbildungen: Taiga, Shymko Svitlana | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
1. Eine Entscheidung mit Folgen
Als ich mit 33 Jahren zum Doktor der Rechtswissenschaft promoviert worden war, ergab sich für meine Frau und mich die Frage, was weiter zu tun wäre. Ich hatte neben meinem Beruf im zweiten Bildungsweg studiert – so blieben nunmehr die Abende, die ich fürs Studium gebraucht hatte, frei. Wir suchten im Verzeichnis der Universität Wien nach Möglichkeiten, Sport zu machen, die allerdings wegen meiner Blindheit durchaus eingeschränkt waren. Wir wählten Reiten, Segeln und Yoga. Aus dem Segeln ist nichts geworden. Zum Reiten sind wir im weiteren Verlauf in Kaschmir gekommen, das wir allerdings nicht wegen des Reitens aufgesucht haben, sondern wegen einer Yoga-Ausbildung in einem indischen Aschram.
Ein halbes Jahr Yoga-Ausbildung in der Universität hatte uns so beeindruckt, dass wir uns auf dieses Abenteuer eingelassen haben.
Wir sind mit dem Zug hingefahren; wir wollten nämlich erfahren, wie weit Indien von Europa entfernt ist. In der Straßenbahn zum Bahnhof hat uns offensichtlich wegen unseres sportlichen Outfits eine Frau gefragt, ob wir auf den Semmering fahren (das ist ein Wandergebiet in der Umgebung Wiens). Und als ich sagte „Nein, weiter“, spürte ich, wie meine Knie weich geworden sind. So viel zur Stimmung zwischen Mut und Sorge beim Start unseres sowohl körperlichen als auch geistigen Abenteuers, das mir in der Folge zu einem zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen Weltbild verholfen hat; ich stelle es im Buch dar. Auf die berufliche Laufbahn beim österreichischen Bundesheer, die sich ohne diesen Einstieg gewiss und nicht so interessant entwickelt hätte, gehe ich am Ende dieses Textes ein.
Das Reiten in den Bergen von Kaschmir, das mir sehr gefallen hätte, gab ich nach zwei Situationen, die beinahe zu schweren Unfällen hätten führen können, wieder auf. Beim Yoga, das wir an der Universität in Wien ernsthaft begonnen hatten und das auch bei Blindheit ohne Weiteres gut zu machen geht, sind wir geblieben; und wir haben die Ausbildung bei einem indischen Guru fortgesetzt. Mich in eine Kultur einzuklinken, in der Blinde Seher geworden sind und vielleicht auch noch werden können, schien interessant genug. In der Bibel kommen Blinde vor allem als Bettler und Bittsteller vor. Im weiteren Verlauf habe ich herausgefunden, dass Blindheit sogar einen gewissen Vorteil für die Kunst des Yoga bilden kann. In der rekursiven Schau, um die es im Yoga geht, sind Subjekt und Objekt ident; beide sind das Gehirn.
In der Bhagavad Gita, in einem der grundlegenden Bücher über die Yoga-Philosophie, ist der König, der der Empfänger der Botschaft ist, blind; das deutet eine Nahbeziehung zwischen Yoga und Blindheit an. Dem König wird der geistige Prozess erzählt, den sein Feldherr im kurzen Moment vor dem Beginn der Schlacht erlebt. Sein Wagenlenker ist eine inkarnierte Gottheit, die ihm das Yogasystem erklärt. Yoga entsteht aus der Kooperation von Bewusstsein und seiner Rationalität mit den Inhalten, die normalerweise im Unbewussten ruhen. Es ist also die Verbindung von Philosophie und Religion. Wenn die konkrete Religion nicht auf Indoktrinierung beschränkt ist, hört sie auf die Sprache der Mystik, in der sich das, was gewöhnlich unbewusst ist, dem Bewusstsein öffnet. Yoga erschließt damit das weite Spektrum des Geistes und fördert die Entwicklung von Weisheit.
Das westliche Denken, in das ich durch mein Studium eingeführt worden bin und die Spiritualität, die ich als Ministrant in der katholischen Kirche entdeckt und mit dem Yoga perfektioniert habe, sind wesentliche Faktoren für mein Verständnis der gesellschaftlichen Prozesse.
2. Die fünf Schichten des Bewusstseins
Die wichtigste Antwort, die es für den Yoga-Aspiranten zu suchen gilt, bezieht sich auf die Frage, wer er sei. Dieser Einstieg mag überraschen; das Staunen mag sich aber relativieren, wenn man ihr die Methode des österreichischen Psychiaters Viktor Frankl zur Seite stellt, „den Sinn seines Lebens suchen“. Um dem Aspiranten dabei zu helfen, zeigt ihm die Yoga-Theorie; es geht um fünf Schichten des Bewusstseins, in die der Aspirant mit einiger Übung Einblick gewinnen kann.
Als erste Schicht gilt der physische Körper; die Körperübungen, die man im Westen gewöhnlich als Yoga kennt, sind in ihrem Herkunftsland Indien nur ein Aspekt einer Erkenntnistechnik, die auf dieser Philosophie beruht. Der Mensch hat einen Körper und es ist gut, wenn er sich in diesem möglichst gut zurechtfindet. Die Hinwendung zum Körper und Yoga-Training stärken nicht nur den Körper, sondern sollen auch eine tiefe Entspannung der Muskeln und der inneren Organe ermöglichen und damit die Ruhe des Geistes herstellen. Die gesundheitlichen Wirkungen beruhen wesentlich auf der direkten Verhinderung von Stress und von den Wirkungen, die durch ungesunde Stressverhinderung wie Alkohol, Nikotin, Drogen und Flucht in die Arbeit verursacht werden. Die Übungen dienen auch dazu, die Fähigkeit zu erlangen, eine entsprechende Zeit eine gut geeignete Sitzhaltung für die Meditation einzunehmen. Für die Übung von Entspannung kann man auch liegen; dabei geht aber der Körper eher in Schlaf über als der Geist in eine Meditation.
Für jeden Fortschritt auf dem Weg ist die Ruhe des Geistes wichtig. So wie nur eine ruhige Oberfläche eines Sees den Blick in seine Tiefe ermöglicht, bietet eine solche Ruhe auch Einblicke in das natürliche Navigationssystem des Menschen. Durch die Erziehung des Menschen wird das Kind kultiviert; durch die Yoga-Technik kann der Erwachsene seine „Urnatur“, die im Unbewussten ruht, wieder erwecken, sodass in ihm Kultur und Natur widerspruchsfrei zusammenwirken können. Der klare Blick durch die Oberfläche, welcher die Manifestationen des Geistes wie Wissen, Erinnerung, Vorstellung und Einbildung ausschaltet, erschließt den Blick auf das ursprüngliche Wesen.
In ihrem Kern ist die Yoga-Technik empirisch; man macht sich zum Beobachter seiner inneren Vorgänge. Bis die Meditation die innere Schau auf die „Urnatur“ freigibt, kommen viel banalere Gedanken in den Sinn – etwa ob man daheim zugesperrt hat oder das Licht abgedreht ist, ob man einen Brief schreiben sollte usw. Es kommt darauf an, die Gedanken nicht zu denken und weiterzuführen, sondern nur wahrzunehmen. Und im Modus der Beobachtung zu bleiben. Kennt man den Beobachter-Modus aus dem täglichen Leben, so hilft diese Fähigkeit bei der Meditation; lernt man ihn in der Meditation, so hilft er fürs tägliche Leben.
Auf der zweiten Stufe auf dem Yoga-Weg beschäftigt sich der Aspirant mit seiner Energie. Er spürt, ob er stark ist oder schwach, energiegeladen oder erschöpft; er spürt aber auch, mit wie viel Energie seine diversen Emotionen ausgestattet sind. Das Mittel, um in seinen Energiehaushalt einzugreifen, ist die Atemtechnik, die eine sehr große Rolle spielt. Das Nervensystem, das auch der Träger der Energieinformation ist, gibt es in zwei Formen:
Das somatische Nervensystem ist dem Willen unterworfen; das vegetative Nervensystem wird normalerweise unwillkürlich gesteuert. Nur mit dem Atem und mit zwei spezifischen Äußerungen (spezifisches Beten und Singen) kann der Mensch Einfluss auf das vegetative Nervensystem nehmen. Viele Yogaschulen arbeiten mit Atemübungen, manche legen ihr Schwergewicht auf Beten und Singen. Dabei geht es darum, auf die Stimme des Inneren zu hören, nicht darum, es zu indoktrinieren. Die Worte oder Sätze, die dafür eingesetzt werden, sind Mantras; und das heißt „Denk-Stopper“ und dient diesem Zweck.
Die dritte ist die Denkschicht; findet der Aspirant Eingang in diese, so nimmt er sein Bewusstsein wahr. Mit der Aufmerksamkeit auf den Körper und auf die Atmung hat er geübt; nun folgt die Beobachtung der geistigen Funktionen. Die Yoga-Theorie fasst sie zusammen als das „vierfache innere Organ“, das aus den Funktionen Bewusstsein, Denken und Erkennen sowie aus dem Ich-Bewusstsein besteht. Indem der Yogi sein eigenes Ich-Bewusstsein aktiviert, gewinnt er auch soziale Intelligenz. Die Demokratie braucht eigenständige Menschen, die die Gemeinschaft im Fokus haben; die Autokratie besteht strukturbedingt aus psychisch abhängigen Menschen, die auf einen Egoisten hineingefallen sind. Oft gibt es auch Mischsysteme; in diesem Fall folgen die Menschen dem sogenannten Radfahrer-System, indem sie nach oben buckeln und nach unten treten („Wer nicht gehorchen lernt, der lernt auch nicht befehlen“).
In Indien gibt es wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt – geistige Strömungen gibt es jedenfalls ohne Zahl. Es gibt da auch geistige Richtungen, die auf die Abstumpfung des Bewusstseins ausgerichtet sind; der Yoga, von dem hier die Rede ist, empfiehlt die Achtsamkeit. Der indische Yogi Swami Vivekananda (1863 bis 1902), der den Yoga als Erster in den Westen gebracht hat, formulierte es so: „Wach auf und steh auf und verwirkliche die unendlichen Kräfte, die in Dir sind“.
Für Kinder ist der Zustand der Aufmerksamkeit natürlich; sie lernen auch gerne – manchmal allerdings hört das auf, wenn sie in die Schule kommen. Aber das liegt dann an der Schule. Wenn Erwachsene das Glück haben, an der Gestaltung ihres Lebens mitzuwirken, so werden sie sich auch für ein interessantes Leben entscheiden; in dem Fall wird waches Bewusstsein Teil ihres Lebens sein. Andererseits können sie sich auch in ein stumpfes Bewusstsein hineindriften lassen. Yoga ist eine kulturell entstandene geistig aktive Lebensform, die lehr- und lernbar ist und die zusätzliche Entscheidungsmöglichkeiten öffnet.
Als Aspekt des Bewusstseins findet das Selbstbewusstsein seinen Ausdruck. Wenn man bedenkt, wie oft auch bei körperlich gesunden Menschen das Selbstbewusstsein in die Nebenzonen Überheblichkeit beziehungsweise Minderwertigkeitsgefühl hinauspendelt, ist das bei körperlichen Defiziten auch kein Wunder. Überheblichkeit und überkompensiertes Minderwertigkeitsgefühl sind bedeutende Mitspieler in privaten und politischen Tragödien.
In meinem Geburtsjahr 1940 stand der Sozialdarwinismus noch in Blüte. Charles Darwin machte einen großen Erkenntnisschritt, indem er die Evolutionslehre entwickelte. Für den Prozess der Evolution nannte er aber bedauerlicherweise die Selektion als das wichtigste Kriterium; dass etwas schon bestanden haben und folglich entstanden sein muss, bevor es selektiert werden kann, ist ihm offensichtlich nicht aufgefallen.
Auf diesen Darstellungsmangel hat erst 150 Jahre später Joachim Bauer in seinem Buch „Das kooperative Gen“ hingewiesen. Aus dem Fehler Darwins hat sich der Sozialdarwinismus entwickelt. Das ist die Lehre, der zufolge alles Leben Überlebenskampf sei. Das hat der Nationalsozialismus zur Staatsdoktrin erhoben und sich gleich das Recht herausgenommen, alles zu vernichten, was ihm nicht passend erschien – darunter auch körperliche und geistige Behinderungen.
In Bezug auf sein Menschenbild war Darwin selbst kein „Sozialdarwinist“; erst die Gehirnforschung unserer Tage stellte die Kooperation und die Kreativität als die primären Evolutionsfaktoren dar und zeigte, dass die Selektion nur sekundär wirken würde. Der Nationalsozialismus hat nach der Idee des Sozialdarwinismus die Konkurrenz, an der er schließlich selbst gescheitert ist, zum Richtmaß erhoben. Diese Idee ist heute noch die Patin der ökonomischen Struktur, an der vorläufig einmal der Lebensraum der Menschen leidet. Nach dem Naturgesetz, das Darwin eigentlich gemeint hat, ist dieses Verhalten für den Menschen unangepasst und jedenfalls nicht optimal.
Wenn sich auch meine genetisch bedingte Erblindung erst nach dieser Zeit zeigte, so hatte die sozialdarwinistische Einstellung doch noch einige Nachwirkungen. Das kann das Selbstbewusstsein schon in Schwierigkeiten bringen. Ich erlebte meine zunehmende Erblindung nicht nur schmerzlich, sondern auch als peinlich. Ich reagierte auf die drohende Erblindung mit Verdrängung; das bringt wenig und ist mühsam. Im Kapitel 8 schreibe ich darüber, was ist, wenn die Verdrängung zur gesellschaftlichen Haltung wird. Heute tickt die Gesellschaft anders; durch die Ideen Integration und Inklusion reduziert sich der gesellschaftliche Druck auf Kranke und Behinderte und das Selbstbild wird nicht mehr durch ein falsches Fremdbild gestört.
In einer Zeit, in der Mangel herrscht und es nicht genug Nahrung für alle gibt, wird das Konkurrenzdenken unvermeidbar sein. Und wenn das Selektionsdenken, das den Kampf in den Mittelpunkt stellt, dominant ist, wird die Not zur Dauereinrichtung. Das gesellschaftlich dominante und das in der Gesellschaft mehrheitlich vorhandene individuelle Bewusstsein können gleich oder verschieden sein; sie nähern sich erst mit der Zeit einander an.
In einer Gesellschaft, in der die Kultur der Kooperation vorherrscht, ist die Gefahr der Enge geringer – in ihr gewinnen Geber und Nehmer. In der Entwicklung der Brillen sahen die Sozialdarwinisten die Gefahr, dass sich auch Menschen mit Augenschaden vermehren könnten. Für die, die Kooperation im Fokus haben, bildet die Entwicklung der Brillenschleiferei die Vorgabe für die Entwicklung von Mikro- und Teleskopie und damit einen Kulturgewinn. So entwickelte auch Peter Mitterhofer die Schreibmaschine für seinen blinden Freund. Diesem half diese Erfindung nicht allzu viel – er konnte nur schreiben, das Geschriebene aber nicht lesen. Insgesamt aber entstand dadurch ein Kulturgewinn. Den antiken Griechen war dieser Gedanke offensichtlich so vertraut, dass sie diesen Modus sogar mythisch darstellten. Die Erfindung des Rades verdankt sich demnach dem gelähmten Halbgott Pelops, um ihm einen Rollstuhl zu machen. Neben dem Krieg, der angeblich der Vater aller Dinge sein soll, ist die Fürsorge die Mutter auch vieler Dinge.
Als vierte Bewusstseinsschicht bezeichnen die Yogis die Funktion, die für Erkenntnis steht. Während Wissen statisch ist, ist Erkenntnis als der Erwerb von Wissen auch dynamisch – Wissen hat man, Erkenntnis gewinnt man; Wissen ohne kluge Umsetzung ist nicht viel Wert. Um in der Ideenwelt erfolgreich zu sein, ist es gut, das Denken für einige Zeit zur Ruhe zu bringen; auf dieser Ebene fließen das Wissen aus der äußeren Welt und das Wissen aus der inneren Schau zusammen und es entwickelt sich Weisheit. Der Prophet Mohammed bezeichnete die Wissenschaftler seiner Zeit als „mit Büchern beladene Esel“. Allerdings ist die Religion, die er initialisiert hat, auch erstarrt. Die deutsche Literatur bringt den folgenden Gedanken in das Thema ein: Was man ererbt hat, müsse man auch erwerben, um es zu besitzen.“
Kreativität, um die es darüber hinaus geht, baut auf guter Wahrnehmung auf und ist auf gute Verarbeitung angewiesen. Für die Erfüllung beider Funktionen bringt Yoga die Meditation ins Spiel, die sowohl die Übung von Konzentration als auch von Entspannung mit sich bringt. Beim Wechsel der verschiedenen Spannungszustände kommt es zu kreativen Momenten, die neue Ideen hervorbringen können.
Nachdenken unterscheidet sich von Meditieren insofern, dass Ersteres Schritt für Schritt rational gesteuert ist; der Meditierende kann ein Thema vorgeben, überlässt aber den Prozess der intuitiven Entwicklung. Meditieren – sich also tiefe Gedanken machen – kann man über alles.
Yoga ist ein Geistestraining durch Achtsamkeit. Meine Yoga-Schule empfiehlt die Konzentration auf bestimmte Körperstellen; einer dieser Punkte ist das Stirnzentrum zwischen den Augenbrauen oberhalb der Nasenwurzel. Wenn an der Stelle der Konzentration ein heller Punkt erscheint, ist man erfolgreich. Zuerst erscheint das Phänomen als diffuser heller Fleck; nach weiterer Übung wird er zu einem ganz kleinen strahlenden Punkt.
Der Stirnpunkt und die anderen körperlichen Konzentrationspunkte betreffen das Zentralnervensystem; ein Punkt befindet sich im Scheitelzentrum, fünf weitere im Verlauf der Wirbelsäule. Das Herz als Meditationspunkt hat auch in der Ostkirche Bedeutung.
Dazu kommen auch Bewusstseinszustände, in denen sowohl der Wachzustand als auch der entspannte Schlafzustand gleichzeitig vorhanden sind. Dieser Zustand tritt beim Aufwachen und beim Einschlafen häufig spontan auf und ist förderlich für die Lösung von Problemen. Die Meditation ist ein Geisteszustand, in dem sich das Bewusstsein zum Unbewussten öffnet. Innerhalb dieser Technik findet sich die besondere Fähigkeit, die Impulse und die Ideen, die aus dem Unbewussten kommen, wahrzunehmen, ohne sie gleich mit Gedanken zu beladen. Eine Meditation ist gut, wenn die aktiven Gehirnfunktionen zur Ruhe gebracht sind und nur die Impulse, die das Gehirn abgibt, betrachtet werden. Der Abgleich zwischen altem Wissen und zugewonnener Erfahrung wird ohnedies im nachfolgenden Normalbewusstsein stattfinden.
Die Kreativität wird auch gefördert, wenn man sich möglichst vorurteilsfrei mit anderen Kulturen beschäftigt, sowohl etwa mit Philosophie- und Religionsgeschichte als auch mit Lebensformen anderer Völker. Im Yoga findet man eine solche andere Auffassungs- und Denkform, die einen wachen Europäer neugierig machen kann. Die Yoga-Philosophie reicht weit hinein in die gesellschaftlichen Belange; die Yoga-Praxis aber beginnt mit der Pflege des eigenen Körpers, der ja vielen Menschen wichtig ist. Der Weg kostet durchaus etwas Mühe, aber durch Wohlbefinden und einige frühe Erkenntnisgewinne kann sich die Mühe bezahlt machen und zum Weitergehen motivieren. Wohl auch ist es die mit dem Yoga verbundene Mühe, die ihn auch in Indien zu einer Minderheitenkultur macht. Leichter ist es, an einen Gott zu glauben, von denen es in Indien ja viele gibt.
Als die fünfte Bewusstseinsschicht bezeichnen die Yogis den Zustand der Seligkeit. Dieser Zustand kann auch spontan auftreten; wenn er dauerhaft vorhanden ist, nennen ihn die Yogis Erleuchtung. Diese Qualität ist nicht leicht zu haben; in Indien, wo diese Möglichkeit durch die Kultur als erwartbar gilt, finden sich immer solche Menschen; Mahatma Gandhi war einer von diesen besonderen, in denen so etwas wie Göttlichkeit zu sehen war.
Außerhalb dieser Kultur ist Christus jemand, in dem jedenfalls seine Anhänger Göttlichkeit „sahen“. Die mittelalterlichen Mystiker wie Hildegard von Bingen und Meister Eckhart entwickelten eine These, die dieses Phänomen verständlich machen würde: Die menschliche Seele ist ein Funke von der Allmacht, die als Gott bezeichnet wird. Der im Yoga und im Buddhismus verwendete Begriff „AUM“ für GOTT heißt „Alles“ und vermeidet dadurch eine enge Gottesvorstellung. Wenn man sich die Summe von Information, Energie und Materie vorzustellen vermag, so hat man einen weiten Gottesbegriff und kann alle engeren Begriffe akzeptieren oder hinter sich lassen.
Obwohl die Gottesvorstellungen nicht nur als Reflexionen aus der Begegnung mit anderen Menschen, sondern auch durch die Begegnung mit der belebten und unbelebten Natur entstehen, hat sich im Christentum keine sensible Beziehung zur Welt gebildet. Das Feld, das Naturreligionen normalerweise besetzen, war leer; die Aufklärung, die die kurzfristigen Interessen gut zu befriedigen wusste, fand einen freien Spielplatz.
Als im Orient in den Jahrhunderten vor der Zeitenwende die Erkenntnis von der Einheit von Kosmos und Welt sowie von belebter und unbelebter Natur entstanden ist, waren Wissenschaft und Religion noch nicht getrennt; dieser geistige Fortschritt ist als Eingottglaube in die Kultur aufgenommen worden. Dieser kulturelle Höhenflug ist allerdings als Formel leichter fortzusetzen als in seiner realen Bedeutung. So hat sich sowohl im Vorderen Orient als auch im Abendland diese Qualität nur als religiöses Glaubensgut erhalten; die westliche Wissenschaft hat sich durch diese Vorgabe nicht einschränken lassen und hat sich auf getrennte Wissenschaften eingelassen und enorme Fortschritte entstehen lassen, ohne jedoch einem qualifizierten Anspruch gerecht zu werden. In den Naturwissenschaften beginnt man erst seit Kurzem, und zwar seit den diversen aktuellen Ökokrisen damit, die Natur als Einheit zu verstehen; in den Humanwissenschaften hat das ganzheitliche Denken mit der Wahrnehmung des Unbewussten durch Sigmund Freud begonnen. Mit dem Yoga hat sich zumindest ein kleiner Teil der Gesellschaft darum bemüht, das Ganze und seine Teile in verbundener Einheit zu sehen.
Zwar nicht ausschließend, aber auch nicht ganz unabhängig von den kulturellen Vorgaben ist bei einigen Menschen die Seele so weit entwickelt, dass man ihnen die Verbundenheit mit dem Ganzen auch ansieht; weil sie diese Seligkeit erfahren haben, sind sie auch stark im Leben. Diese Befindlichkeit spiegelt ein positives Menschenbild. Sie hat den mittelalterlichen Mystiker Meister Eckhart persönlich vor die Inquisition gebracht und ist in Europa nicht angekommen; sie könnte auf Pantheismus hinauslaufen. Geht man nicht so weit, den Kosmos als den Körper Gottes anzunehmen, sondern bleibt bei der christlichen Gottesvorstellung, so würde sich mehr Respekt vor und mehr Liebe zur Natur doch auch bewähren.
Erleuchtung oder Erwacht-Sein – im Yoga beziehungsweise im Buddhismus verwendete Begriffe – bezeichnen einen optimalen Bewusstseinszustand, der in einer tiefen Meditation eintreten kann und sich auf das tägliche Leben weiterhin auswirkt. Die Seligkeit, die in einer solchen Meditation erlebt wird, soll dem Glücksgefühl des weiblichen Orgasmus entsprechen. Die Yogis leben in einem Körper, der nicht anders ist als die Körper der anderen Menschen; sie unterscheiden sich durch ihr Bewusstsein.
Die Optimierung der Gehirnfunktionen beruht wohl auf einer hohen Qualität der Informationsverarbeitung. Eine Erleuchtung ist offensichtlich nicht leicht zu haben; warum es die Natur dem Menschen so schwer macht, diese Kulturstufe zu erreichen, weiß ich nicht; immerhin fallen andere hohe Stufen der Kultur wie Wissenschaft und Kunst auch nicht leicht. So viel zu den fünf Schichten des Bewusstseins.
3. Yoga als die klassische Aufklärung Indiens
Yoga nimmt sowohl die Rationalität als auch die Sensibilität sehr wichtig; daraus ergibt sich die Empfehlung, kritisch zu sein. Gerade gegenüber dem Aspekt der Erleuchtung und gegenüber jenen, die von sich behaupten, erleuchtet zu sein, gilt diese Empfehlung. Man weiß von einem tibetischen und einem indischen Guru, die im Westen große Erfolge hatten und schließlich der Leichtgläubigkeit ihrer Anhänger zum Opfer gefallen sind; sie wurden überheblich. Diese Möglichkeit wurde schon vor 2500 Jahren im ersten Handbuch der Yoga-Lehre genannt. Andererseits dürfen wir in der westlichen Welt gegenüber unserer eigenen Kultur, die uns in den luxusbedingten Ökozid (Zerstörung des Lebensraumes) zu führen droht, auch kritisch sein. Der innere Weg, glücklich zu sein, ist in Europa und Amerika nicht recht entwickelt und wird nur ansatzweise versucht; man versucht eher, sein Glück in der äußeren Welt zu verwirklichen. Das Ergebnis davon ist der Zustand der aktuellen Welt, in der sich der Materialismus gegenüber der Materie wie der Kannibalismus gegenüber dem Menschen verhält.