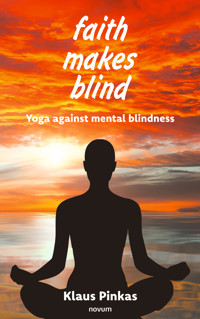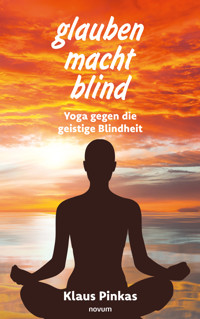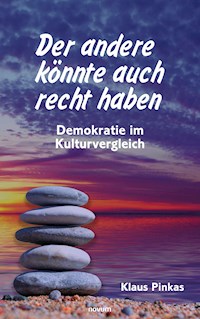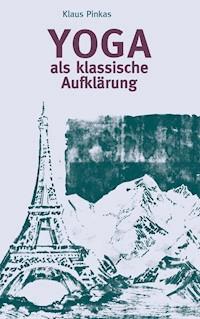
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Intelligenz der Menschheit befindet sich auf dem Niveau von Viren und Bakterien; denn sie verbraucht und zerstört ihren Wirt - nämlich die Welt - so wie diese ihren Wirt - den befallenen Menschen etwa - auch zerstören. Das Buch sucht die Ursache dafür und einen Ausweg daraus. Wie kann es sein, dass trotz unbestreitbarer hoher Intelligenz der individuellen Menschen so wenig Intelligenz aufgewendet wird, um das gesellschaftliche Leben der Menschheit zu sichern? Der Leitkultur mangelt es offensichtlich an einer sensiblen Nutzung der Rationalität. Religionen entspringen weitgehend der Gefühlssphäre; Glaubensrelligionen wie das Christentum und der Islam überlagern und vermischen Rationalität und ursprüngliche Sensibilität durch ihre Lehre; so bezahlen ihre Gläubigen den Gewinn von Resilienz mit dem Verlust an Erkenntnisfähigkeit. Die (europäische) Aufklärung hingegen betont die Rationalität und vernachlässigt die Entwicklung der Sensibilität im gesellschaftsübergreifenden Raum und reicht nicht hinein in eine gesellschaftliche Verantwortlichkeit, so dass die Gesellschaften gegenüber anderen Gesellschaften und zukünftigen Generationen emotional unberührt bleiben. So groß die Wirkkraft der Menschen ist, so weit sollte auch ihr Verantwortungsgefühl reichen. Das Christentum, das mit Himmel und Hölle extreme Gefühle beschreibt und damit die heutigen Wohlstandsbürger überfordert, und die Aufklärung, die die Rationalität als ihr Vehikel versteht, können kaum kooperieren und hinterlassen das geistige Defizit, an DESSEN Folgen zukünftige Generationen zu leiden haben werden. Yoga als klassische Aufklärung verspricht durch seine Technik Sensibilität und Rationalität kompatibel zu machen und sowohl das eine wie das andere zu fördern. Das Buch beschreibt diese Technik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Text über Yoga beginnt gewöhnlich mit einem . AOUM; und AUOM heißt »alles« – und alles ist mit allem verbunden. Damit ist das Programm des Yoga skizziert und man braucht sich nur noch um eine entsprechende Empfindung bemühen.
»Nicht, was wir erleben,
sondern wie wir empfinden,
macht unser Schicksal aus.«
Marie von Ebner-Eschenbach
Inhalt
0.
Einleitung
1.
Wesen und Quellen des Yoga
2.
Körpertraining
3.
Atmung als Bindeglied zwischen Körper und Geist
4.
Die Aufmerksamkeit der Sinnesorgane nach innen richten
5.
Muskelentspannung nach Jacobsen und Autogenes Training
6.
Glauben oder Erfahrung
7.
Verhaltensregeln auf dem Weg zum Ziel
8.
Der Mensch und die Welt
9.
Die Erfahrung aus dem Körper
10.
Verschiedene Wege
11.
Der höhere Yoga
12.
Das komplizierte Problem mit der Natur und der Kultur des Menschen
13.
Bildung als Wert und als Provokation
14.
Kampf oder Flucht
15.
Zusammenschau
Danksagung
* Darstellungen
* Literatur
* Lebenslauf
0. Einleitung
Eine einfache, aber sehr wirksame Form einer Affenfalle besteht in einem mit Futter gefüllten Krug mit einer so eng dimensionierten Öffnung, dass das Opfer sehr leicht mit der offenen Hand durch sie durchkommt. Aber zu eng, um die das Futter greifende Faust zurückziehen zu können. Der Intelligenzunterschied von Affen und Menschen weist die Opferrolle zu und ist weiter nicht erstaunlich. Dass aber Menschen anderen Menschen gegenüber in diese Falle tappen und dass sogar ganze Kulturen in dieser Falle stecken, macht das Phänomen im Konnex des vorliegenden Textes interessant. Der Mensch muss sich nicht weiter anstrengen, um sich auf dem geistigen Niveau des Affen einzufinden; hingegen ist der Humanismus immer eine Folge geistiger Leistung. Im Yoga und im Buddhismus gilt das Anhaften als leidvolle Spannung; und auch das Christuswort von den Lilien auf dem Feld empfiehlt Gelassenheit.
Es ist ein alter Rosskäufertrick, eine größere Menge von Banknoten mitzuführen und diese dem Verkäufer in dem Moment zu zeigen, in dem seine Entscheidung gewünscht wird. Wie der Affe, der an der Beute anhaftet und die Faust nicht löst, werden auch viele Handelspartner durch das größere Geldbündel manipuliert, haften an und verkaufen zu einem niedrigeren Preis als es dem Wert oder einem möglichen Verkaufspreis entspräche. Anhaften gilt im Yoga als eine der Fallen, die das Leben stellen kann; die westliche Zivilisation hängt mit ihrem Energiedurst an den Pipelines wie ein Alkoholiker an der Flasche. Der Wandel des Zieles Lebensstandard zum Ziel Lebensqualität bzw. vom Haben zum Sein könnte die Falle allenfalls auch ohne Qualitätsverlust oder sogar mit Qualitätsgewinn öffnen.
Aber auch viele der anderen überzogenen Gefühle wie Gier, Hass und Neid öffnen den Fallenstellern gute Möglichkeiten. Und selbst positive Emotionen behindern die Urteilsfähigkeit. Manchmal laufen Füchse nur mit drei Pfoten herum, weil sie sich die in einem Fangeisen steckende Pfote abgebissen haben. Die Natur zeichnet damit ein Beispiel, dass man sich einer Falle auch entziehen kann. Die Füchse, die sich auf diese Art befreit haben, bilden allerdings die Ausnahme; manche der Fallenopfer haben sich am Eisen die Zähne ausgebissen.
Im individuellen Bereich werden sich wahrscheinlich fast alle Menschen über diese leichte Verführbarkeit erhaben fühlen. Es gibt aber viele Fallen, in die wir entweder als Opfer hineinfallen oder die wir als Täter anwenden und damit der gesellschaftlichen Entwicklung schaden.
Eine der Möglichkeiten, sich diesem Spiel zu entziehen, besteht in dem Versuch, sich seinen eigenen Lebenskern bewusst zu machen und sich so den diversen Verwicklungen zu entziehen. Das eigentliche Problem ist, dass auch die westliche Kultur insgesamt in der Affenfalle steckt; sie kann nicht loslassen, denn in ihr zu leben ist so verlockend. Von einer Falle wird man sprechen können, wenn für einen kleineren Vorteil in einem Lebensaspekt große Nachteile in anderen Aspekten in Kauf genommen werden. Der Affe opfert sein Leben für den Besitz einer Nuss; die Europäer und die Amerikaner ihre Lebensqualität dem Lebensstandard.
Viele Zeitgenossen sehen bereits, dass ein Paradigmenwechsel für unsere Kultur nötig wäre; aber so wie die Affenfalle, die auf der Neigung des Menschen beruht, anzuhaften und sich beim Loslassen so schwer zu tun, ist das Problem hartnäckig. Der vorliegende Text beschäftigt sich mit Yoga, also mit der Freiheit des Menschen, die im Geist beginnt und sich im Handeln ausdrückt.
Yoga ist eine Technik, die ansetzt, die Sensibilität als gleichwertigen Partner der Rationalität zu fördern und die Emotionalität als nachrangig einzustufen. Nach diesem Denkmodell sollen sich Erlebnisse nicht unreflektiert in den Emotionen breitmachen, sondern als Erfahrung Grundlage für die Rationalität sein. Der Richter etwa soll als intellektuelle Persönlichkeit nicht emotional urteilen, aber eine gut entwickelte Sensibilität ist für ihn durchaus nützlich.
Das Verfahren bei Gericht beruht auf dem Grundsatz des objektiven Urteils, also der Emotionsvermeidung; an diesen hat sich der Richter zu halten. Das Ziel ist klar und rational erkennbar; ein Richter, dessen Interessen zur Disposition stehen, also er emotional berührt sein könnte, ist wegen Befangenheit aus dem Verfahren zu nehmen. Diese Vorschrift steht im eklatanten Gegensatz zum Normalbürger, der sich insbesondere dann einmischt, wenn es um seine Interessen geht. Um der nötigen Sensibilität des Richters zu entsprechen, kann der Richter ein psychologisches Gutachten zurate ziehen. Der Yogi nimmt auf dem Weg zur Intellektualität die Spiritualität zu Hilfe. Es geht darum, individuelle Mündigkeit und ein Gefühl für eine objektive gesellschaftliche Verantwortung zu entwickeln.
Wie eng individuelles Handeln und gesellschaftliche Wirkung miteinander verknüpft sein können, zeigen die Ereignisse in Köln zu Silvester 2015, wo zwei oder drei Dutzend islamische Flüchtlinge Übergriffe an Frauen verübten und dadurch das Image aller ihrer Schicksalsgefährten schwer beschädigten. Aber auch an sich positive Qualitäten wie Fleiß und Sparsamkeit können sich negativ auswirken. Um das an einem weit entfernten Beispiel deutlich zu machen: So werden in Indonesien nicht nur an den fleißigen und sparsamen Chinesen wegen ihrer häufigen wirtschaftlichen Erfolge von Zeit zu Zeit Pogrome verübt; als Minderheiten erkennbare Gruppen und friedensbedürftige Gesellschaften sind besonders gefordert, soziale Intelligenz zu entwickeln, damit ihnen keine Kollektivschuld oder Überheblichkeit angelastet wird.
Die Zielvorgabe, die Emotionen in den Hintergrund zu drängen, kann auf den ersten Blick für das private Leben absurd erscheinen, denn viele Menschen hängen an ihren Emotionen, und die Emotionen sind auch wichtig für die Kommunikation mit den anderen Menschen. Der Yogi jedoch hält die sensible Wahrnehmung für den Schlüssel zur eigenen und zur gesellschaftlichen Lebensqualität. Und wie das alles zusammengeht, zeigt sich auf dem Weg.
Eine Verfeinerung der Sensibilität minimiert die Emotionalität nicht, sondern optimiert sie. Für den Fall einer neurotischen Störung ist eine Reduktion der Fähigkeit zur Wahrnehmung offensichtlich; aber auch bei gesellschaftlich normaler Gehirnfunktion bleibt die Erkenntnisfähigkeit häufig hinter der Erkenntnismöglichkeit zurück.
Die deutsche Sprache hat für die beiden Begriffe Sensibilität und Emotionalität eigentlich nur das eine Wort »Gefühl« und muss sich mit den Begriffen »Gefühlseindruck oder Empfinden« beziehungsweise »Gefühlsausdruck« behelfen. Die Differenzierung ist insofern sinnvoll, da die Emotion schon die Reaktion auf die Empfindung ist und nicht die Empfindung im Augenblick darstellt; sie ist durch eine Reihe von persönlichen Vorerfahrungen, Ängsten, Hoffnungen und Interessen sowie durch kulturelle Einflüsse aufgefüllt.
Die spontane Emotion erscheint schon vor dem Einsatz der Rationalität als Urteil und behindert daher eine qualifizierte Urteilssuche. Die Sensibilität gibt dem Subjekt Einblick in das Wesen der anderen; die Emotionalität zeigt hingegen den anderen das Wesen des Subjekts.
Der Yogi will wissen, wie er in seinem Wesenskern, seiner Urnatur, ist und will durch dieses Wissen entspannter und insgesamt freudvoller leben. Die Meditation gibt Raum und Zeit, die Erlebnisse in Erfahrungen zu entwickeln, indem sie innere, oft auch unbewusste Prozesse dem Bewusstsein erschließt und dadurch mehr Einblick in die Welt ermöglicht. Das Idealziel, Intellektualität zu gewinnen, gibt es sowohl in der westlichen als auch in der indischen Kultur. Der Yoga empfiehlt nur einen eigenen Weg, indem er als Lehrmittel ein ganzes Programm anbietet; Weisheit wird lehr- und lernbar.
Die dominante westliche Bildungsidee besteht in der Förderung der Rationalität, vernachlässigt die Sensibilität und überlässt die Findung der gesellschaftlichen Ziele den Emotionen. Die dominante Bildungsidee des Yoga besteht in der kritischen Beachtung der Emotionen, sodass diese weder die Rationalität noch die Sensibilität behindern.
Sensibilität ist die natürliche Fähigkeit des Menschen, sich und seine Umwelt wahrzunehmen. Die Emotion ist hingegen ein durch die Kultur beeinflusster oder überformter Gefühlsausdruck, sodass die jeweilige Kultur immer nur an sich selbst gemessen wird und der Blick über den Tellerrand oder aber über den Rand des Kruges hinaus behindert wird.
1. Wesen und Quellen des Yoga
»Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der seelisch-geistigen Vorgänge.«
»Diese sind richtiges Wissen, falsches Wissen, Erinnerung, Vorstellung und Schlafbewusstsein.«
»Dann ruht der Sehende in seiner Urnatur.«
So beginnt auszugsweise der »Leitfaden des Yoga«, der im dritten Jahrhundert vor Christus oder auch etwas später in Indien geschrieben wurde. Der Autor Patanjali, über den man weiter nichts weiß, legt in 194 Lehrsätzen die »Betriebsanleitung für das Gehirn« im Sinn des Yoga vor. Auf den nächsten Seiten will ich etwas Klarheit in den möglicherweise verwirrenden Beginn des Textes bringen und eine der mehreren Yogaarten darstellen. Nach der obigen Aufzählung sollen die alltäglichen Hirnfunktionen ausgesetzt werden; und verdient nicht der, der in unserer aufgeklärten Gesellschaft richtiges Wissen ausschalten will, höchste Skepsis und Ablehnung?!
Doch Yoga und seine Paralleldisziplinen nehmen die Skepsis so ernst, dass sie nicht nur das vorhandene Wissen über die Außenwelt kritisch hinterfragen, was auch die Wissenschaft tut, sondern auch die Instrumente der Wahrnehmung – also Gehirn und Körper. Nicht das Wissen, sondern die meditative Schau soll die Übung dominieren.
In der Meditation werden diese Funktionen zusammengeführt und aufeinander ausgerichtet. Falsches Wissen ist natürlich entbehrlich, die anderen Funktionen aber sollen nach der Meditation wieder voll aktiv werden. Die Vorstellungskraft etwa, die Grundlage für den Glauben ist, ist auch ein wichtiger Faktor fürs Denken. Man braucht sie, denn Denken ist Probehandeln im Kopf; und Vorstellungen sind Bilder, die im unsichtbaren Bereich angesiedelt sind – also die Zwischenergebnisse und das Endergebnis eines Denkvorganges.
Für mich – ich bin blind – erleichtert eine gute Vorstellung meiner Umgebung die Lebensgestaltung; ich muss mir etwa den Weg, den ich gehen will, zuerst vorstellen, also ein Bild von ihm machen.
Daher ist ein kritischer Umgang mit Vorstellung und Einbildung essenziell; eine falsche oder ungenaue Vorstellung von der Wirklichkeit zeigt sich schnell. Wer an Himmel, Hölle oder Wiedergeburt glaubt, hat gewöhnlich mehr Zeit, bis er Verifikation oder Falsifikation erfährt. Ich weiß nicht mehr von dem »Unsichtbaren«, habe aber mehr Erfahrung mit ihm; Gläubigkeit hat keinen hohen Stellenwert für mich.
Die Paralleldisziplinen zum Yoga sind jene, die die Meditation in ihr Zentrum stellen, das sind etwa der Buddhismus, der Sufismus als spirituelle Übung im Islam, die christliche Mystik, der Schamanismus, die indianischen Kulturen und viele andere.
Sinn und Zweck des Yoga wird weiters in der Bhagavad Gita beschrieben, einem Buch, das in Indien hohe Verehrung genießt und ungefähr aus der gleichen Zeit stammt. Das dritte sind die Upanishaden, die ebenfalls Antworten auf Grundfragen des menschlichen Daseins geben und deren Entstehung etwas früher angesetzt wird. Ich habe mein Wissen über Yoga aus diesen und weiteren Büchern und verdanke es auch einem alten Meister in einer Yogaschule im Gangestal, wo ich eine entsprechende Ausbildung machen konnte; außerdem hatte ich etliche Jahre Unterrichtspraxis in Wien.
Dem Yoga, der seine Heimat in der Kriegerkaste hatte, geht es wesentlich um die Rolle des Menschen. Sowohl die Bhagavad Gita als auch die Upanishaden benennen die Kriegerkaste als ihr geistiges Umfeld; und auch Prinz Siddharta, der spätere Buddha, stammt aus der Kriegerkaste. Demgemäß wachsen sowohl Yoga als auch der Buddhismus aus der gleichen Geisteswelt – und beide lassen das Kastensystem hinter sich.
Nicht nur heute, sondern offensichtlich schon in früheren Zeiten gab es beim Militär besonderen Bedarf nach Stressfestigkeit und Aufarbeitung posttraumatischer Zustände; so ein Fall wird in der Bhagavad Gita beschrieben, einem klassischen Buch der Yogalehre. Der Feldherr Prinz Arjuna steht vor der Front und will nicht kämpfen, weil er auf der gegnerischen Seite Verwandte, Lehrer und Freunde sieht. Und er fürchtet, diese Belastung nicht verkraften zu können. Sein Wagenlenker – in diesem Fall Gott Krishna – redet ihm zu, in den Kampf zu gehen – und nach dem Kampf mit Yoga die möglicherweise entstandenen psychischen Schäden zu lösen. Was wäre mit den Soldaten, wenn sich der Kommandant in dieser Lage aus dem Staub machte?
Ein Angehöriger der Kriegerkaste dürfe sich nicht weigern, am Kampf teilzunehmen; er müsse funktionsgemäß handeln. Das Buch legt nahe, dass es sich hier um den Kampf des Guten gegen das Böse handle. Als Leser dieser Geschichte sind wir heute aber nur einseitig informiert und kennen den Wahrheitsgehalt dieser Rechtfertigung nicht.
Gandhi als praktizierender Pazifist liebte das Buch; der Arzt Albert Schweitzer kritisierte hingegen seinen Inhalt. Ihm schien die Rechtfertigung dieses Kampfes als zu locker erteilt und auch die Ehre des Heerführers als Argument für den Kampf mutet heute antiquiert an. Eine emotional ausgerichtete Präferenz der beiden widersprüchlichen Auffassungen ist leichter zu finden als eine letztlich gültige Antwort.
In der ursprünglichen Christuslehre galt offensichtlich ein absolutes Gewaltverbot; mit der Teilhabe an der Macht als Staatsreligion im 4. Jahrhundert bezog sich die Kirche auf Augustinus und modifizierte diese strikte Auffassung. Demgemäß gilt für die westliche Kultur und davon abgeleitet für das Völkerrecht heute nur ein grundsätzliches Verbot des Krieges; der »gerechte Krieg« bildet die Ausnahme; erlaubt ist demnach ein Verteidigungskrieg. Was verteidigt werden darf, ist dabei umstritten: Die Europäer denken dabei an ihre Territorien, die USA gemäß ihrer jeweiligen Verteidigungsdoktrin auch an ihre Interessen. Etliche US-Streitkräfte wurden nicht zur Landesverteidigung, sondern zur Bekämpfung des Kommunismus eingesetzt. Die Militärdoktrin der USA überträgt seinen Streikräften nicht nur die Aufgabe der territorialen Verteidigung, sondern auch die Verteidigung der Interessen des Landes und wirkt damit an der aggressiven Wirtschaftspolitik mit.
Der göttliche Yogalehrer Krishna hingegen weist den Arjuna an, in Hinkunft auf die Kausalität zu achten, um einen Krieg zu vermeiden. Würden wir das in unserer Zivilisation tun, würde die Vermögens- und Ressourcenverteilung in und zwischen den Gesellschaften bzw. Völkern anders gehandhabt. Die völkerrechtliche Ächtung des Krieges ist gewiss auch ein Kausalitätsfaktor für Frieden; aber die harten Fakten der gesellschaftlichen Prozesse wirken wahrscheinlich stärker als ein bloßes Gesetz.
Fundamentalpazifisten, Politiker und Leute aus der Wirtschaft übersehen häufig die Bedingungskomplexität, die für die Erhaltung von Frieden nötig ist – die Friedensarbeit muss bei der Lebensgestaltung ansetzen, um den Kampf als letzten Akt des Dramas zu »verunnötigen«.
Wenn eine Gesellschaft ihr Wachstum oder den Ressourcenverbrauch nicht auf ein verkraftbares Maß einschränkt, werden Enge und Hunger zu natürlichen Kriegsgründen und der Krieg zu einer wiederkehrenden unvermeidlichen Katastrophe. Die Mittel sexuelle Enthaltsamkeit, Homosexualität, Empfängnisverhütung sowie Ereignisse wie hohe Kindersterblichkeit, Epidemien und Naturkatastrophen reichen oft nicht aus, ein überbordendes Bevölkerungswachstum zu verhindern; und die Expansionsmanie der »modernen« Wirtschaft führt auch mit Vollgas in einen Engezustand.
Was an »gesellschaftlicher Bestandspflege« versäumt wird, ereignet sich später als postnatale Abtreibung in Kriegen. Kriege waren bisher die »Notbremse« der Evolution, um eine überproportionale Besetzung der Natur durch die Menschen zu verhindern. Der Gedanke, individuelle Abtreibungen mit Kriegsvermeidung gegenzurechnen, berührt sicher ein Tabu; aber der Versuch, gefährliches Bevölkerungswachstum durch Verzicht auf Sexualität zu verhindern, ist immer wieder gescheitert. Nicht nur, um sich selber zu helfen, sondern auch um die Entstehung kriegserzeugender Situationen für die Zukunft zu vermeiden, rät Krishna dem Arjuna, den Yogaweg einzuschlagen, und legt diesen gleich in 700 Versen dar.
Über die Lösung eigener Schwierigkeiten hinaus ist das Wissen um den Menschen in der Welt wichtig und insbesondere für die Politik als Menschenführung relevant. Der Yoga ist eine klassische Humanwissenschaft, die heute einen starken Einfluss auf die Gehirnforschung hat. Buddhistische Mönche und Yogis sind demgemäß geschätzte Versuchsobjekte und Gesprächspartner für etliche moderne Gehirnforscher.
Patanjali hat den sogenannten Jnana-Yoga dargestellt, der sich als ein Modell in acht Stufen zeigt. »Jnana« heißt Erkenntnis und ist sprachlich mit dem griechischen Wort »Gnosis« oder mit dem bayerisch-österreichischen Dialektwort »Gneisen« verwandt. Der Begriff Yoga bezieht sich auf ein Wort, das im Deutschen Joch heißt und sich mit der Verbindung von Körper und Geist und von Sensibilität und Rationalität beschäftigt. Yoga ist seinem Wesen nach ein Geistestraining mit der Technik der Selbstbeobachtung.
2. Körpertraining
Weil ich den vorliegenden Text als Vortrag für ein human- und sozialwissenschaftliches Institut konzipiert hatte, geht er weit über das hinaus, was man im Westen normalerweise als Yoga versteht – nämlich das Körpertraining. Dieses stellt die dritte Stufe des Systems dar und gilt als Vorbereitung der Meditation, also als Einstieg in den höheren Yoga. Ein entsprechendes Buch für die Sitzhaltungen (Asana) ist aus dem 15. Jahrhundert überliefert. Hatha-Yoga trainiert Anspannung und Entspannung und macht fähig, längere Zeit in einer Meditationshaltung zu sitzen. Eine Liegehaltung eignet sich wegen der höheren Gefahr des Einschlafens weniger, außerdem soll die Wirbelsäule frei sein. Eine Stunde ganz ruhig zu sitzen ist für einen ungeübten »Westmenschen« schon sehr lang; von indischen Meistern werden tagelange Meditationszeiten berichtet. Aber auch die müssen ihren Körper präparieren.
Die sportliche Funktion der Übungen beruht auf dem Training des Körperbewusstseins und seiner Flexibilität bei gleichzeitiger Stärkung von Muskeln, Sehnen und Bändern. Durch die Dehnung der Muskeln, die bei den Asanas eine wichtige Rolle spielt, wird das in den Muskeln vorhandene verbrauchte Blut hinausgedrückt; bei der jeweils zwischendurch vollzogenen Entspannung fließt frisches sauerstoffreiches Blut zurück und erzeugt ein wohliges Entspannungsgefühl im Muskel. Das Gehirn nimmt das wahr, übernimmt das Gefühl und entspannt sich selber sowie den ganzen Körper.
Die gesundheitliche Funktion des Yoga verdankt sich der Verhinderung von Stress und Stressfolgen. Da ziemlich viele Krankheiten durch Stress ausgelöst bzw. verstärkt werden, sind ein gutes Stressmanagement und die Verhinderung insbesondere des schädlichen Dauerstresses von großem Nutzen.
Die allermeisten Übungen trainieren die Muskeln, die für die Unterstützung der Wirbelsäule wichtig sind. Die Wirbelsäule gilt als Zentralorgan, weil sie sowohl für die Körper- als auch für die Nervenfunktionen relevant ist. Im Hatha-Yoga wird die Vollkommenheit des Körpers angestrebt – und diese besteht in Schönheit, Anmut, Kraft und diamantener Härte.
Der traditionelle Yoga stellt an die 400 Übungen vor, also ein ausdifferenziertes Programm, aus dem man sich bedienen kann. Einzelne Lehrer bzw. verschiedene Schulen gestalten daraus verschiedene Abläufe und auch die Probanden treffen ihre Wahl; auch kann man die Übungen statisch oder dynamisch ausführen. Wenn es auch nicht für alle Lehrer zutrifft, ist doch das Angebot offen und ermöglicht viele Erweiterungen. Die moderne Medizin steht dieser Körpertechnik wohlwollend kritisch zur Seite und kann zur der individuellen Auswahl und Ausführung beratend beitragen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Gebetspraxis der Muslime; mit drei oder fünf Gebetsserien am Tag halten sie sich ihre Wirbelsäulen flexibel, stabilisieren ihren Blut-Kreislauf und unterstützen ihre Vitalität. »Fromme« Muslime haben damit einen Vorteil gegenüber den anderen; ob diese Tatsache den Gebeten oder Allah verdankt wird, mag individuell verschieden sein.
»Haltung« hat sowohl eine körperliche als auch eine geistige Dimension. Eine auf den ersten Blick erstaunliche Parallele findet sich darin, dass sich Yogis und Soldaten desselben Tricks bedienen, um eine stabile aufrechte Körperhaltung zu erreichen: Durch das Anspannen der Gesäßmuskeln werden die für die Wirbelsäule zuständigen Muskeln aktiviert und das ermöglicht den Soldaten auf längere Zeit die Haltung im Stehen, den Yogis die Haltung im Sitzen. Für die Yogis ist dies der Einstieg in den Kundalini-Yoga, der als Übung für die Gewinnung von körperlicher und geistiger Energie gilt.
Eine von Verspannungen und von Blockierungen freie Wirbelsäule wirkt sich für den Informationsfluss vom Gehirn zum Körper und zurück günstig aus – und im »höheren Yoga« wird es darum gehen, das Körperbewusstsein auszuschalten; und um diese Fähigkeit einzuleiten, ist ein vertrautes Verhältnis mit dem »grobstofflichen« Körper dienlich. Schreibt man über Yoga, so muss man wohl über die Funktion der Wirbelsäule schreiben. Aber was könnte man jemandem sagen, dessen Wirbelsäule defekt ist und der keine Information aus dem Körper bekommt? Ob er lernen kann, in seinem Gehirn »Lichtspiele«, etwa Erleuchtung, zu haben, bin ich überfragt. Vielleicht gibt es Meister mit einschlägiger Erfahrung.
Interessant geht das christliche Denkmuster vor: Der Mensch habe demnach eine Seele – wenn das so wäre, so würde der Körper der Organisator des Lebens sein. Das ist aber unwahrscheinlich, denn der Körper ist in dauerndem Austausch mit der Umwelt und »stoffwechselt« in einem durchschnittlichen Leben plusminus 50 Tonnen externe Substanz an Nahrung, mehr als diese Menge an Wasser und vielleicht viele Millionen Kubikmeter an Luft, bzw. zumindest ihrem Sauerstoffanteil.
Die Yogis meinen eher, dass der »innere Mensch« der Organisator wäre und einen Körper habe; nach westlicher Diktion ist dieser die in den Genomen vorhandene Information, die sich unter dem Einfluss der Umwelt aktuell entwickle. Der Körper gilt als Tempel für den Atman – etwa der Seele. Eine solch schöne und wertschätzende Darstellung entspricht einem positiven Lebensgefühl und kann es auch fördern.
Neben den Unannehmlichkeiten, die ein imperfekter Körper mit sich bringt, brachte die NS-Ideologie durch die Betonung der Eugenik zusätzliches Leid durch die gesellschaftliche Diskriminierung. Behinderung war damit nicht nur unangenehm, sondern auch peinlich. Da ist es schon gut, zwischen sich selbst und seinem Körper etwas Distanz schaffen zu können. Für den, der einen jungen und perfekten Körper hat, mögen diese Gedanken eine wertlose Spielerei sein – im Schadensfall wird die Einstellung dazu aber relevant. Hat der Körper Schmerzen, so ist ihre Aussonderung aus dem Wesen gewiss schwierig; ansonsten braucht man sich nicht den ganzen Tag dadurch verderben lassen, dass einige Stunden des Tages tatsächlich schadensbedingte Probleme bereiten.
Auch die Beobachtung von sich und anderen, dass das Wesen nicht notwendigerweise mit der Alterung des Körpers im Gleichschritt einhergeht, spricht für die yogische Darstellung und drückt sich aus in dem Satz, man sei so alt wie man sich fühle. Der »innere Mensch« (Atman oder die Seele) scheint alterslos und frei von Behinderungen zu sein.
Nach dieser Sicht, die meditativ auch erfahrbar ist, ist der Körper für die Seele, was die Kleidung für den Körper ist; manchmal wirkt es wohltuend, sich dieser Vorstellung auszusetzen. Ist die Kleidung unpassend, schmutzig oder kaputt, so ist das oft peinlich, denn es macht den Träger zum Außenseiter. Das gleiche Problem gibt es häufig mit einem imperfekten Körper. Gelingt es da, bei sich zu sein, also in seiner Seele zu ruhen, verschwindet die Peinlichkeit; Selbstbewusstsein als Ergebnis von Erfolgen im Leben oder als entsprechende Erfahrung in der Meditation lösen das Dilemma: Der »innere Mensch« ist unberührt vom Mangel und je netter die Gesellschaft ist, desto leichter tut sich der Einzelne.
Eine Behinderung, insbesondere wenn sie erblich ist, wurde im Nationalsozialismus unter dem Blickwinkel der Eugenik beurteilt und verurteilt. Diese diskriminierende Sicht ging auf eine entsprechende Auslegung der Evolutionslehre Charles Darwins zurück und belastete die Personen zusätzlich zu ihrem Problem auch mental; diese Einstellung hat sich in den letzten Jahrzehnten reduziert, ist aber noch nicht ganz verschwunden. Die Übernahme der Vorstellung der Yogalehre ist dagegen wie Balsam für die Seele.
Aber auch die dem Hinduismus als Volksreligion unterworfenen Behinderten in Indien werden vielfach einer sozialen Diskriminierung ausgesetzt; die Behinderung wird als Folge von Missetaten in einem früheren Leben ausgelegt. Auch hier kann sich zumindest der nur körperlich Behinderte durch die Yogalehre mental aus der Diskriminierung lösen, wobei die Eigensicht auch die Außensicht beeinflussen wird.
Hier drängt sich ein Gedanke zur Rolle der Urnatur auf; sie ist nicht das bloße Äquivalent zum Instinkt des Tieres, sondern stellt auch die Kulturfähigkeit des Menschen her. Schlüpft aus dem Mutterschoß etwas, das nicht der Vorstellung von einem normalen Kind entspricht, so wird dies einen Schock auslösen und es wird eine Scheu aufkommen.
Auch wenn Kinder oder auch Erwachsene mit wenig einschlägiger Erfahrung jemanden begegnen, der anders ist als sie, so ist das eine Konfrontation: Die Realität entspricht nicht dem gewohnten Menschenbild. In diesem Fall eine Scheu zu leugnen, würde einem Leben aus der Urnatur nicht entsprechen; da aber niemand vor dem Eintritt von Behinderung, Krankheit und Tod für sich selbst und seine Angehörigen sicher sein kann, kann eine solche Begegnung als Provokation wirken.
Für den verwöhnten und überbehüteten Königssohn Prinz Siddharta waren solche provokativen Erfahrungen der Anlass, sein weiteres Leben der Erforschung des Leids und dessen Überwindung zu widmen – dadurch entstand der Buddhismus. Die griechische Sagenwelt erklärt die Erfindung des Rades damit, dass die Götter dem querschnittgelähmten Halbgott Pelops die Fortbewegung ermöglichen wollten. Peter Mitterhofer erfand ursprünglich für einen blinden Freund die Schreibmaschine, die dann weiterentwickelt wurde. Und Graham Bell, soweit er tatsächlich der Erfinder des Telefons war, brauchte das Urmodell, um mit seiner gehbehinderten Frau besser kommunizieren zu können. Nicht der Krieg ist der Vater aller Dinge, sondern auch Behinderungen haben manche Erfindung ausgelöst.
3. Atmung als Bindeglied zwischen Körper und Geist
Neben den Körperübungen spielen die Atemübungen im Yoga (Stufe IV) eine bedeutende Rolle zur Vorbereitung des Geistes auf dem Weg zum Ziel. Prana ist die Energie und auch der Atem – und Pranayama sind die Atemübungen; im Yoga sind das besondere Formen des Atmens, Atemtechniken eben, die aus großer Varianz von Dauer und Intensität bestehen.
Schon die Normalatmung wird beschrieben: Auf die Ausatmung wird mehr Wert gelegt als auf die Einatmung, die die natürliche Folge der Ausatmung ist. Je besser es gelingt, die Lungen zu leeren, desto erfolgreicher ist die Einatmung. Es werden in den einschlägigen Büchern 50 und mehr Sonderformen beschrieben, die ein Spiel von Einatmung, Ausatmung und Anhalten des Atems darstellen. Das kann man bis an die Grenzen der Bewusstlosigkeit treiben. Temporäre Über- oder Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff bzw. Kohlendioxid gehören zum Selbstversuch – daraus ergeben sich verschiedene Empfindungen, die es zu beobachten gilt.
Weithin bekannt ist, dass eine ruhige Atmung ein aufgeregtes Gehirn zur Ruhe bringen kann. Aber es ist auch so, dass ein emotionaler Störfall die Atmung in Unruhe versetzt. Die Interdependenz von Atmung und Geist wird hier zum Objekt der Betrachtung gemacht.
Die Atemübungen trainieren aber nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern erhöhen auch den Sauerstoffgehalt im Blut und verbessern die Durchblutung des Gehirns, sodass die Menge der betriebsbereiten Neuronen erhöht wird. Von den hundert Milliarden Neuronen, die das menschliche Gehirn ausmachen, ist gewöhnlich nur ein geringer Anteil im Einsatz. Die bessere Versorgung des Gehirns führt zu einer natürlichen wohltuenden Bewusstseinserweiterung.
Manche Drogen wie LSD führen auch zu einer solchen – ihr Einsatz ist allerdings bekanntermaßen riskant. In den komplexen Bereich der Meditation ist auch das Rauchen einzureihen. Über die Schädlichkeit braucht man nicht zu diskutieren; jeder aber, der das Rauchen aufgibt, verliert auch eine faktische Meditation. Zum Glück sind andere Meditationsformen unschädlich. Die Technik einer ruhigen bewussten Atmung, wie sie häufig bei Rauchern zu beobachten ist, verursacht unabhängig von der Wirkung des Nikotins eine spirituelle Dimension.
In dem Ashram, in dem ich zur Lehre ging, waren täglich eine Stunde Asanas (Körperübungen), eine halbe Stunde Pranayama (Atemübungen) und zweimal eine Stunde Meditation angesagt.