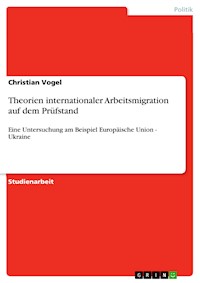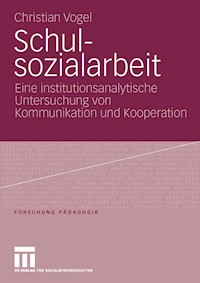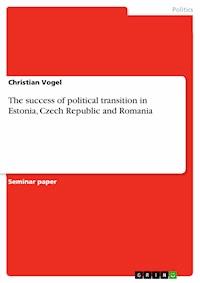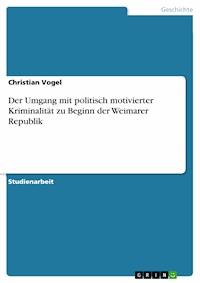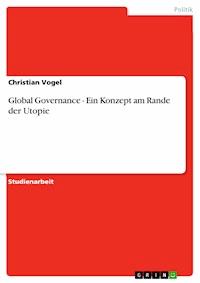
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Thema: Globalisierung, pol. Ökonomie, Note: 2,0, Technische Universität Chemnitz, Veranstaltung: Deutschland und Europa in der Weltwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: „Wir können das Rad der Globalisierung nicht zurückdrehen – wir werden mit ihr leben müssen. Die Frage ist, wie wir sie so gestalten können, dass sie den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Zahl von Menschen schafft. Und um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir global agierende öffentliche Institutionen, die mithelfen, die Regeln auszuarbeiten.“ Mit dieser Einschätzung umreißt Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger für Wirtschaft und einstiger Chefvolkswirt der internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (kurz Weltbank), nicht nur die Notwendigkeit und Zielsetzung einer Politik mit globaler Dimension. Er weisst auch auf die potentielle Umsetzungsstrategie hin, mit welcher sich die globale Gemeinschaft den Gegebenheiten des 21. Jahrhundert stellen muss und die seit Ende des vergangenen Jahrhunderts als „Global Governance“ in der Globalisierungsdebatte bezeichnet wird. Doch welchen Anforderungen muss sich eine zunehmend von globalen Prozessen und Erfordernissen geprägte Weltpolitik stellen, um durch wirkliche Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor, der bis dato scheinbar die Triebfeder der Globalisierung darstellt, an Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen? Wie realistisch ist eine Global Public Policy und welche Transformationsschritte müssen gegangen werden, damit das derzeitige System, das man globale Politikgestaltung ohne globale Regierung nennen könnte, in dem einige wenige Institutionen und Akteure das Sagen haben, transparenter und demokratischer gestaltet werden könnte? Diese zentralen Fragen sollen die Basis für die Analyse der derzeit vorherrschenden Vorstellungen des Global Governance Begriffes darstellen. Da die Beantwortung besagter Problemstellungen ebenso komplexe wie auch in weiten Teilen sehr abstrakte Lösungen erfordern, kann diese Arbeit aufgrund ihres Umfanges die Thematik lediglich ansatzweise beleuchten und mögliche Lösungsstrategien nur hinsichtlich ausgewählter Bereiche vorschlagen. Vor diesem Hintergrund soll der erste Teil zum einen der Begriffsklärung dienen und zum anderen eine Bestandsaufnahme dessen sein, was sich bis zum heutigen Zeitpunkt unter dem Deckmantel von Global Governance verbirgt. Deshalb werden die zwei bedeutendsten Internationalen Finanz-Institutionen (IFI’s), der IWF und die Weltbank, im Fokus der Untersuchung stehen, wobei auf ihre Historie, Aufgaben und grundlegende Zielstellungen eingegangen sowie eine Einschätzung des Erfolges bzw. Misserfolges vorgenommen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Technische Universität Chemnitz Philosophische Fakultät Professur: Internationale Politik Hauptseminar: Deutschland und Europa in der Weltwirtschaft
Verfasser: Christian Vogel
1. Hauptfach: Erwachsenenbildung und betriebliche Weiterbildung, 9.Semester 2. Hauptfach: Politikwissenschaften, 6. Semester Abgabedatum: 04.08.2005
Page 3
1. Einleitung
„Wir können das Rad der Globalisierung nicht zurückdrehen - wir werden mit ihr leben müssen. Die Frage ist, wie wir sie so gestalten können, dass sie den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Zahl von Menschen schafft. Und um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir global agierende öffentliche Institutionen, die mithelfen, die Regeln auszuarbeiten.“1Mit dieser Einschätzung umreißt Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger für Wirtschaft und einstiger Chefvolkswirt der internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (kurz Weltbank), nicht nur die Notwendigkeit und Zielsetzung einer Politik mit globaler Dimension. Er weisst auch auf die potentielle Umsetzungsstrategie hin, mit welcher sich die globale Gemeinschaft den Gegebenheiten des 21. Jahrhundert stellen muss und die seit Ende des vergangenen Jahrhunderts als „Global Governance“ in der Globalisierungsdebatte bezeichnet wird.
Doch welchen Anforderungen muss sich eine zunehmend von globalen Prozessen und Erfordernissen geprägte Weltpolitik stellen, um durch wirkliche Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor, der bis dato scheinbar die Triebfeder der Globalisierung darstellt, an Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen? Wie realistisch ist eine Global Public Policy2und welche Transformationsschritte müssen gegangen werden, damit das derzeitige System, das man globale Politikgestaltung ohne globale Regierung nennen könnte, in dem einige wenige Institutionen und Akteure das Sagen haben, transparenter und demokratischer gestaltet werden könnte?3
Diese zentralen Fragen sollen die Basis für die Analyse der derzeit vorherrschenden Vorstellungen des Global Governance Begriffes darstellen. Da die Beantwortung besagter Problemstellungen ebenso komplexe wie auch in weiten Teilen sehr abstrakte Lösungen erfordern, kann diese Arbeit aufgrund ihres Umfanges die Thematik lediglich ansatzweise beleuchten und mögliche Lösungsstrategien nur hinsichtlich ausgewählter Bereiche vorschlagen.
Vor diesem Hintergrund soll der erste Teil zum einen der Begriffsklärung dienen und zum anderen eine Bestandsaufnahme dessen sein, was sich bis zum heutigen Zeitpunkt unter dem Deckmantel von Global Governance verbirgt. Deshalb werden die zwei bedeutendsten Internationalen Finanz-Institutionen (IFI’s), der IWF und die Weltbank, im Fokus der Untersuchung stehen, wobei auf ihre Historie, Aufgaben und grundlegende Zielstellungen eingegangen sowie eine Einschätzung des Erfolges bzw. Misserfolges vorgenommen werden.
1Stiglitz, Joseph (Hrsg.): Die Schatten der Globalisierung, Bonn 2002, S. 255f.
2Vgl. Müller, Klaus (Hrsg.): Globalisierung, Bonn 2002, S. 130.
3Vgl. Stiglitz, Joseph (Hrsg.): Die Schatten der Globalisierung, Bonn 2002, S. 36.
Page 4
Der zweite Teil beschäftigt sich vorrangig mit den direkt abzuleitenden Defiziten, die im Zuge der fortschreitenden Globalisierung sowohl für die politischen Entscheidungsträger als auch für die Gesellschaft als grundlegende Fragen im Raum stehen und dringend nach einer tief greifenden, umfassenden und nachhaltigen Transformationsstrategie verlangen. Auch hier können nur einzelne Aspekte behandelt werden. Dabei soll jedoch versucht werden, ein möglichst umfassendes Spektrum, d.h. wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Dimensionen, anzuschneiden. Da es sich, wie bereits erwähnt, um sehr komplexe und zukunftsträchtige Sachverhalte handelt und darüber hinaus in der einschlägigen Fachliteratur sehr differente Visionen zum Vorschein kommen, soll darauf hingewiesen werden, dass eine möglichst objektive wissenschaftliche Synthese teilweise sehr diffizil ist. Darüber hinaus konkurrieren derzeitige Rahmenbedingungen und politische Konstellationen in dem Maße mit dem Ideal der hier untersuchten Strategie, als dass die im Zuge der Arbeit generierten Lösungsansätze streckenweise realitätsfern erscheinen mögen. Auch unter dem strengen Vorsatz der Vermeidung dessen soll vorangestellt werden, dass sich der erste, eher technokratische Teil, vom zweiten, in Ansätzen essayistischen Teil, in gewisser Weise abgrenzt.
2. Definitionsversuche
2.1. Der Globalisierungsbegriff
„Der Begriff „Globalisierung“ ähnelt einer indischen Gottheit: In welcher Form sie erscheine, hänge von den Vorstellungen des Betrachtes ab.“4In der Tat verweisen nahezu alle Wissenschaftler, die sich mit dem Phänomen der Globalisierung beschäftigen, auf die außerordentlich komplizierte Fassbarkeit des besagten Begriffes. Zwar scheint das Wort zum „buzzword of the decade“ (Schlagwort des Jahrzehnts) geworden zu sein, mit dem sämtliche Prozesse der internationalen Märkte sowie der internationalen Beziehungen insgesamt etikettiert werden.5„Aber das größte Defizit innerhalb der bisherigen akademischen Globalisierungsdiskussion ist offensichtlich das Fehlen eines einheitlichen Verständnisses dessen, was Globalisierung eigentlich ist.“6
4Dr. Scherer, Edgar (Hrsg.): Globalisierung - Herausforderung oder Feindbild, in: http://www.rotary-es-filder.de/vortrag/020909_Globalisierung.pdf (02.05.2005), S. 1.
5Vgl. Reinicke, Wolfgang, Witte, Jan Martin: Globalisierung, Souveränität und internationale Ordungspolitik, in: Busch, Andreas, Plümper, Thomas (Hrsg.): Nationaler Staat und internationale Wirtschaft. Anmerkungen zum Thema Globalisierung, Baden-Baden 1999, S. 339 - 366, hier S. 339.
6Beisheim, Marianne, Walter Gregor: „Globalisierung“ - Kinderkrankheiten eines Konzeptes, in: Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft - Sektion Internationale Politik (Hrsg.): Zeitschrift für internationale Beziehungen, Ausgabe 1 / 1997, S. 153 - 180, hier S. 155.