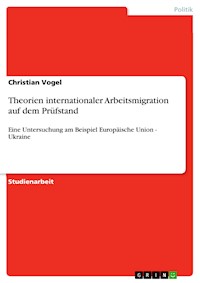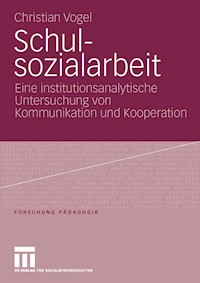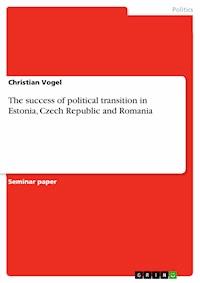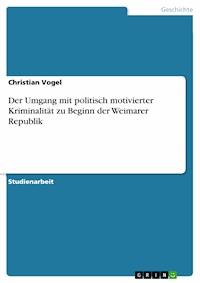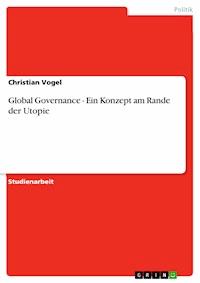Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Im Gegensatz zum insgesamt eher stagnierenden Gründungsgeschehen in Deutschland hat sich die Zahl der Selbstständigen mit Migrationshintergrund innerhalb der letzten 25 Jahre nahezu verdreifacht. Dabei haben sich Gründende mit Migrationshintergrund längst von dem Klischee emanzipiert, sich ausschließlich in den Bereichen Gastronomie und Handel selbstständig zu machen. Vielmehr gründen Migrantinnen und Migranten in allen Wirtschaftsbranchen, schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze und tragen zur Diversifizierung der Wirtschaft bei. Der Erfolg von Unternehmensgründungen hängt in hohem Maße von einer intensiven Vorbereitung ab. Gründungswilligen in Deutschland steht dafür grundsätzlich eine Vielzahl von Angeboten der individuellen Gründungsförderung zur Verfügung. Diese sind allerdings – so die These – im Wesentlichen auf „klassische“ Gründer ausgerichtet. Da sich heute aber ein deutlich differenzierteres Bild hinsichtlich der vorzufindenden Gründer(innen)gruppen, Gründungsformen oder -anlässe abzeichnet, stellt sich die Frage, inwiefern dieser Heterogenität im System der Gründungsförderung bereits Beachtung geschenkt wird. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen der deutschlandweiten Untersuchung bestehende Maßnahmen und Strukturen der Gründungsberatung und -weiterbildung aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet. Zentral wird dabei in den Blick genommen, inwieweit Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund tatsächlich spezifische Beratungs- und Weiterbildungsbedarfe im Zuge des Gründungsprozesses aufweisen und welche zielgruppenspezifischen Herausforderungen daraus für die Gestaltung von Angeboten der Gründungsförderung abgeleitet werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Selbstständige mit Migrationshintergrund
sind in gewissem Sinne als Vermittler
zwischen Zugewanderten und Einheimischen
und letztlich zwischen verschiedenen
kulturellen Welten zu sehen.“
(René Leicht)
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
AUFBAU DER ARBEIT
TEIL I: PROLOG
1 EINLEITUNG
1.1 Relevanz der Thematik
1.2 Bedarf, Ziele und zentrale Fragestellungen
TEIL II: FORSCHUNGSSTAND UND THEORETISCHE GRUNDLAGEN
2 BEGRIFFLICHE FUNDIERUNG
2.1 Migranten, Ausländer, Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund
2.2 Migration
2.2.1 Migration als globales Phänomen
2.2.2 Migration in Bezug auf Deutschland
2.3 Integration
2.4 Selbstständige unternehmerische Tätigkeit
2.5 Kompetenz- und Zielgruppenorientierung
3 MIGRANTENÖKONOMIE
3.1 Grundlegende Gedanken zur Grenzziehung
3.2 Stand der Forschung
3.2.1 Internationale Forschungstraditionen
3.2.2 Forschung zur Migrantenökonomie im deutschsprachigen Raum
3.2.3 Zentrale empirische Befunde
3.3 Trends und Entwicklungsperspektiven in der Forschung zu Migrantenökonomien
4 GRÜNDUNGSFÖRDERUNG FÜR MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN
4.1 Grundlegende Gedanken zur Grenzziehung
4.2 Stand der Forschung
4.2.1 Gründungsförderung im Kontext politischer und soziodemografischer Rahmenbedingungen
4.2.1.1 Gründungsförderung im internationalen Vergleich
4.2.1.2 Zusammenhänge von Gründungsförderung und arbeitsmarkt-, wirtschafts- und sozialpolitischen Entwicklungen
4.2.2 Gründungsförderung als Beratungs- und Bildungsprozess
4.2.2.1 Institutionen der Gründungsberatung und - weiterbildung
4.2.2.2 Professionalisierung und Kompetenzen in Gründungsberatung und -weiterbildung
4.2.2.3 Gründungsberatung und -weiterbildung als pädagogische Intervention
4.2.3 Inanspruchnahme von Gründungsberatung und - weiterbildung durch Migrantinnen und Migranten
4.2.3.1 Beratungs- und Weiterbildungsbeteiligung gründungswilliger Migrantinnen und Migranten
4.2.3.2 Individuelle Hürden für die Inanspruchnahme von Gründungsberatung und -weiterbildung bei gründungswilligen Migrantinnen und Migranten
4.2.3.3 Institutionelle Hürden für die Inanspruchnahme von Gründungsberatung und -weiterbildung bei gründungswilligen Migrantinnen und Migranten
4.3 Trends und Entwicklungsperspektiven in der Forschung zur Gründungsförderung
TEIL III: THEORETISCHE ABLEITUNGEN UND METHODISCHES VORGEHEN
5 THEORETISCHE ABLEITUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE ANALYSE VON DETERMINANTEN EINER ZIELGRUPPEN- UND KOMPETENZORIENTIERTEN GRÜNDUNGSFÖRDERUNG
5.1 Zielgruppen- und Kompetenzorientierung als Mehrebenensystem
5.2 Analyserahmen für die empirische Untersuchung von Determinanten einer zielgruppen- und kompetenzorientierten Gründungsberatung und - weiterbildung
5.3 Methodologische Grundlagen
5.4 Untersuchungsdesign
5.4.1 Untersuchungsinstrumente
5.4.2 Feldzugang, Fallauswahl und Durchführung der Untersuchung
5.4.3 Datenaufbereitung und -auswertung
5.5 Qualität der Daten
5.5.1 Güte der vorliegenden Daten
5.5.2 Grenzen der Aussagekraft
TEIL IV: EMPIRISCHE ERGEBNISSE
6 INANSPRUCHNAHME PROFESSIONELLER GRÜNDUNGSFÖRDERUNG DURCH MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN
6.1 Analyse der Inanspruchnahme von Angeboten der Gründungsberatung bzw. -weiterbildung
6.2 Die Rolle öffentlicher Gründungsförderung im Unterstützungssystem von Gründerinnen und Gründern
6.3 Gründe für die Nichtnutzung professioneller Beratungs- und Weiterbildungsangebote aus Sicht der Selbstständigen
7 DETERMINANTEN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME VON ANGEBOTEN DER GRÜNDUNGSFÖRDERUNG
7.1 Einflussfaktoren auf die Nutzung von Angebotsstrukturen aus Perspektive der Gründenden
7.1.1 Bewusstsein für Beratungs- und Weiterbildungsbedarfe
7.1.2 Zusammenhänge zwischen personenbezogenen Merkmalen und der Inanspruchnahme von Beratungs- und Weiterbildungsangeboten
7.1.3 Wege der Informationssuche in Bezug auf Angebote der Gründungsberatung und -weiterbildung
7.2 Einflussfaktoren auf die Nutzung von Angebotsstrukturen aus Perspektive der Anbieter
7.2.1 Migrantinnen und Migranten als Zielgruppe der Gründungsberatung und -weiterbildung
7.2.2 Probleme beim Zugang zu öffentlichen Einrichtungen der Gründungsförderung für gründungswillige Migrantinnen und Migranten
7.2.3 Zugangswege zu Migrantinnen und Migranten als Zielgruppe der Gründungsberatung und - weiterbildung
8 FÖRDERUNG GRÜNDUNGSBEZOGENER KOMPETENZEN
8.1 Beratungs- und Weiterbildungsbedarfe von Gründenden mit Migrationshintergrund
8.1.1 Analyse spezifischer Beratungs- und Weiterbildungsbedarfe gründungswilliger Migrantinnen und Migranten
8.1.2 Domänen spezifischer Kompetenzentwicklungsbedarfe bei gründungswilligen Migrantinnen und Migranten
8.2 Gestaltungsansätze der öffentlichen Gründungsförderung
8.2.1 Inhalte der Gründungsberatung und - weiterbildung
8.2.2 Formate in der Gründungsberatung und - weiterbildung
8.2.3 Organisatorische Gestaltungsansätze der Gründungsförderung
8.3 Kompetenzen von Gründungsberaterinnen und - beratern
8.3.1 Anforderungen an Gründungsberaterinnen und - berater aus Perspektive der Ratsuchenden
8.3.2 Anforderungen an Gründungsberaterinnen und - berater aus Perspektive der Beratenden
8.3.3 Selbstverständnis von Gründungsberaterinnen und -beratern
8.3.4 Ableitung zentraler Kompetenzen von Gründungsberaterinnen und -beratern
9 STRUKTURELLE HERAUSFORDERUNGEN EINER DIVERSITÄTSORIENTIERTEN GRÜNDUNGSBERATUNG UND -WEITERBILDUNG
9.1 Die Problematik des Ineinandergreifens individueller und struktureller Herausforderungen
9.2 Grundlegende Beratungskonzepte und -ansätze
9.3 Heterogenität von Gründungswilligen und Konsequenzen aus der Perspektive gründungsfördernder Einrichtungen
9.4 Vernetzung und Interaktion von Einrichtungen der Gründungsförderung
TEIL V: EPILOG
10 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE
10.1 Die Komplexität individueller Entscheidungen hinsichtlich der Nutzung von Angeboten der Gründungsförderung
10.2 Die Notwendigkeit eines differenzierten Blicks auf gründungswillige Migrantinnen und Migranten
10.3 Anforderungen an eine zielgruppenadäquate, kompetenzorientierte Gründungsberatung und - weiterbildung
10.4 Professionelle Gründungsberatung und - weiterbildung in der Einwanderungsgesellschaft
10.5 Die Parallelität lokaler bzw. regionaler Unterstützungssysteme für Migrantinnen und Migranten
11 FAZIT UND AUSBLICK
12 LITERATURVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Entwicklung von ausländischen Selbstständigen in Deutschland
Abbildung 2: Strukturierung des Konzeptes „Personen mit Migrationshintergrund“
Abbildung 3: Anzahl und Anteil der weltweiten Migranten
Abbildung 4: Zuwanderung in der BRD
Abbildung 5: Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland
Abbildung 6: Anteil der Deutschen mit Migrationshintergrund in Deutschland
Abbildung 7: Von der Bundesagentur für Arbeit geförderte Existenzgründungen in Deutschland 1986 bis 2012
Abbildung 8: Verhältnis von Arbeitslosenzahlen und geförderten Existenzgründungen in Deutschland 2000 bis 2010
Abbildung 9: Aktuelle Themen der kommunalen Wirtschaftsförderungen
Abbildung 10: Zielgruppen- und Kompetenzorientierung in der Gründungsförderung als Mehrebenensystem
Abbildung 11: Analysedimensionen von Determinanten einer zielgruppen- und kompetenzorientierten Gründungsberatung und -weiterbildung für Gründende mit Migrationshintergrund
Abbildung 12: Untersuchungsdesign
Abbildung 13: Erreichte Einrichtungen im Rahmen der Onlinebefragung
Abbildung 14: Inanspruchnahme von Beratung (differenziert nach Migrationshintergrund)
Abbildung 15: Inanspruchnahme von Beratung (differenziert nach Einwanderungsländern)
Abbildung 16: Inanspruchnahme von Beratung (differenziert nach Einwanderungsgeneration)
Abbildung 17: Inanspruchnahme von Beratung (differenziert nach Migrationsstatus)
Abbildung 18: Inanspruchnahme von Beratungseinrichtungen (differenziert nach Migrationshintergrund)
Abbildung 19: Inanspruchnahme öffentlicher Beratung (differenziert nach Herkunftsland)
Abbildung 20: Inanspruchnahme öffentlicher Beratung (differenziert nach Migrationsstatus)
Abbildung 21: Gründe für die Nichtnutzung von Beratung (differenziert nach Migrationshintergrund)
Abbildung 22: Bedarf an externer Unterstützung (differenziert nach Migrationshintergrund)
Abbildung 23: Bedarf an externer Unterstützung (differenziert nach Einwanderergeneration)
Abbildung 24: Bedarf an externer Unterstützung (differenziert nach Herkunftsland)
Abbildung 25: Bedarf an externer Unterstützung (differenziert nach Bildungshintergrund)
Abbildung 26: Bedarf an externer Unterstützung (differenziert nach Geschlecht)
Abbildung 27: Inanspruchnahme von Beratung in Abhängigkeit eigener Bedarfsformulierung (differenziert nach Migrationshintergrund)
Abbildung 28: Inanspruchnahme von Beratung in Abhängigkeit eigener Bedarfsformulierung (differenziert nach Migrationshintergrund)
Abbildung 29: Inanspruchnahme von Beratung (differenziert nach Bildungsabschlüssen)
Abbildung 30: Inanspruchnahme professioneller Beratung (differenziert nach Kontakt zu Deutschen)
Abbildung 31: Inanspruchnahme professioneller Beratung (differenziert nach Sprachkenntnissen)
Abbildung 32: Wege der Informationssuche zu Beratungsangeboten (Befragte ohne Migrationshintergrund)
Abbildung 33: Wege der Informationssuche zu Beratungsangeboten (Befragte mit Migrationshintergrund)
Abbildung 34: Ansprache bestimmter Zielgruppen durch Einrichtungen der Gründungsförderung
Abbildung 35: Ansprache, Erreichbarkeit und Nutzungsverhalten spezifischer Zielgruppen der Gründungsberatung und -weiterbildung
Abbildung 36: Zugänge zu gründungswilligen Migrantinnen und Migranten
Abbildung 37: Gründungshemmnisse (differenziert nach Migrationshintergrund)
Abbildung 38: Gründungshemmnisse (differenziert nach Migrationshintergrund)
Abbildung 39: Angebotsspektrum im Rahmen der Gründungsförderung
Abbildung 40: (Didaktische) Formate der Gründungsförderung
Abbildung 41: Strategien im Umgang mit Sprachproblemen der Ratsuchenden
Abbildung 42: Kosten für Maßnahmen der Gründungsförderung
Abbildung 43: Erwartungen an Beratende in der Gründungsförderung (Selbstständige ohne Migrationshintergrund)
Abbildung 44: Erwartungen an Beratende in der Gründungsförderung (Selbstständige mit Migrationshintergrund)
Abbildung 45: Selbsteinschätzung wichtiger Kompetenzen von Beraterinnen und Beratern
Abbildung 46: Erforderliche Wissensbestände für die Beratung gründungswilliger Migrantinnen und Migranten
Abbildung 47: Selbstverständnis von Beraterinnen und Beratern
Abbildung 48: Beratungskonzepte von Einrichtungen
Abbildung 49: Entwicklung einrichtungsspezifischer Beratungskonzepte
Abbildung 50: Wahrnehmung von Heterogenität in der Beratung
Abbildung 51: Beratungseinrichtungen als Teil von Gründungsnetzwerken
Abbildung 52: Verweis von Ratsuchenden zu anderen Einrichtungen
Abbildung 53: Gründe für das Verweisen von Ratsuchenden zu anderen Einrichtungen
Abbildung 54: Determinanten für die Inanspruchnahme von Angeboten der Gründungsberatung und -weiterbildung
Abbildung 55: Typisierung Gründender mit Migrationshintergrund
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Struktur der Beratungsanbieter für Gründerinnen und Gründer
Tabelle 2: Rücklaufstatistik der Unternehmensbefragung
Tabelle 3: Domänen spezifischer Kompetenzentwicklungsbedarfe bei gründungswilligen Migrantinnen und Migranten im Zuge des Gründungsprozesses
Tabelle 4: Inhalte der Gründungsberatung und -weiterbildung
Tabelle 5: (Didaktische) Formate der Gründungsförderung
Tabelle 6: Kompetenzen von Gründungsberaterinnen und -beratern in Anlehnung an die DQR-Matrix
Tabelle 7: Phasen des Gründungsberatungsprozesses
Tabelle 8: Kompetenzprofil für professionell in der Gründungsberatung und -weiterbildung Tätige
Abkürzungsverzeichnis
ALG
Arbeitslosengeld
AufenthG
Aufenthaltsgesetz
bspw.
beispielsweise
bzw.
beziehungsweise
ca.
cirka
CATI
Computer Assisted Telephone Interviewing
d.h.
das heißt
DIHK
Deutscher Industrie- und Handelskammertag
e.V.
eingetragener Verein
ebd.
ebenda
EDV
Elektronische Datenverarbeitung
f.
folgende
ff.
fortfolgende
GEM
Global Entrepreneurship Monitor
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hrsg.
Herausgeber
HWK
Handwerkskammer
i.d.R.
in der Regel
IAB
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
ifm
Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim
IHK
Industrie- und Handelskammer
insb.
insbesondere
IT
Informationstechnik
Jg.
Jahrgang
k.A.
keine Aussage
KfW
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz
Kraftfahrzeug
m.E.
mit Einschränkungen
max.
maximal
MH
Migrationshintergrund
min.
minimal
mind.
mindestens
Mio.
Millionen
Nr.
Nummer
o.g.
oben genannt(e)
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development
S.
Seite
SGB
Sozialgesetzbuch
sog.
sogenannt(e)
u.a.
unter anderem
u.v.m.
und vieles mehr
vgl.
vergleiche
z.B.
zum Beispiel
z.T.
zum Teil
Aufbau der Arbeit
Grundsätzlich gliedert sich die Arbeit in fünf Kapitel.
Im Prolog wird zunächst für die Relevanz der vorliegenden Arbeit argumentiert, wofür der Versuch einer Einordnung der Thematik in gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen steht. Daraufhin erfolgt die Ableitung von Thesen, die den Anlass zur Formulierung der übergeordneten Zielstellung dieser Arbeit sowie zentraler forschungsleitender Fragestellungen liefern.
Um die Themenstellung in den existierenden Forschungsstand einzubetten und unterschiedliche disziplinäre Zugänge herzustellen, dient der zweite Teil zur Diskussion bestehender wissenschaftlicher Befunde sowie theoretischer Grundlagen. Zu diesem Zweck werden zunächst zentrale Begriffe erörtert und für die vorliegende Arbeit definiert (Gliederungspunkt 2). Daran anschließend erfolgt eine Darstellung der Forschung zu Migrantenökonomien, wobei ausgehend von internationalen Forschungstraditionen insbesondere auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung sowie zentrale empirische Befunde im deutschsprachigen Raum eingegangen wird (Gliederungspunkt 3). Mit Blick auf die zentrale Fragestellung der Arbeit wird daraufhin Forschungsarbeiten zur Gründungsförderung besondere Aufmerksamkeit gewidmet (Gliederungspunkt 4). In diesem Sinne gilt es einerseits, grundlegende wirtschafts-, arbeitsmarkt- und sozialpolitische Hintergründe der Unterstützung von Unternehmensgründungen zu destillieren und einzuordnen. Um im empirischen Teil der Arbeit speziell Determinanten einer zielgruppenadäquaten, kompetenzorientierten Gründungsberatung und -weiterbildung zu adressieren, werden andererseits vor allem Ansätze der Gründungsförderung als Beratungs- und Bildungsprozesse durchleuchtet. Im Mittelpunkt stehen dabei Konzepte zur Unterstützung gründungswilliger Migrantinnen und Migranten.
Im dritten Kapitel werden die bestehenden theoretischen Ansätze und wissenschaftlichen Befunde zu einem theoretischen Modell einer zielgruppenadäquaten, kompetenzorientierten Gründungsberatung und -weiterbildung zusammengeführt (Gliederungspunkt 5). Aus dessen Dekonstruktion erfolgt daraufhin die Ableitung eines Analyserahmens, welcher als Grundlage der empirischen Untersuchung dienen soll. Im Weiteren werden das daraus abgeleitete forschungsmethodische Design, Untersuchungsinstrumente, Zugänge zum Feld sowie die Durchführung der Datenerhebung beschrieben. Ferner sollen die zentralen Herausforderungen der Datenerhebung und letztlich die damit einhergehende Aussagekraft vor dem Hintergrund methodologischer Grundlagen eingeordnet und kritisch diskutiert werden.
Das vierte Kapitel umfasst die Darstellung und Diskussion der empirischen Ergebnisse. Ausgehend von einer grundsätzlichen Analyse der Inanspruchnahme professioneller Unterstützungsmaßnahmen durch gründungswillige Migrantinnen und Migranten (Gliederungspunkt 6) werden im Zuge dessen auf Basis der erhobenen Daten zunächst Determinanten herausgearbeitet, die einen Einfluss auf die individuelle Nutzung bestehender Angebote der Gründungsberatung und -weiterbildung haben (Gliederungspunkt 7). Diesbezüglich wird sowohl auf die Perspektive der Gründenden mit Migrationshintergrund (Nachfrageseite) als auch auf die Perspektive der anbietenden Einrichtungen (Angebotsseite) eingegangen. Ferner gilt es, inhaltliche, didaktische und organisatorische Gestaltungsansätze der Gründungsförderung sowie Kompetenzen von in der Beratung Tätigen näher zu beleuchten, wobei dezidiert auf die besonderen Herausforderungen bei der Unterstützung gründungswilliger Migrantinnen und Migranten eingegangen wird (Gliederungspunkt 8). Letztlich wird das empirische Material mit Blick auf strukturelle Herausforderungen einer diversitätsorientierten Gründungsberatung und -weiterbildung ausgewertet und diskutiert (Gliederungspunkt 9).
Das fünfte Kapitel stellt den Epilog der Arbeit dar. In diesem Sinne werden die zentralen Schlussfolgerungen der Untersuchung zusammengefasst sowie im Spiegel bestehender theoretischer Konzepte bzw. empirischer Befunde bewertet und weiterentwickelt (Gliederungspunkt 10). Das abschließende Fazit stellt ein Resümee bezüglich der Analyse dar, wobei vor allem die forschungsleitenden Fragestellungen rückblickend adressiert werden (Gliederungspunkt 11).
Teil I: Prolog
1 Einleitung
1.1 Relevanz der Thematik
Moderne Gesellschaften sind mehr denn je von Vielfalt geprägt. Ein Streifzug mit offenen Augen durch die urbanen Zentren Deutschlands offenbart die bestehende Diversität hinsichtlich Wohn- und Arbeitsformen, Bevölkerungszusammensetzung, Wirtschaftsstruktur oder kulturellem Leben. Aus modernisierungstheoretischem Blickwinkel wird der postindustriellen Gesellschaft in diesem Sinne ein umfassender Strukturwandel mit einschneidenden Auswirkungen auf Denk- und Wertesysteme, Wissenschaftssysteme, ökonomische Strukturen, Arbeits- und Produktionsprozesse, politische Partizipationsprozesse, Biografien und Lebensweisen attestiert (vgl. Beck 1986, S. 115 ff.). Dementsprechend sind Individuen und Institutionen gleichermaßen damit konfrontiert, sich dem Umgang mit Vielfalt neu anzunähern. Dies gilt im Grunde für alle gesellschaftlichen Funktionsbereiche wie beispielsweise das Bildungssystem, das Beschäftigungssystem oder das politische System. Vor dem Hintergrund dieses Selbstverständnisses gilt es, Konzepte und Umgangsformen zu entwickeln, die den Anforderungen einer zunehmend heterogenen Gesellschaft Rechnung tragen und den entsprechend sehr unterschiedlichen individuellen Herausforderungen mit Blick auf eine gesellschaftliche Teilhabe gerecht werden.
Gleichzeitig gibt es „kaum ein emotionaleres politisches Thema als die Zuwanderung“ (Schieritz 2014, S. 24). Ein wesentlicher Grund dafür liegt wohl darin, dass Zuwanderung in den Medien, in der Gesellschaft und von politischen Entscheidungsträgern ganz unterschiedlich wahrgenommen und diskutiert wird. So warnen Kritiker auf der einen Seite vor „Überfremdung“, „Parallelgesellschaften“ und „Armutszuwanderung“ und weisen vor allem auf die Gefahren und negativen Folgewirkungen von Migrationsprozessen hin. Nicht selten wird im Zuge dessen das apokalyptische Ende materiellen Wohlstands und gesellschaftlicher Stabilität vorhergesagt (vgl. Sarrazin 2010, S. 21). Auf der anderen Seite argumentieren die Befürworter zu Recht damit, dass vor dem Hintergrund einer zunehmenden ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Vernetzung institutionell geschlossene Gesellschaften in einer globalisierten Weltgesellschaft kaum vorstellbar bzw. sogar kontraproduktiv sind (vgl. Bukow et al. 2007, S. 11). Ihnen kann aber durchaus vorgeworfen werden, auf bestehende Ängste, die offensichtlich in Teilen der Bevölkerung vorherrschen, nur unzureichend einzugehen. Dies findet seinen Ausdruck im Erfolg rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa, die an dieser Stelle eine allzu großzügige Ignoranz existierender Herausforderungen und diffuser Vorbehalte geschickt ausnutzen. Insofern muss es sich die Wissenschaft umso mehr zur Aufgabe machen, einen nüchternen, auf belastbaren Daten basierenden Blick hinsichtlich der Thematik zu forcieren und damit die gesellschaftliche Diskussion zu versachlichen (vgl. Brückner 2013, S. 2).
Mit dem Wissen, dass Migrationsprozesse einerseits „kein Sonderfall der Moderne“ (Süssmuth 2006, S. 19) sind, die seit jeher die Menschheitsgeschichte prägen und andererseits selten ohne Spannungen und Konflikte verlaufen, will diese Arbeit dazu beitragen, den diesbezüglich eingeforderten nüchternen Blick zu schärfen. Zu diesem Zweck ist es allerdings unerlässlich, eine potenzialorientierte Perspektive einzunehmen, die die Offenheit gegenüber anderen Kulturen grundsätzlich als Bereicherung für ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungsprozesse in das Zentrum der Betrachtung stellt. Dahinter verbirgt sich die Überzeugung, dass gesellschaftlicher Wohlstand in einer global vernetzten Welt nur in einer Atomsphäre des konstruktiven und wertschätzenden Zusammenlebens erzeugt werden kann und letztlich von der Kreativität und den Ideen verschiedener Bevölkerungsgruppen abhängig ist.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Laut Statistischem Bundesamt leben aktuell 16,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik, d.h. 19,5 % der Bevölkerung, also annähernd jeder fünfte Einwohner (vgl. Statistisches Bundesamt 2013, S. 7). Davon besitzen mehr als 60 % (rund 9,8 Millionen) die deutsche Staatsbürgerschaft und ca. 6,5 Millionen sind Ausländer (vgl. ebd.). Sie sind entweder selbst nach Deutschland eingewandert oder haben mindestens einen Elternteil mit Migrationserfahrung. Laut Statistik wird sich der Anteil von Einwohnern mit einem unmittelbaren Bezug zu anderen Kulturkreisen aufgrund des demografischen Wandels in Zukunft tendenziell noch deutlich erhöhen. So haben in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen bereits 23,4 Prozent einen Migrationshintergrund, bei den Kindern unter 6 Jahren sogar mehr als jedes dritte Kind (34,9 %) (vgl. ebd.).
Für die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist Migration in Zukunft ein wichtiges Thema. Dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund des zu erwartenden Fachkräftemangels in einigen Wirtschaftsbereichen infolge der demografischen Entwicklung. Vielmehr hängt die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in hohem Maße von innovativen Geschäftsideen ab, die zur Gründung neuer Unternehmen führen. Insofern muss eine zukunftsfeste Wirtschaftspolitik unter anderem darauf ausgerichtet sein, einerseits die unternehmerischen Potenziale hier lebender Migrantinnen und Migranten wahrzunehmen und zu fördern sowie andererseits Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Gründungswilligen aus dem Ausland ermöglichen, ihre Geschäftsideen in Deutschland umzusetzen. Die Förderung von Unternehmertum unter Berücksichtigung der speziellen Bedarfe von Migrantinnen und Migranten gilt diesbezüglich als ein erfolgversprechendes Instrument.
In diesem Sinne steht die Sichtweise von Migration und Integration als ausschließlich sozialpolitisches Thema zur Disposition. Vielmehr gilt es, integrationsspezifische Diskurse auch unter dem Blickwinkel ökonomischer Gesichtspunkte zu führen, um eine ganzheitliche Betrachtung der Thematik zu gewährleisten. Denn nur so verstetigt sich der oben beschriebene Paradigmenwechsel – Zuwanderung als Potenzial für die Gesellschaft – auch in der gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung, sodass Integrationsprozesse nicht nur mit dem Erlernen der deutschen Sprache gleichgesetzt, sondern als Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, also im Berufsleben, dem Engagement im Verein oder im Stadtteil, zur Selbstverständlichkeit werden.
1.2 Bedarf, Ziele und zentrale Fragestellungen
In Deutschland hat die Zahl der von Migrantinnen und Migranten gegründeten Unternehmen in den letzten zwei Jahrzehnten überproportional stark zugenommen (vgl. Abbildung 1). So haben heute von den insgesamt etwa 4,5 Millionen Selbstständigen in Deutschland circa 750.000 einen Migrationshintergrund (vgl. Statistisches Bundesamt 2013, S. 47). Dementsprechend wird nahezu jedes fünfte Unternehmen in der Bundesrepublik von Migrantinnen und Migranten geführt. Insgesamt scheint sich dieser Trend auch in Zukunft fortzusetzen, da Migrantinnen und Migranten im Vergleich zu Personen ohne Migrationshintergrund in Deutschland auch weiterhin häufiger den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Diesbezüglich zeigen beispielsweise Leicht et al. im Zuge der Auswertung von Gewerbemeldungen in Baden-Württemberg auf, dass von den 57.000 Existenzgründungen im Jahr 2010 etwa ein Drittel auf Ausländer (18.900) entfielen, wobei deren Anteil an der Gesamtbevölkerung im Bezugsjahr lediglich bei 13 % lag (vgl. Leicht et al. 2012, S. 44). Damit ist die Gründungsquote bei Ausländern dreimal so hoch wie bei Deutschen.1 Vor diesem Hintergrund erfährt die Auseinandersetzung mit dem Thema „Migrantenökonomie“ sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus wirtschafts- und integrationspolitischer Perspektive zunehmend Aufmerksamkeit.
Abbildung 1: Entwicklung von ausländischen Selbstständigen in Deutschland (vgl. Statistisches Bundesamt, Mikrozensus; eigene Berechnungen ifm Universität Mannheim, Leicht/Langhauser 2014, S. 23)
Insbesondere auf regionaler und kommunaler Ebene rücken selbstständig tätige Migrantinnen und Migranten in das Zentrum der Betrachtung. Denn abgesehen von den damit verbundenen ökonomischen Chancen entfalten sich daraus positive soziale und sozialräumliche Effekte (vgl. Reimann/Schuleri-Hartje 2009, S. 509). Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze, nehmen eine stabilisierende Rolle in sozioökonomisch benachteiligten Stadtteilen ein und werden damit zu einem entscheidenden Vermittlungsakteur zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen (Integrationsfunktion). Gleichzeitig stimmt ein Blick auf die Liquidationsquoten insofern skeptisch, als dass Ausländer im Vergleich zu Deutschen ihre selbstständige Tätigkeit dreimal so häufig aufgeben (vgl. Leicht et al. 2012, S. 50). In der Forschung zu migrantischem Unternehmertum stellt sich vor diesem Hintergrund immer stärker die Frage, welche Ursachen sich hinter der hohen Fluktuation von Ein- und Austritten im Gründungsgeschehen von Ausländern verbergen.
Dem Problem der Nachhaltigkeit von Gründungen durch Migrantinnen und Migranten wurde bis dato in der Forschung lediglich in Ansätzen Aufmerksamkeit gewidmet. So können aktuelle Untersuchungen beispielsweise keine greifbaren Indizien dafür liefern, ob Charakteristika der Gründerpersonen oder unternehmensstrategische Aspekte für die im Schnitt höhere Liquidationsquote verantwortlich sind (vgl. di Bella 2013, S. 1). Ebenso wenig systematische Erkenntnisse sind darüber vorhanden, inwiefern die Inanspruchnahme von gründungsunterstützenden Strukturen (Gründungsberatung/-weiterbildung) mit dem langfristigen Erfolg von selbstständiger Tätigkeit in Zusammenhang steht. Es liegt allerdings die Vermutung nahe, dass die Nutzung gründungsvorbereitender Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen durchaus einen hohen Einfluss auf die Qualität von Unternehmensgründungen haben kann. So weist u.a. Metzger darauf hin, dass die Bestandsfestigkeit von Gründungsprojekten statistisch höher ist, wenn Gründende ein entsprechendes Qualifizierungsangebot nutzen (vgl. Metzger 2013, S. 4).
Erfolgreiches Unternehmertum hängt von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich gleichen sich zwar die Herausforderungen im Gründungsprozess bei Gründenden mit und ohne Migrationshintergrund (vgl. Floeting/Reimann/Schuleri-Hartje 2004, S. 114). Die Untersuchungen der letzten Jahre zeigen aber auch, dass selbstständige Migrantinnen und Migranten durchaus spezifischen Problemen gegenüberstehen. Deren Analyse erfolgte bis dato in unterschiedlicher Tiefe und Intensität, sodass belastbare Aussagen darüber, welchen besonderen Herausforderungen gründungswillige Migrantinnen und Migranten in Deutschland gegenüberstehen, allenfalls ansatzweise und fragmentiert existieren. Zusammenfassend deuten bestehende Publikationen überblicksartig auf folgende Befunde hin, die als forschungsleitende Thesen der vorliegenden Arbeit vorangestellt werden sollen: (1) Erstens weisen Selbstständige mit Migrationshintergrund häufig besondere Qualifizierungsbedarfe mit Blick auf ihre unternehmerische Tätigkeit auf. (2) Zweitens nehmen Selbstständige mit Migrationshintergrund vor allem die bestehenden öffentlichen Angebote der Gründungsvorbereitung und - förderung vergleichsweise selten in Anspruch und nutzen vorhandene regionale Unterstützungssysteme2 nur in geringerem Maße. (3) Drittens scheinen gründungswillige Migrantinnen und Migranten beim Zugang zu entsprechenden Angebotsstrukturen aufgrund unterschiedlicher Faktoren benachteiligt zu sein.
Abseits der Annahme, dass Unterstützungsangebote für Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund besser als bisher auf die besonderen Bedarfslagen dieser Zielgruppe ausgerichtet sein müssten, gilt die Thematik der Gründungsberatung und -weiterbildung an sich als verhältnismäßig junges, kaum wissenschaftlich durchdrungenes Forschungsfeld. Anderseck verweist diesbezüglich in Anlehnung an Steyrer darauf, dass die theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Gründungsberatung „einen äußerst geringen Präzessionsgrad […] und ein Höchstmaß an Inkonsistenz“ (Steyrer 1991, S. 7) aufweist. Insbesondere aus bildungswissenschaftlichem Blickwinkel lassen sich dabei nur wenige Anhaltspunkte dafür finden, welche inhaltlichen, didaktischen und organisationalen Gestaltungsanforderungen hinsichtlich einer kompetenzorientierten Gründungsberatung und -weiterbildung gelten. Darüber hinaus ist die Frage der Qualifikation und der Kompetenzen von in der Gründungsberatung Tätigen ebenfalls noch kaum gestellt worden (vgl. Anderseck 2009, S. 24). Vor diesem Hintergrund lassen sich weiterführend folgende Thesen formulieren. (4) Die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen erfordert eine an den Prinzipien der Kompetenzorientierung ausgerichtete Gründungsförderung. (5) Weiterhin bedarf es für die Umsetzung kompetenzorientierter Gründungsberatung und -weiterbildung für Migrantinnen und Migranten eines spezifischen Sets an Gestaltungskompetenzen aufseiten der professionell in diesem Bereich Tätigen.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich für die Analyse von Determinanten einer ebenso kompetenzorientierten wie zielgruppenadäquaten Gründungsberatung und -weiterbildung folgende übergeordnete Fragestellungen:
Wie müssen zielgruppen- und kompetenzorientierte Beratungs- und Weiterbildungsangebote für gründungswillige Migrantinnen und Migranten idealerweise gestaltet werden?
Welche Anforderungen ergeben sich aus der Gestaltung kompetenzorientierter, zielgruppensensibler Gründungsförderung an in der Gründungsberatung und -weiterbildung Tätige sowie relevante Einrichtungen?
Die Beantwortung der Fragen nach dem Erwerb gründungsrelevanter Kompetenzen sowie der Gestaltung entsprechender Angebotsstrukturen impliziert eine Auseinandersetzung auf verschiedenen Betrachtungsebenen. Auf der individuellen Ebene (Mikroebene) sollen gründungsbezogene Kompetenzen und deren Entwicklung in den Blick genommen werden. Dabei gilt es zu untersuchen, inwiefern die Gruppe der Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund tatsächlich spezifische Beratungs- und Weiterbildungsbedarfe aufweist und welche besonderen Herausforderungen dadurch für die Gestaltung von Angeboten der Gründungsförderung abgeleitet werden können. Auf organisationaler Ebene (Mesoebene) sollen weiterhin die Anforderungen an eine professionelle migrationssensible Unterstützung und Förderung von Gründenden mit Migrationshintergrund näher beleuchtet werden. Dabei rücken vor allem öffentliche Gründungsberatungs- und -weiterbildungsangebote in den Fokus der Betrachtung. Diesbezüglich richtet sich die Analyse einerseits an den Fragen aus, wie sich die inhaltliche, didaktische und organisatorische Gestaltung bestehender Formate aktuell darstellt und was eine migrationssensible Gründungsförderung ausmacht. Andererseits stellt sich die Frage, über welche Kompetenzen in der Gründungsberatung und -weiterbildung Tätige vor diesem Hintergrund verfügen müssen. Auf struktureller Ebene (Makroebene) wird darüber hinaus eine Auseinandersetzung mit regionalen Unterstützungsstrukturen für Selbstständige mit Migrationshintergrund notwendig. Wenngleich das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU), das europäische Forum für Migrationsstudien (efms) oder der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) als die Debatte durchaus prägende Institutionen sich dieses Themas bereits in Ansätzen angenommen haben, sind systematische, empirische Studien und komparative Analysen zu Strukturen und Strategien regionaler Gründungsförderung insbesondere mit Blick auf diese spezifische Zielgruppe rar (vgl. Filsinger 2009, S. 280). Daher nimmt die vorliegende Arbeit auch in den Blick, inwiefern relevante Akteure der Gründungsförderung auf regionaler Ebene Konzepte besitzen und zusammenarbeiten, um einen gleichberechtigten Zugang zu entsprechenden Angeboten für die Zielgruppe herzustellen.
1 Die Gewerbemeldungen enthalten nur Informationen zur Staatsangehörigkeit der Person. Es ist aber zu vermuten, dass ähnliche Tendenzen für Personen mit Migrationshintergrund zutreffen.
2 Unter einem regionalen Unterstützungssystem werden neben genuinen Beratungs- und Weiterbildungseinrichtungen für Existenzgründerinnen und -gründer (z.B. Kammern) auch weitere gründungsrelevante Institutionen wie bspw. branchen- und zielgruppenspezifische Unternehmensverbände, Gründerzentren und -netzwerke (Inkubatoren), Ämter und Behörden, Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungen sowie Banken und Finanzdienstleister verstanden.
Teil II: Forschungsstand und theoretische Grundlagen
2 Begriffliche Fundierung
2.1 Migranten, Ausländer, Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund
Unter Migrantinnen und Migranten werden allgemein Personen zusammengefasst, die ihren Wohnsitz für eine bestimmte bzw. unbestimmte Zeit – eventuell für immer – in eine andere Region des eigenen Landes oder ins Ausland verlegen (vgl. Münz 2007, S. 1). Dabei lässt sich zunächst prinzipiell nicht unterscheiden, ob dafür eigene Motivationslagen (z.B. Studium im Ausland) oder existenzielle Zwänge (z.B. Verfolgung) ausschlaggebend sind. Dementsprechend kommt dem Begriff grundsätzlich eine wertneutrale Bedeutung zu, die erst durch gesellschaftliche Zuschreibungen, bspw. das Herausstellen milieuspezifisch begründeter Defizite von Migrantinnen und Migranten, eine negative Konnotation erfährt. Im Gegensatz dazu wird weder der Auszubildende aus Sachsen, der aufgrund subjektiv besser empfundener Arbeits- und Lebensbedingungen nach Baden-Württemberg zieht, noch die amerikanische Gastprofessorin in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als Migrant bzw. Migrantin bezeichnet, wenngleich die oben angeführte Definition in gleicher Form zutreffen würde.
Diesem analytischen Begriffsverständnis stehen auf der Ebene nationalstaatlicher Verfasstheit juristische Konstrukte gegenüber, die den rechtlichen Status von Migrantinnen und Migranten im Sinne staatsbürgerlicher Zuordnung definieren. Dabei lässt sich grundsätzlich zwischen Ausländern, also Personen die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, und Migrantinnen bzw. Migranten mit deutscher Staatsbürgerschaft differenzieren. Im Detail unterscheidet sich die Gruppe der Ausländer hinsichtlich des Aufenthaltsstatus. Das Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG) legt dabei vier unterschiedliche Aufenthaltstitel fest, angefangen vom Visum als kurzfristig geltende (max. 3 Monate) befristete Aufenthaltserlaubnis (z.B. zur Durchreise oder für Urlaubsreisen) bis zur unbefristeten Aufenthaltserlaubnis (z.B. EU-Bürger). Besonders für diese Arbeit ist in dem Zusammenhang relevant, dass die gesetzliche Definition des Aufenthaltsstatus auch dafür bestimmend ist, ob Ausländer in Deutschland einer beruflichen Beschäftigung nachgehen können. Demgemäß hängt auch die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit von einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis ab. Im Detail regelt der § 21 des AufenthG alle damit einhergehenden Voraussetzungen und Bestimmungen.
Für Flüchtlinge gelten wiederum weiterführende Regularien gemäß Abschnitt 6 des AufenthG und der Genfer Flüchtlingskonvention. Demnach werden als Flüchtlinge nach Deutschland eingewanderte Personen bezeichnet, die aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention definierten Gründen verfolgt werden und einen effektiven Schutz in ihrem eigenen Heimatstaat nicht beanspruchen können oder in ihrem Heimatland potenziell von Verfolgung bedroht sind. Danach gilt als Flüchtling laut dem hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), wer
„ […] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder der sich als staatenlos infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will“ (Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 1951, S. 2).
Als besonders interessant mit Blick auf die vorliegende Arbeit ist hervorzuheben, dass sich die vertragsschließenden Staaten mit dem Artikel 18 des 1951 ratifizierten Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge dazu verpflichten, den
„… Flüchtlingen, […], hinsichtlich der Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit […] eine möglichst günstige und jedenfalls nicht weniger günstige Behandlung [zu] gewähren, als sie Ausländern im Allgemeinen unter den gleichen Umständen gewährt wird“ (Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 1951, S. 9).
In der Realität wird dieser Forderung allerdings häufig nur ungenügend nachgekommen, was vor allem auf die zum Teil langwierigen Feststellungsverfahren zur Anerkennung des Flüchtlingsstatus und damit des Aufenthaltstitels zurückzuführen ist. Insbesondere für die Betroffenen (Asylbewerberinnen und -bewerber) ist dieser Umstand mitunter problematisch. Ohne die Klärung des Aufenthaltsstatus ist es ihnen nicht gestattet, an Integrationskursen bzw. anderen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen bzw. einer beruflichen oder einer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen. Ferner wird langfristig gesehen sowohl ihre berufliche als auch gesamtgesellschaftliche Integration erschwert, wenn sie über Jahre hinweg abgeschottet und ohne Entwicklungsperspektive „verwaltet“ werden. Gleichzeitig entsteht auch für Deutschland als Aufnahmestaat dadurch nicht selten eine paradoxe Situation. Während einerseits gut ausgebildete Fachkräfte dringend gebraucht werden, bleiben die Potenziale innerhalb der Gruppe der Flüchtlinge ungenutzt. Wenngleich in den letzten Jahren versucht wurde, durch gesetzliche Novellierungen schnellere Bearbeitungsmechanismen durchzusetzen, gilt es in dem Zusammenhang stärkere Anstrengungen seitens der beteiligten politischen Akteure zu unternehmen, um keine Potenziale zu vergeuden und Integrationsprozesse nicht zu konterkarieren.
Im Gegensatz zur „Staatsangehörigkeit“ und zum „Aufenthaltsstatus“ stellt der Begriff „Migrationshintergrund“ ein Konstrukt dar, welches weder eindeutig definiert noch einheitlich operationalisiert und erfasst wird. Die vorliegende Arbeit orientiert sich daher an der Definition des Statistischen Bundesamtes, um zumindest einer amtlichen Grundlage folgen zu können. Demgemäß wird zunächst zwischen Personen mit eigener Migrationserfahrung, also selbst Zugewanderten, und Personen ohne eigene Migrationserfahrung, also nicht selbst Zugewanderten, unterschieden. Als Personen mit eigener Migrationserfahrung werden sowohl Ausländer als Deutsche, die nach Deutschland immigriert sind und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, bezeichnet. Letzteres betrifft beispielsweise die sog. russlanddeutschen Kontingentflüchtlinge, die vor allem nach dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion aus deren Nachfolgestaaten nach Deutschland eingewandert sind.
Als Personen mit Migrationshintergrund ohne eigene Migrationserfahrung gelten wiederum diejenigen, die nicht selbst nach Deutschland eingewandert sind. Auch hier wird zwischen Ausländern und Deutschen differenziert. Ausländer ohne eigene Migrationserfahrung können beispielsweise Nachkommen von Eingewanderten sein, die aufgrund der Staatsbürgerschaft ihrer Eltern keine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Ferner wird nicht selbst Zugewanderten mit deutscher Staatsbürgerschaft ein Migrationshintergrund zugeschrieben, die mindestens einen zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil haben. Das trifft vor allem auf die Kinder und Enkel von sog. Gastarbeitern zu, die seit ihrer Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.
Die folgende Darstellung (vgl. Abbildung 2) strukturiert den Begriff Migrationshintergrund überblicksartig:
Abbildung 2: Strukturierung des Konzeptes „Personen mit Migrationshintergrund“ (eigene Darstellung)
Im Detail differenziert das Statistische Bundesamt die Bevölkerung mit Migrationshintergrund folgendermaßen aus: (vgl. Statistisches Bundesamt 2013, S. 7)
1 Deutsche ohne Migrationshintergrund
2 Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinn
2.1 Migrationshintergrund nicht durchgehend bestimmbar
2.2 Personen mit Migrationshintergrund im engeren Sinn
2.2.1 Personen mit eigener Migrationserfahrung (Zugewanderte)
2.2.1.1 Ausländer
2.2.1.2 Deutsche
2.2.1.2.1 (Spät-)Aussiedler
2.2.1.2.2 Eingebürgerte
2.2.2 Personen ohne eigene Migrationserfahrung (nicht Zugewanderte)
2.2.2.1 Ausländer (2. und 3. Generation)
2.2.2.2 Deutsche
2.2.2.2.1 Eingebürgerte
2.2.2.2.2 Deutsche mit mindestens einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil
2.2.2.2.2.1 mit beidseitigem Migrationshintergrund
2.2.2.2.2.2 mit einseitigem Migrationshintergrund
Abseits der beschriebenen eher technokratischen Definition von „Personen mit Migrationshintergrund“ stellt sich die Lebenswirklichkeit von Migrantinnen und Migranten in der deutschen Einwanderungsgesellschaft heute differenzierter dar. Diesbezüglich wird in der aktuellen Debatte einerseits die begriffliche Definition und die damit assoziierte gesellschaftliche Zuschreibung bestimmter Wesensmerkmale diskutiert. Andererseits ignoriert die begriffliche Fassung nicht selten Selbstwahrnehmung von Migrantinnen und Migranten. Als zentraler Kritikpunkt kristallisiert sich in dem Zusammenhang heraus, dass bei der Verwendung der Begriffe „Migranten“ bzw. „Menschen mit Migrationshintergrund“ häufig eine einheitliche, zumeist negativ konnotierte soziale Gruppe kolportiert wird (vgl. Beck/Perry 2007, S. 192). Dies entlarvt die empirische Sozialforschung allerdings als Irrtum. Aus vorliegenden Untersuchungen wird vielmehr deutlich, dass sich Migrantinnen und Migranten nicht länger als eine homogene Gruppe begreifen lassen (vgl. Wippermann/Flaig 2009, S. 6). Als Grundlage dieser Aussage gelten die Befunde von Wippermann und Flaig, die erstmals den gesellschaftswissenschaftlichen Ansatz der Sinus-Milieus auf die Analyse von Lebenswelten und Lebensstilen von in Deutschland lebenden Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund übertragen haben. Insgesamt kommen sie zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Gruppe der Migrantinnen und Migranten „nicht um ein besonderes und schon gar nicht um ein einheitliches Segment der Gesellschaft handelt“ (ebd., S. 11). Die Migrations- und Integrationsforschung mit ihren zahlreichen Teilbereichen hat dies bereits in vielfältiger Form zur Kenntnis genommen. So werden migrationsrelevante Themen innerhalb verschiedener Fachdisziplinen heute im Wesentlichen nicht mehr unter der Chimäre von Negativ- und Defizitorientierung behandelt. Im Gegenteil kristallisieren sich innovative Ansätze in der Migrationsforschung heraus, die ohne Anspruch auf Vollständigkeit die Potenziale von „transnationalen sozialen Räumen“ (vgl. Pries 2001, S. 51), von „hybriden Identitäten“ (vgl. Dreher/Stegmaier 2007, S. 10 ff.) oder „code-switching“ (vgl. Auer, S. 92 ff.) in den Blick nehmen.
Doch nicht allein die wissenschaftliche Evidenz lässt den Schluss zu, dass sich die Wahrnehmung von Migrantinnen und Migranten trotz aller damit verbundenen Herausforderungen im gesamtgesellschaftlichen Kontext in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat. Sogenannte Migrantinnen und Migranten sind heute – zumindest im alltäglichen Leben in den urbanen Zentren Deutschland – faktisch integraler Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Sie sind Arbeitskolleg(inn)en, Freundinnen und Freunde, Kommiliton(inn)en, Familienmitglieder und eben auch Unternehmer(innen). Nicht zuletzt aus Sicht der Migrantinnen und Migranten selbst entsteht bei genauer Betrachtung sukzessive ein Selbstverständnis, eben nicht mehr als „besondere Gruppe“, sondern als selbstverständlicher Teil wahrgenommen zu werden. Die vorliegende Arbeit operiert mit den Begriffen „Migrantinnen und Migranten“, „Ein- und Zugewanderte“ sowie „Menschen mit Migrationshintergrund“ im vollen Bewusstsein der diskutierten Differenzierungen synonym.
2.2 Migration
2.2.1 Migration als globales Phänomen
Migration leitet sich von dem lateinischen Wort „migratio“ ab, welches ganz allgemein für Wanderung steht. Darunter wird die auf Dauer angelegte, beziehungsweise dauerhaft werdende räumliche Veränderung des Lebensmittelpunktes einer oder mehrerer Personen verstanden (vgl. Kröhnert 2007, S. 1). Die Migrationsforschung differenziert dabei zwischen Binnenmigration und internationaler Migration, wobei Binnenmigration innerhalb nationalstaatlicher Grenzen stattfindet und internationale Migration eine spezifische Form räumlicher Mobilität darstellt, bei der Herkunft und Ziel der Migrantinnen und Migranten Migrierenden in verschiedenen Ländern liegen (vgl. Münz 2007, S. 1).
Je nach Land existieren unterschiedliche Definitionen davon, ab wann eine Person als Migrant bzw. Migrantin bezeichnet wird. So werden in Deutschland bereits Personen als Migrantinnen oder Migranten bezeichnet, die sich mehr als drei Monate im Land aufhalten. Im Gegensatz dazu können Individuen mehrere Jahre in den USA verbringen, ohne offiziell als Einwanderer zu gelten.
Migrationsbewegungen sind keinesfalls ein neuartiges Phänomen. Dennoch lässt sich statistisch feststellen, dass vor allem im 20. Jahrhundert ein signifikanter Anstieg von Migrantinnen und Migranten auf internationaler Ebene zu verzeichnen ist. Dabei blieb der prozentuale Anteil der wandernden Weltbevölkerung zwar nahezu konstant, aber aufgrund des rasanten Bevölkerungswachstums nahm die absolute Anzahl deutlich zu. Dies lässt sich in der folgenden Abbildung nachvollziehen, in der die Anzahl und der Anteil der weltweiten Migrantinnen und Migranten in den Jahren 1960, 2000, 2005 sowie 2010 gegenübergestellt wird (vgl. Abbildung 3). Ergänzend muss diesbezüglich erwähnt werden, dass die hier rezipierte Statistik lediglich auf die registrierten Migranten eingeht. Aufgrund der nicht registrierten Anzahl sog. „Sans papiers“ (Papierlose, auch illegale Migranten) muss insgesamt eine weitaus höhere Anzahl internationaler Migrantinnen und Migranten angenommen werden.
Abbildung 3: Anzahl und Anteil der weltweiten Migranten (International Organisation for Migration 2010, S. 115)
Die potenziellen Gründe sowie die Komplexität der Einflussfaktoren für Migrationsentscheidungen machen eine ebenso klare wie eindeutige Differenzierung internationaler Migrationsbewegungen sowie ihrer Hintergründe nahezu unmöglich. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind persönliche Faktoren, wie beispielsweise Alter, Geschlecht oder Bildungshintergrund, ebenso relevant wie äußere Ursachen, die sich in der ökonomischen Situation eines Landes oder einer Region bzw. den ökologischen Rahmenbedingungen widerspiegeln können (vgl. Krause 2004, S. 31). Daher unterscheiden Lucassen und Lucassen ganz grundsätzlich zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Migration (vgl. ebd.). Opitz differenziert aufbauend darauf zwischen drei Migrantengruppen, nämlich politischen Flüchtlingen, Arbeits- und Umweltflüchtlingen, wobei auch er eine methodisch saubere Trennung für unmöglich hält (vgl. Opitz 2000, S. 272 ff.).
Aus wissenschaftlicher Perspektive versuchen sich unterschiedliche Disziplinen dem Phänomen internationaler Migrationsbewegungen zu nähern, wobei daraus bis dato keine allgemein gültige Migrationstheorie entstanden ist. Vielmehr betrachten die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen Migration naturgemäß aus unterschiedlichen Blickwinkeln, was eine Zusammenführung theoretischer Erkenntnisse tendenziell erschwert (vgl. Wüst 1995, S. 9). So werden aus ökonomischer Perspektive vor allem die Ursachen von Migrationsentscheidungen beleuchtet, wohingegen innerhalb der Soziologie versucht wird, die Auswirkungen und Konsistenz von Wanderungsbewegungen in den Blick zu nehmen. Interessanterweise hat die Politikwissenschaft relativ wenig zur Theoriebildung in diesem Bereich beigetragen, obwohl die Thematik zweifelsohne einen hohen Stellenwert in der nationalen wie internationalen Politikgestaltung besitzt.
2.2.2 Migration in Bezug auf Deutschland
Die deutsche Geschichte ist seit jeher von Migrationsbewegungen geprägt. Für das bessere Verständnis der vorliegenden Analyse erscheint es allerdings nicht notwendig, die gesamte Migrationshistorie in den Blick zu nehmen, sondern vielmehr den Zeitraum nach 1945 eingehender zu beleuchten.
Hierbei wird deutlich, dass sich die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten zwei deutschen Staaten hinsichtlich ihrer Migrationsgeschichte deutlich voneinander unterscheiden. So waren insbesondere die Gebiete der westlichen Besatzungszonen in den Nachkriegsjahren damit konfrontiert, etwa zehn Millionen Einwanderer, die sich im Wesentlichen aus Heimatvertriebenen, Flüchtlingen aus der sowjetischen Besatzungszone, heimatlosen Ausländern und politischen Flüchtlingen zusammensetzten, zu integrieren. Dabei kam es zu immensen Spannungen zwischen der ansässigen Wohnbevölkerung und den Eingewanderten, da infolge der massiven Zerstörung der Infrastruktur eine flächendeckende Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Wohnraum, Nahrungsmitteln und Arbeitsplätzen äußerst schwierig war. Zur Lösung dieser Probleme wurde 1949 das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (BMVt) eingerichtet, um die sozialpolitische Aufgabe der Integration von Flüchtlingen zu bewerkstelligen. Interessanterweise gibt die Bedarfsbeschreibung dieses Ministeriums Hinweise darauf, dass bereits damals auf die Möglichkeit zur Existenzgründung als integrationsförderndes Instrument verwiesen wurde:
„Die Vertriebenen erwarten Wohnung und Arbeit, Möglichkeit der Existenzgründung, sozialrechtliche Betreuung und Entschädigung für ihre Verluste“ (Bundesministerium für Vertriebene 1953, S. 3).
Aufgrund des in den 1950er-Jahren einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwungs konnten die nach dem Krieg Zugewanderten allerdings relativ schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden, sodass auch die sozialen Spannungen nachließen. Vielmehr zeichnete sich sogar ein zusätzlicher Bedarf an Arbeitskräften ab, was die damalige Bundesregierung veranlasste, eine aktive Anwerbepolitik ausländischer Arbeitskräfte voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund wurden 1955 mit Italien und 1960 mit Spanien und Griechenland bilaterale Anwerbeabkommen geschlossen. Mit dem Bau der Mauer 1961 und der damit einhergehenden strengen physischen Trennung von DDR und BRD brach die Ost-West-Migrationsbewegung, die bis dato für über zwei Millionen Zuwanderer in der BRD sorgte, quasi über Nacht ein. Der sich nun noch akuter abzeichnende Mangel an Arbeitskräften in den 1960er-Jahren mündete in weitere Anwerbeabkommen mit der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und dem ehemaligen Jugoslawien.
Die Anwerbepolitik der BRD zum damaligen Zeitpunkt war dezidiert darauf angelegt, temporäre Defizite an Arbeitskräften in bestimmten Industriezweigen auszugleichen (vgl. Reißlandt 2005). Dementsprechend galt der gesellschaftspolitische Konsens, dass die über Anwerbeabkommen eingewanderten Migrantinnen und Migranten in ihr Heimatland zurückgeschickt werden würden, insofern diese als Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht würden. In der Folge fanden kaum Bemühungen statt, die Integration der Zugewanderten in die Gesellschaft zu fördern. Vielmehr lebten die sog. Gastarbeiter i.d.R. von der einheimischen Bevölkerung separiert in Sammelunterkünften. Doch bereits die wirtschaftliche Rezession zwischen 1966 und 1969, währenddessen ein Drittel der Migrantinnen und Migranten ihre Arbeit verloren, machte deutlich, dass seitens des Staates keine Maßnahmen ergriffen werden würden, die auf eine konsequente Rückführung ausgerichtet waren. Mit dem einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwung nach 1969 setzte sich die Anwerbepolitik sogar auf noch höherem Niveau fort. So markiert das Jahr 1970 mit über einer Million Einwanderern den Höhepunkt der bundesrepublikanischen Anwerbepolitik. (vgl. Abbildung 4)
Abbildung 4: Zuwanderung in der BRD (1950 – 1975) (vgl. Statistisches Bundesamt 2010)
Im Zuge der inzwischen auf mehrere Jahre angelegten Aufenthalte der Gastarbeiter holten diese zunehmend ihre Familien nach Deutschland. Infolgedessen wurden erstmals in der Breite gesellschaftliche Integrationsprobleme wahrnehmbar, die insbesondere die Kinder der Gastarbeiterfamilien in den Schulen zu spüren bekamen. Aus der daraufhin aufkeimenden Debatte um schulische Probleme und Diskriminierung im Schulalltag entstanden die ersten Maßnahmen einer aktiven Integrationsförderung, die im Wesentlichen von den direkt betroffenen Akteuren vor Ort angestoßen und getragen wurden. Ungeachtet dieser „neuen Realitäten“ war die Migrationspolitik weiterhin restriktiv angelegt, was durch unsichere Aufenthaltsregulierungen sowie Zuzugssperren in „bereits übersiedelten Gebieten“ seinen Ausdruck fand (vgl. Reißlandt 2005, S. 1). Damit war vor allem das politische Signal an die deutsche Mehrheitsgesellschaft verbunden, dass der überwiegende Teil der Gastarbeiter in seine Heimat zurückkehren würde.
Im Gegensatz zur BRD fand in der DDR bezogen auf die Quantität keine annähernd vergleichbare Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften statt. Erst in den 1960er-Jahren entschied sich die damalige Regierung dazu, die einheimische Industrie zum Zweck der Linderung des Arbeitskräftemangels und der Produktionsunterauslastung durch die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland zu unterstützen. Allerdings war deren Anzahl im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, selbst als sich deren Anzahl im Laufe der 1980er-Jahre deutlich erhöhte, marginal (vgl. Kindelberger/Weiss 2007, S. 36 f.). Zudem wurden die sog. „Vertragsarbeiter“ ausschließlich aus ideologisch verbündeten Staaten wie Vietnam, Mosambik, Kuba oder Angola rekrutiert.
Ähnlichkeiten zwischen der Anwerbepolitik der BRD und der DDR lassen sich im Grunde nur mit Blick auf deren temporäre Anlage ausmachen. So war auch die Zuwanderung in die DDR explizit nicht mit einer längerfristigen Bleibeperspektive für die Ausländer verbunden (vgl. ebd., S. 35 f.). Zwar galten die Vertragsarbeiter gegenüber ihren deutschen Arbeitskollegen offiziell als gleichgestellt, erfuhren aber in der Realität eine Sonderbehandlung. Faktisch erfolgte deren Unterbringung i.d.R. in von den Einheimischen separierten Wohnheimen oder sie wurden eigenen Schichten in der Produktion zugeteilt. Dies führte letztlich dazu, dass ein regelmäßiger Kontakt zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Vertragsarbeitern in der DDR kaum zustande kam.
Abseits der Anwerbung ausländischer Fachkräfte fand Zuwanderung in die DDR entweder durch die Aufnahme politischer Flüchtlinge oder durch Kontingente für ausländische Studierende oder Lehrlinge statt. Insgesamt ist die Anzahl derer, die über diesen Weg in die DDR einreisten, als sehr gering anzunehmen. Ferner war die Zuwanderung streng reglementiert. Die Aufnahme von Flüchtlingen wurde ohnehin nur aus politischen Erwägungen heraus, bspw. der Unterstützung von bestimmten Strömungen im Ausland, in Erwägung gezogen und war zudem auf einige wenige Länder wie Chile, Nicaragua oder Griechenland zu Zeiten der Militärdiktatur beschränkt. Dies galt auch für die Zuwanderung von Studierenden oder Auszubildenden, die nahezu ausschließlich aus „befreundeten“ Staaten des ehemaligen Ostblocks stattfand.
Zumindest offiziell war die Aufnahme von politischen Flüchtlingen oder die Aufnahme von Studenten und Lehrlingen mit einer dauerhaften Bleibeperspektive verbunden. Wie im Fall der Vertragsarbeiter waren intensive Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung allerdings nicht wirklich angedacht. Insbesondere die Zuwanderung zu Lehr- und Ausbildungszwecken war darauf ausgelegt, dass die Studierenden und Auszubildenden nach dem Abschluss wieder in ihre Heimatländer zurückkehrten. Deshalb wurden ausländische Schüler und Studierende konsequent separat untergebracht (vgl. ebd., S. 2). Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung lebten fast 200.000 Ausländer in der DDR, was nur etwas mehr als ein Prozent der gesamten Wohnbevölkerung ausmachte (vgl. ebd., S. 33).
Erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands in den 1990er-Jahren setzte sich bei den politischen Entscheidungsträgern sowie in Teilen der Gesellschaft ein Selbstverständnis durch, dass Deutschland de facto als Einwanderungsland bezeichnet werden muss. Dies äußerte sich vor allem in ersten proaktiven Integrationsmaßnahmen, die allerdings vorerst von Pragmatikern auf kommunaler Ebene eingefordert und getragen wurden. Ferner begannen sich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunehmend dem Phänomen der Migration und Integration in Deutschland zu widmen. Für diesen Paradigmenwechsel lassen sich zwei wesentliche Gründe identifizieren. Zum einen stiegen die Einwanderungszahlen in dieser Zeit durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien infolge des Balkankrieges sowie eine verstärkte Einwanderung aus Osteuropa und Zentralasien noch einmal drastisch an, sodass sich die Ausländeranzahl im Bundesgebiet auf sieben Millionen fast verdoppelte (vgl. Thränhardt 2010, S. 19). Zum anderen entstand im selben Zeitraum nach den gewaltsamen Übergriffen auf Asylbewerberheime ein Handlungsdruck, der die politischen Entscheidungsträger dazu zwang, sich stärker als bisher der Zuwanderungs- und Integrationsthematik zu widmen. Aus heutiger Sicht kann schon allein aus statistischer Sicht kein Zweifel daran bestehen, dass Deutschland faktisch ein Einwanderungsland ist. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, besitzen 16,6 Mio. Menschen – also nahezu 20 % der Bevölkerung – in Deutschland einen Migrationshintergrund (vgl. Abbildung 5).
Abbildung 5: Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland (in Mio.) (vgl. Statistisches Bundesamt 2013, S. 7)
Die unterschiedliche Migrationsgeschichte in den alten und den neuen Bundesländern macht sich bis heute bemerkbar. Allein der Blick auf die Zahlen verdeutlicht ein immenses Ost-West-Gefälle (abgesehen von Berlin). Während urbane Ballungsgebiete wie Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Köln, das Ruhrgebiet oder Hamburg einen Anteil an Bevölkerung mit Migrationshintergrund von teilweise über 40 % aufweisen, liegt dieser in den östlichen Bundesländern z.T. deutlich unter 10 %. Die folgende Grafik stellt diesen Unterschied anhand von prozentualen Bevölkerungsanteilen mit Migrationshintergrund dar, wobei die dunkel eingefärbten Regionen einen sehr hohen Anteil (über 35 % im Vergleich zur Gesamtbevölkerung) indizieren. (vgl. Abbildung 6). Diese Unterschiede lassen sich allerdings nicht ausschließlich auf historische Gegebenheiten zurückführen. So ist davon auszugehen, dass die aktuell ungünstigere Arbeitsmarktlage in den neuen Bundesländern damit in Zusammenhang gebracht werden muss. Abseits der zahlenmäßigen Unterschiede lassen sich zudem Differenzen zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern hinsichtlich der Herkunftsländer von Migrantinnen und Migranten feststellen. So kommen die Eingewanderten in Westdeutschland hauptsächlich aus der Türkei, Griechenland, Italien oder den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, während die migrantische Bevölkerung in Ostdeutschland im Wesentlichen aus Vietnam, der Russischen Föderation, der Ukraine, Polen oder Zentralasien stammt.
Abbildung 6: Anteil der Deutschen mit Migrationshintergrund in Deutschland (2012) (vgl. Statistisches Bundesamt 2013, S. 21)
2.3 Integration
Aufgrund der neu zu bewertenden Realitäten mit Blick auf die Einwanderungssituation im wiedervereinten Deutschland lässt sich spätestens in den 1990er-Jahren ein Paradigmenwechsel bezüglich der politischen und gesellschaftlichen Bewertung von Migrationsprozessen beobachten. In diesem Sinne kann von einem Wandel von einer Zuwanderungs- zu einer Integrationsdebatte gesprochen werden. Dies manifestiert sich u.a. darin, dass Integration heute als zentrale Aufgabe deutscher Innenpolitik verstanden wird (vgl. Bielefeld 2007, S. 11). Dementsprechend gilt Integrationspolitik inzwischen als „Querschnittsaufgabe vieler Politikbereiche“ (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2005), deren Gestaltung nicht nur auf unterschiedlichen politischen Handlungsebenen forciert wird, sondern auch einen gewissen Grad an Institutionalisierung (z.B. durch das Amt von Integrationsbeauftragten) erfahren hat. Ungeachtet dessen stellen Migration und Integration bis auf Weiteres voneinander getrennte Politikbereiche dar, wobei Migrationspolitik vor allem die Steuerung von Migrationsbewegungen im Blick hat und Integrationspolitik im Wesentlichen auf die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen ausgerichtet ist.
„Eine gelungene Integration der Menschen, die auf Dauer zu uns kommen, ist von grundlegender Bedeutung für die innere Verfassung unserer Gesellschaft. Integration kann nur gelingen, wenn Migration gesteuert und begrenzt wird.“ (ebd.)
Trotz einer indes umfassend geführten Auseinandersetzung mit Integrationsprozessen fehlt weiterhin eine allgemein gültige Begriffsbestimmung. Vielmehr lesen sich die vorliegenden Definitionen eher wie mehr oder weniger erschöpfende Anforderungskataloge (vgl. Bielefeld 2007, S. 13). Kritisch betrachtet könnte in dieser Unterlassung aber auch ein gewisser Respekt vor Ressortstreitigkeiten mitschwingen, da sog. Querschnittsaufgaben in der bundesrepublikanischen Verwaltungsrealität alles andere als leicht in konkrete Handlungen münden. Allein die folgende Definition sorgt beim politisch interessierten Beobachter für Sorgenfalten, insofern er darüber nachdenkt, wie ideal die Einigungs- und Abstimmungsmechanismen zwischen verschiedenen Ministerien im Grunde gestaltet sein müssten, um eine konsistente Integrations-politik tatsächlich umzusetzen. Vor diesem Hintergrund scheint es umso plausibler, dass Staaten wie Australien, Dänemark oder Kanada eigenständige Integrationsministerien installiert haben.
„Der Grad der gesellschaftlichen Integration von Migranten gibt […] im Kern Antwort auf die Frage, in welchem Ausmaß es diesen gelingt, an den für die Lebensführung bedeutsamen gesellschaftlichen Bereichen teilzunehmen, also Zugang zu Arbeit, Erziehung und Ausbildung, Wohnung, Gesundheit, Recht, Politik, Massenmedien und Religion zu finden.“ (Brommes 2007, S. 3)
Innerhalb der gesellschaftlichen Debatte wird i.d.R. zwischen verschiedenen Ebenen der Integration unterschieden (vgl. Reimann/ Schuleri-Hartje 2009, S. 501). Mit Blick auf die vorliegende Arbeit wird dabei vor allem auf das Gelingen einer strukturell-systemischen Integration abgehoben. In dem Zusammenhang spielt die Integration in den Arbeitsmarkt sowie in andere institutionelle Zusammenhänge (z.B. Schulsystem, Gesundheitssystem, usw.) eine herausragende Rolle. Da die anderen Integrationsebenen im Zuge dessen allerdings gleichermaßen tangiert werden, gilt es, politisch-rechtliche, kulturellidentifikatorische oder soziale Aspekte von Integration ebenso zu beachten.
Aus politischer Perspektive existieren im Wesentlichen zwei konkurrierende Leitbilder von Integration (vgl. ebd., S. 502). In Anlehnung an die Idee einer weitestgehend offenen Gesellschaft nach dem Beispiel von Kanada, den Niederlanden oder Belgien wird einerseits ein multikulturelles Integrationsverständnis postuliert. In dem Zusammenhang steht die offene Interaktion von Aufnahmegesellschaft und Migrantengruppen im Vordergrund. Dahinter verbirgt sich ein Gesellschaftsmodell, welches das Zusammenleben in friedlicher Koexistenz mit wechselseitigen Rechten und Pflichten in das Zentrum integrationspolitischer Entscheidungsprozesse stellt (vgl. Bielefeld 2007, S. 15). Geprägt von den Erfahrungen zunehmender sozialer Verwerfungen zwischen der migrantischen Bevölkerung und der Aufnahmegesellschaft gerieten die multikulturellen Ansätze allerdings in den letzten Jahren immer stärker in die Kritik. So führen die Gegner solcher offenen Ansätze an, dass die Überbewertung des Faktors „Kultur“ letztlich die Existenz struktureller Diskriminierung infolge unterschwelliger Ressentiments sowie die sozialen Schattenseiten multikultureller Gesellschaften ignoriert (vgl. ebd., S. 14). In der Folge lässt sich in diesen Staaten ein Richtungswechsel bezüglich der Integrationspolitik erkennen, der zumeist in rigideren Anforderungen an die Migrantinnen und Migranten, bspw. hinsichtlich des Erlernens der Landessprache, seinen Ausdruck findet.
Wie in vielen anderen Ländern stellte das Modell einer multikulturellen Gesellschaft in Deutschland kein in der Breite akzeptiertes Konzept dar (vgl. ebd.) Vielmehr präferieren die Mehrzahl der politischen Entscheidungsträger assimilatorische Integrationsmodelle, die im Wesentlichen auf eine „Anpassung Einzelner an die Mehrheitsgesellschaft“ (Reimann/Schuleri-Hartje 2009, S. 502) ausgerichtet sind. Damit werden einerseits vorherrschende sozialwissenschaftliche Befunde zu gelingender Integration aufgegriffen. Andererseits reflektiert ein solches Leitbild stärker die gesellschaftlichen Vorstellungen. Wie die nachfolgende Definition allerdings zeigt, steht Integration als assimilatorisch gedachtes Konzept aber nicht für eine Aufgabe kultureller Werte, sondern bezieht sich auf eine aktive gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und Migranten durch die Anpassung an vorgefundene Strukturen und Wertesysteme.
„Zusammenfassend findet Integration statt, wenn Migranten sich kulturell, strukturell, sozial und emotional assimilieren. […] Dabei geht es jedoch nicht um das Abwerfen der Herkunftskultur, sondern um eine Teilhabe an der Aufnahmegesellschaft.“ (vgl. Esser 2001, S. 24 f.)
Als wesentliche Herausforderung für eine aktive gesellschaftliche Teilhabe gilt die strukturelle Assimilation, worunter der gleichberechtigte Zugang zum Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt und zum Bildungssektor verstanden wird (vgl. ebd., S. 25). Um dies zu realisieren, sind aber nicht nur Anstrengungen seitens der Migrantinnen und Migranten notwendig. Integration – auch in einem assimilatorischen Sinne verstanden – stellt vielmehr einen Prozess dar, in dem auch die Aufnahmegesellschaft Verantwortung übernimmt, indem sie bspw. Rahmenbedingungen für Gleichberechtigung schafft. Vor diesem Hintergrund weist die offizielle Definition der Bundesregierung explizit auf die wechselseitige Verpflichtung von Staat, Mehrheitsgesellschaft und Eingewanderten bei der Ermöglichung von Integrationsprozessen hin.
„Integration ist ein langfristiger Prozess. Sein Ziel ist es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben, in die Gesellschaft einzubeziehen. Zuwanderern soll eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden. Sie stehen dafür in der Pflicht, Deutsch zu lernen sowie die Verfassung und die Gesetze zu kennen, zu respektieren und zu befolgen.“ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011)
Unter dem Eindruck sozialer Problemkumulationen, die in Zusammenhang mit der Integration von Migrantinnen und Migranten gestellt werden, erfährt das Thema heute sowohl theoretisch als auch praktisch in einer Vielzahl von Handlungs- und Forschungsfeldern besondere Relevanz. Hintergrund dessen ist die Einsicht einer funktionalen Differenzierung, der ein Verständnis von Integration mit prozessualen und mehrdimensionalen Charakteristika zugrunde liegt (vgl. Läpple/Walter 2007, S. 115). Wie bereits die Definition von Integration nahelegt, erfolgt eine Integration nicht in „die“ Gesellschaft, „sondern über sehr unterschiedliche Integrationsinstanzen und -medien in die verschiedenen Teilsysteme der Gesellschaft“ (ebd.). Damit gehen im Wesentlichen zwei Tendenzen einher. Mit Blick auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung ist Integration einerseits zu einer Thematik mit Bezügen zu einem weiten Spektrum an Wissenschaftsdisziplinen geworden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bildet Integration in den Sozial-, den Bildungs-, Politik-, Wirtschafts- und Sprachwissenschaften, der Stadt- und Raumplanung, der Soziologie und Psychologie ein spezifisches Forschungsfeld. Ebenso breit gefächert ist andererseits die praxisbezogene Beschäftigung mit der Integrationsthematik, die im Rahmen von Projekten, Initiativen und Regelangeboten in allen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Funktionsbereichen inzwischen als Querschnittsaufgabe angesehen wird. Die Arbeit operiert mit dem Integrationsbegriff im vollen Bewusstsein über die Vielfalt der diskutierten Dimensionen und Ebenen entsprechend der Definition des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.
2.4 Selbstständige unternehmerische Tätigkeit
Da sich die vorliegende Arbeit mit Migrantinnen und Migranten als selbstständige Wirtschaftsakteure auseinandersetzt, gilt es im Rahmen der Begriffsklärung zu einem für die Analyse nachvollziehbaren Verständnis von Unternehmertum zu gelangen. Dies ist insofern notwendig, als dass im Zuge der Forschung zu Migrantenökonomien die Begriffe „Unternehmertum“, „Entrepreneurship“, „freiberufliche Tätigkeit“ oder „Selbstständigkeit“ häufig ohne Präzisierung synonym verwendet werden. Dabei soll es allerdings nicht darum gehen, an dieser Stelle den Forschungsstand mit Blick auf die allgemeine Entrepreneurship-Forschung zu replizieren. Vielmehr wird auf zwei unterschiedliche Verständnishorizonte von selbstständiger unternehmerischer Tätigkeit eingegangen, die im Rahmen der Untersuchung voreinander abzugrenzen sind.
Im Sinne der Entrepreneurship-Forschung wird i.d.R. auf die Unternehmerin bzw. den Unternehmer als Person sowie die Relevanz von Unternehmertum aus volkswirtschaftlicher sowie gesamtgesellschaftlicher Perspektive Bezug genommen. Dabei richtet sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung bis heute zumeist an den Befunden von Schumpeter aus, für den der Unternehmer eine Person darstellt, „welcher Ressourcen in einer neuen Weise kombiniert und Arbeitsplätze schafft, was schließlich den Fortschritt der gesamten Volkswirtschaft ermöglicht“ (Neck/Brush/Allen 2009, S. 14). Dahinter verbirgt sich Schumpeters Überzeugung, dass Individuen ihre Kreativität und Leistungsfähigkeit im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit für die ökonomische Entwicklung eines Landes in besonderem Maße zur Geltung bringen können. Daran anknüpfend formulierte u.a. Birch, dass das Unternehmertum die ultimative Triebkraft des wirtschaftlichen Wachstums ist. (vgl. Meyer/Neck/Meeks 2002, S. 21 f.) Vor diesem Hintergrund etablierte sich die Entrepreneurship-Forschung spätestens seit den 1970er-Jahren als eigenständige Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften und erfuhr seitdem einen deutlichen Bedeutungszuwachs. In der nachfolgenden Ausdifferenzierung etablierten sich im Wesentlichen drei zentrale Forschungsbereiche: der Unternehmer als Individuum, Unternehmertum und organisationale Strukturen sowie Unternehmertum und dessen volkswirtschaftliche Bedeutung. Dementsprechend werden mit dem Begriff des Entrepreneurs vor allem die Unternehmerpersönlichkeit sowie damit einhergehend dessen individuelle Kompetenzen für ein erfolgreiches unternehmerisches Handeln in den Blick genommen. Mit Blick auf die Arbeit ist vor allem dieses Verständnis von selbstständiger unternehmerischer Tätigkeit relevant, da die Analyse hauptsächlich auf Fragen zur Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen fokussiert.
Abgesehen davon berührt die Auseinandersetzung mit selbstständiger unternehmerischer Tätigkeit eine juristische Dimension. Diese basiert grundsätzlich auf dem § 7 Absatz 1 des vierten Sozialgesetzbuchs (SGB IV) und markiert die Abgrenzung einer selbstständigen Tätigkeit von einer abhängigen Beschäftigung im rechtlichen und steuerlichen Sinne (vgl. Bundesministerium für Finanzen 2011). Dementsprechend wird zwischen selbstständiger und nicht selbstständiger im Hinblick auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung unterschieden. Ferner stellt der Status von Beschäftigten laut Bundessozialgericht (BSG) das entscheidende Merkmal für eine Unterscheidung dar. So gilt für nicht selbstständig Tätige, dass diese als Arbeitnehmer in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Entscheidendes Kriterium dafür ist die Weisungsbefugnis, die dem Arbeitgeber ein Direktionsrecht einräumt. Demgemäß können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Tätigkeit nicht selbstbestimmt durchführen, sondern unterliegen der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers bspw. hinsichtlich der Arbeitszeit, der Arbeitsdauer, des Arbeitsorts sowie der Art der Arbeit. (vgl. ebd.) Im Gegensatz dazu besitzen selbstständig Tätige eine Verfügungshoheit über ihre Arbeitskraft, wodurch sie über die oben aufgeführten Aspekte selbst entscheiden können. Damit geht allerdings einher, dass sie eigenständig die Verantwortung für den Einsatz ihrer Ressourcen tragen (vgl. ebd.). Nachrangig dieser allgemeinen Unterscheidung differenziert sich der Status von unternehmerisch Tätigen in vielfältiger Form juristisch daraus, was im Detail u.a. Unternehmensform, Umsatz, Mitarbeiterzahl, Art der Leistungserbringung, Eigentumsverhältnis, steuerlichen Status (Gewerbetreibende vs. freiberuflich Tätige) oder Kammer- und Verbandsmitgliedschaften betrifft.
Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass sich unter „selbstständiger unternehmerischer Tätigkeit“ zwei grundsätzlich unterschiedliche Begriffsverständnisse verbergen. So referiert Selbstständigkeit einerseits auf die unternehmerische Tätigkeit eines Individuums und die damit einhergehenden Voraussetzungen sowie Implikationen für dessen marktwirtschaftliches und gesellschaftliches Wirken. Auf der anderen Seite ist eine selbstständige Tätigkeit im legislativen Sinne definiert und bezieht sich auf Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. freiberuflich Tätige als juristische Personen. Im Bewusstsein um diese Unterscheidung werden in der Arbeit die Begriffe „Selbstständige“, „Unternehmerinnen und Unternehmer“ und „Entrepreneure“ (mit Migrationshintergrund) synonym genutzt. Dies gilt für „Unternehmertum“ und „Selbstständigkeit“ (von Migrantinnen und Migranten) gleichermaßen.
2.5 Kompetenz- und Zielgruppenorientierung
Die Ausrichtung von Beratungs- und Weiterbildungssettings auf die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen unter Beachtung der spezifischen Anforderungen gründungswilliger Migrantinnen und Migranten nimmt innerhalb der Untersuchung einen zentralen Stellenwert ein. Vor diesem Hintergrund bedarf es einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit den Konzepten der Kompetenz- und Zielgruppenorientierung im Zuge der Gestaltung von Beratungs- und Weiterbildungsprozessen. In diesem Sinne sollen die dahinter liegenden Bedeutungszusammenhänge im Folgenden diskutiert und präzisiert werden, um zu einem für die vorliegende Arbeit einheitlichen Begriffsverständnis zu gelangen.
Zunächst ist voranzustellen, dass Fragen der Kompetenz- und Zielgruppenorientierung innerhalb der aktuellen erziehungswissenschaftlichen Debatte nur selten in einem Atemzug behandelt werden. Dies ist allerdings verwunderlich, da sowohl die Diskussion um die Entwicklung von Kompetenzen als leitendes Prinzip pädagogischen Handelns als auch die analytische Differenzierung von Adressaten letztlich zum Anlass genommen wird, die Gestaltung didaktischer Arrangements in den Blick zu nehmen. Insofern soll im Rahmen der Begriffsdefinition der Versuch erfolgen, beide Aspekte wieder stärker miteinander in Verbindung zu bringen.
Noch unter der Chiffre der Adressatenforschung wurde spätestens seit den 1970er-Jahren versucht, systematisch Informationen über Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Hintergründen und dem Bildungsverhalten, den Bildungsinteressen sowie den Bildungseinstellungen bestimmter Gruppen zu generieren (vgl. von Hippel/Tippelt 2009, S. 803). Dahinter verbarg sich das Ziel, dieses Wissen zur Grundlage der Programm- und Angebotsplanung zu machen, um im Ergebnis das Angebot den Voraussetzungen und Bedürfnissen potenzieller Teilnehmer anzupassen und damit zielgruppenorientierter zu gestalten (vgl. Landeck 1986, S. 35). Aus heutiger Perspektive lassen sich epochenspezifisch unterschiedliche Lesarten der Zielgruppenorientierung nachvollziehen, deren detaillierte Beschreibung für den Zweck der Arbeit allerdings nicht notwendig erscheint. Als relevante Erkenntnis aus der historischen Betrachtung soll lediglich herausgestellt werden, dass sich Zielgruppenorientierung heute im Gegensatz zu den politischen oder sozialpädagogischen Ansätzen, die vor allem durch eine sozial exkludierende „Sonderbehandlung“ Benachteiligter geleitet waren, als professionelle Empowerment-Strategie versteht (vgl. Schäffter 2014, S. 12). Zentrales Element stellt dabei die Abkehr einer normativ objektivierenden Zuschreibung personengebundener, kultureller oder gruppenspezifischer Defizitmerkmale von außen dar (vgl. ebd.). Vielmehr ist intendiert, aus einer reflexiv angelegten „Selbstartikulation“ heraus zu einer Formulierung von Lernbedürfnissen des Individuums zu gelangen, an der sich die dienstleistungsorientierte Planung des Bildungsformates orientieren kann (vgl. ebd., S. 12 f.). Als didaktische Reaktion werden Selbstlern- bzw. Selbstorganisationsmodelle favorisiert, welche die Passung zwischen Bildungsinstitution und Adressaten vor allem durch ein didaktisch reflektiertes Öffnen der Lernorganisation für eine unüberschaubare Diversität von Lernbedürfnissen herstellen (vgl. ebd., S. 52). Dabei besteht die pädagogische Dienstleistung insbesondere darin, einen offenen und didaktisch einladend strukturierten Ermöglichungsraum bereitzustellen, der die Lernenden (Adressaten) zu eigenem Tun herausfordert.
Das hier entfaltete Verständnis von Zielgruppenorientierung und den daraus abgeleiteten Konsequenzen für die Gestaltung didaktischer Settings bietet einen deutlich sichtbaren Anknüpfungspunkt zu den Grundannahmen und -prinzipien von Kompetenzorientierung. Mit dem Bewusstsein für die vielfältigen Diskussionsstränge und Interpretationen innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses folgt die vorliegende Arbeit einer Definition von Kompetenzen als geistige und physische Fähigkeiten, selbstorganisiert und kreativ in (zukunfts)offenen Problem- und Entscheidungssituationen zu handeln (vgl. Erpenbeck 2014, S. 168). Dahinter verbirgt sich nicht weniger als ein Paradigmenwechsel im Bildungswesen, im Zuge dessen die curricularen Input- und Interventionshoffnungen als Gestaltungsgrundlage von mechanistisch-linear gedachten pädagogischen Interventionen zugunsten einer Orientierung an Outcomes von Lehr-Lernprozessen ad acta gelegt werden (vgl. Arnold 2014, S. 16 f.). Vor diesem Hintergrund rücken die Subjekte als Verantwortungsträger ihrer eigenen Lernhandlungen wieder stärker in den Fokus didaktischer Überlegungen. Ausgangspunkt dessen ist die lerntheoretisch begründete Annahme, dass „sich Menschen nur zu ihren eigenen Konditionen Neues aneignen und neue Kompetenzen entwickeln können“ (Arnold 2012a, S. 1). Dieser Auslegung folgend besteht die Herausforderung für die Gestaltung kompetenzorientierter Lernarrangements darin, selbstorganisiertes und -gesteuertes Lernen zu ermöglichen und wirkungsvoll zu unterstützen (vgl. Wildt 2004, S. 23).
Aus der Zusammenführung der aufgezeigten Parallelen zwischen den Konzepten von Kompetenz- und Zielgruppenorientierung wird für die vorliegende Arbeit letztlich ein Begriffsverständnis zugrunde gelegt, welches beiden Konzepten eine nahezu identische Intention mit Blick auf die didaktische Gestaltung von Beratungs- und Weiterbildungsangeboten unterstellt. In diesem Sinne operiert die Arbeit mit den Begriffen Kompetenz- und Zielgruppenorientierung insofern synonym, als dass beide Aspekte als Achsen eines konstruktivistisch geprägten Bildungsverständnisses angesehen werden können.
3 Migrantenökonomie
3.1 Grundlegende Gedanken zur Grenzziehung
In der klassischen Entrepreneurship-Forschung wird vorwiegend den Fragen nachgegangen, welche Personen wie, warum, mit wem, wo und unter Einsatz welcher Ressourcen welche Art von Unternehmen gründen, welche Produkte oder Leistungen dabei am Markt angeboten werden und welcher geschäftliche Erfolg damit verbunden ist (vgl. Bögenhold/Fink/Kraus 2007, S. 23). Dies erfolgt i.d.R. mit einer Fokussierung auf unterschiedliche Betrachtungsebenen (z.B. globale, betriebliche oder individuelle Ebene), die allerdings häufig nicht unabhängig voneinander beleuchtet werden können. Ungeachtet dessen lässt sich m.E. behaupten, dass das wissenschaftliche Interesse vermehrt auf volks- bzw. betriebswirtschaftlichen Fragestellungen lag und liegt.
Dennoch konfigurierte sich in den letzten Jahren zunehmend eine Entrepreneurship-Forschung abseits des wirtschaftswissenschaftlichen Mainstreams. Im Zuge dessen lässt sich beobachten, dass vermehrt sozialwissenschaftliche Fragestellungen in die Diskussion einfließen, die im Kern auf der Rolle von Unternehmen in gesamtgesellschaftlichen Kontexten abzielen. Die Entrepreneurship-Forschung nimmt damit verstärkt eine interdisziplinäre Perspektive ein, die sich gleichermaßen soziologischer, psychologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Herangehensweisen bedient sowie neuen, komplexeren Problemhorizonten zuwendet (vgl. ebd., S. 23 f.).
Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der „Migrantenökonomie“ stellt einen solchen neuen Themenkomplex der Entrepreneurship-Forschung dar, der in seinem Ursprung soziologische Zusammenhänge aufzudecken versuchte. Ausgehend von einer Zunahme internationaler Mobilität als Reaktion auf eine verstärkte globale Verflechtung bzw. Interaktion von Ökonomien und Gesellschaften erweiterte sich notwendigerweise der Horizont der Migrationssoziologie u.a. hinsichtlich ökonomischer Fragen. Diesbezüglich wurden bspw. Fragen nach Formen und Strategien von Migrantinnen und Migranten zur Realisierung von Inklusionschancen in Funktionssysteme, und dabei speziell in das Funktionssystem Ökonomie, virulent (vgl. Pries 2001, S. 25).