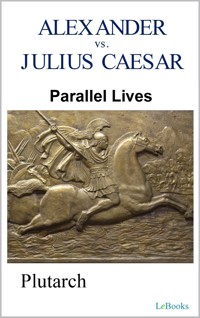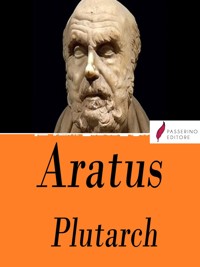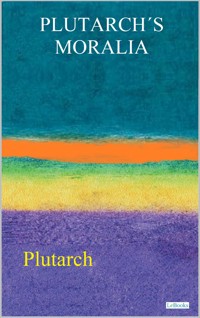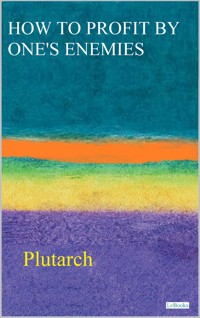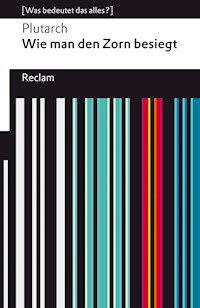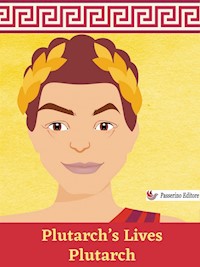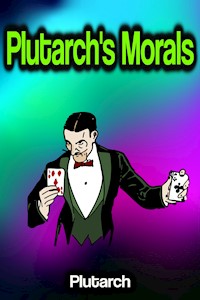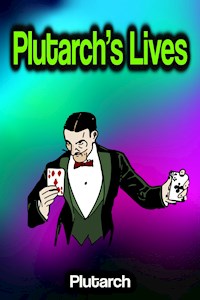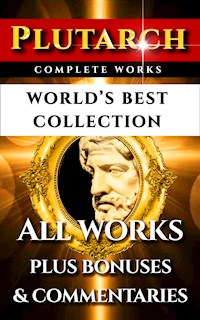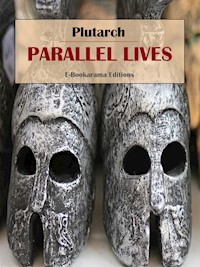5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek – [Was bedeutet das alles?]
- Sprache: Deutsch
Was ist Glück? Für Plutarch bedeutet es innere Zufriedenheit. Jeder kann sie erlangen, durch Übung, Tugend und indem er sich von Einstellungen befreit, die ihn immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen, wie Zukunftsangst, Neid oder Hab- und Besitzgier. Jeder mache das Beste aus seiner Veranlagung, sehe das Positive an seiner Situation: Suche den für dich richtigen Lebensweg – es gibt viele! Pack dich am Schopf und zieh dich aus deiner unglücklichen Situation! Dieser antike »Glückstrainer« hat nichts an Aktualität eingebüßt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Plutarch
Glücklichsein
Denkanstöße aus der Antike
Aus dem Griechischen von Marion Giebel
Reclam
2. Auflage
2018 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Der Text im Abschnitt »Von einem glücklichen Leben« wurde entnommen aus: Plutarch, Die Kunst zu leben. Ausgewählt und übersetzt von Marion Giebel. S. 13–43 [»Über die Seelenruhe«]. © Insel Verlag Frankfurt am Main 2000.
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2018
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961385-7
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019515-4
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
Alle Menschen wollen glücklich sein, doch was ist Glück, und auf welchem Weg kommt man zu einem glücklichen Leben – Fragen, die man sich schon in der Antike stellte und für die es auch heute kein neues Patentrezept zu geben scheint. Der zweite Mann auf dem Mond wurde gefragt, ob es ihn nicht wurme, dass er nicht der erste und derjenige gewesen sei, der die berühmten Worte gesprochen habe. Ja schon, meinte er, aber dann habe er sich gesagt, er wolle und werde zufrieden sein mit dem, was er erreicht habe, und es sei eben doch ein Glück, dass er dabei war. Nicht nur auf dem Mond: die eigene Einstellung ist ausschlaggebend für das Glücklichsein. So sah man es auch in der Antike. Diese Einstellung aber muss, um ein tragfähiges und dauerhaftes Fundament zu bieten, sozusagen eingeübt und beständig trainiert werden. Dabei kommt der Denkkraft eine bestimmende Rolle zu. Der umfassende Begriff ist die phrónesis: die Einsicht, das Nachdenken, Überlegen, Urteilen und Schlussfolgerungen Ziehen, was dann in entsprechendes Handeln umgesetzt wird. Phrónesis, so heißt es in den Hóroi (Definitionen), die im Anhang der Werke Platons überliefert sind, ist die Wirkkraft, die den Glückszustand des Menschen schafft, die Erkenntnis des Guten und Schlechten, eine innere Verfassung, gemäß derer wir entscheiden können, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Dies führt zum Besitz der areté, der Tugend, der sittlichen Vollkommenheit (lat. virtus), die das gute oder richtige, das gelingende Leben garantiert. Platon hat der phrónesis oder sophía, der Klugheit, den ersten Platz in seinem Tugendkanon gegeben.1 Dieser gilt für den Staat wie für den einzelnen Menschen. Hierzu gehören noch Gerechtigkeit (dikaiosýne), die jedem das Seine zuteilt und dadurch Eintracht schafft, sowie Mäßigung und Selbstbeherrschung (sophrosýne), durch die man die Triebe und Begierden beherrscht und damit ein Gleichgewicht in der Seele bewirkt. Dann die Tapferkeit (andreía), die nicht nur in Kampf und Krieg gefragt ist, sondern auch der Seele Kraft verleiht gegen alles Furcht- und Schreckenerregende.
Wenn die Tugend so eng mit den Verstandeskräften verbunden ist, bedeutet dies dann, dass es ein Tugendwissen gibt? Ist die areté also eine téchne, eine Kunst, die man beherrschen kann, wie etwa die Bildhauerei – muss sie dann nicht auch lehrbar sein? Eine schwierige Frage, auf die es unterschiedliche Antworten gab. In Platons Dialog Menon kommen Sokrates und sein Gesprächspartner zu der Ansicht, die Tugend sei nicht lehrbar. Es gibt keine geeigneten Lehrer – die Sophisten, wie ein Protagoras, die alles und jedes lehren wollen, zählen ja nicht. Und vorbildliche Bürger wie Themistokles, Aristides und Perikles haben ihre Söhne, denen sie doch die beste Erziehung zukommen lassen wollten, die Tugend nicht gelehrt oder konnten es nicht. Auch von Natur aus können Menschen nicht tugendhaft sein, sonst würde man dies schon im Kindesalter erkennen. Wie kommt es also, dass es tugendhafte Menschen gibt, wenn sie weder durch die Natur noch durch Unterricht hervorgebracht werden können? Sokrates meint schließlich, es sei eine Gabe der Götter, wie bei Propheten und Sehern. Obwohl ein Dialog des Sokratesschülers Aischines fast gleichlautend dasselbe behauptet, konnte diese vage Antwort nicht befriedigen. Xenophon, auch er ein Schüler des Sokrates, ist jedoch von der Möglichkeit und Notwendigkeit einer Erziehung (paideía) überzeugt. Aristoteles meinte, die Tugend werde nicht primär durch Einsicht, sondern durch Gewöhnung erworben. Gewöhnung – dann muss es aber jemand geben, der weiß, an was man gewöhnt werden soll, also Erziehung: und das bedeutet, dass die Tugend doch lehrbar ist.
So sah es Plutarch, Philosoph und Schriftsteller, der an der platonischen Akademie in Athen studiert hatte, von dort aber vor allem den Satz des Sokrates mitgenommen hatte, man müsse sich um die Seele sorgen, dass sie möglichst gut sei. Und nicht nur um seine eigene, wohlgemerkt. Er sah die Philosophie als eine Lebens-Kunst an, die durch steten Appell an die Verstandeskräfte zu einem gelingenden Leben verhelfen könne. Und dazu sah er sich berufen, nach Kräften beizutragen, gewissermaßen als ein Seelentherapeut.
Plutarch, geboren in der römischen Kaiserzeit (um 46–125 n. Chr.), stammte aus Chaironeia im griechischen Böotien, wo er das heute noch dort stehende Löwendenkmal sehen konnte, errichtet 338 v. Chr. nach dem Sieg von Philipp II. von Makedonien, dem Vater Alexanders des Großen, über die Griechen. Es war das Ende der politischen Autonomie der griechischen Stadtstaaten, jedoch nicht das Ende der kulturellen Hegemonie von Hellas. Die Nachfolgestaaten der Makedonen wie auch die Römer schätzten die paideía, die griechische Bildung, Kunst und Kultur, und machten sie sich – man denke an Cicero – weitgehend zu eigen. Griechen kamen nach Rom und dienten als Vermittler. Als ein solcher »Kulturbotschafter« wirkte Plutarch. Er hatte Ämter im Gemeinderat seiner Heimatstadt inne, war Oberpriester des Apollon von Delphi und hielt sich mehrfach in Rom auf, wo er durch seine Lesungen und Vorträge aus dem Gebiet der Wissenschaft und Philosophie Freunde gewann, wie Kaiser Vespasians Freund Mestrius Florus, der Plutarch das römische Bürgerrecht verschaffte. Sosius Senecio, der Vertraute Kaiser Trajans, vermittelte ihm dessen Freundschaft, und Plutarch widmete dem Kaiser eine seiner Schriften. Er betrieb eingehende Studien in den römischen Bibliotheken, so dass er die Römer belehren konnte, woher manche ihrer alten Bräuche stammten oder wer welche klugen Aussprüche getan habe. Dennoch wollte er nicht in Rom bleiben, sondern kehrte ins beschauliche Chaironeia zurück. Auf die Frage, warum er in dieser kleinen Stadt wohnen bleibe, hatte er entgegnet: »Ja damit sie nicht noch kleiner werde!« (Leben des Demosthenes2,2). Hier sammelte er in einer »Privatakademie« interessierte Männer und Frauen um sich, darunter viele junge Leute, mit denen er in Vorträgen, Lesungen und Diskussionen vielfältige Fragen aus verschiedenen Wissensbereichen erörterte. Die häufig gewählte Form des Dialogs erlaubte es Plutarch, mehrere Ansichten zur Diskussion zu stellen. Die Früchte seiner Tätigkeit hat er schriftlich niedergelegt. Daraus entstand die reiche Sammlung von Schriften, die später den Titel Moralia erhielt, was freilich nicht auf Moralpredigten hinweist, sondern darauf, dass es hier um die mores, die Sitten und Eigenarten der Menschen im weitesten Sinne geht, die aus ganz persönlicher Sicht betrachtet werden. Man hat die Moralia treffend Essays genannt, in Anlehnung an Montaigne, der Plutarch sehr schätzte und wie dieser Lebenskunst und Lebensweisheit vermitteln wollte.
Ein spätantiker Werkkatalog nennt über 200 Titel, neben den Schriften der Moralia auch Plutarchs berühmtestes Werk, die Parallelbiografien jeweils eines bekannten Griechen und eines Römers, wie Alexander und Caesar. Durch diese Gegenüberstellung wollte Plutarch auch immer noch bestehenden Ressentiments auf römischer Seite begegnen: Man kannte die Griechen als wortgewandte Redner und Wissenschaftler, doch in der Staatskunst hatten sie sich den Römern geschlagen geben müssen. Plutarch zeigt nun, dass auch Griechenland Staatsmänner hervorgebracht hatte, etwa einen Perikles; er zeigt freilich auch, dass auf beiden Seiten Licht und Schatten zu finden war.
Erhalten sind von den Moralia etwa 80 Titel. Es gibt Themen aus der Naturwissenschaft, etwa zu der Frage, wie das Gesicht im Mond entsteht, über Literatur, über philologisch-philosophische Fragen wie zu den Werken Platons, theologische Schriften, mehrere über das Orakel von Delphi, über Isis und Osiris, an eine Priesterin gerichtet, über die späte Strafe der Gottheit, das Theodizee-Problem behandelnd. Dann politische Abhandlungen, außerdem Streitschriften wie gegen die Epikureer und deren Wahlspruch Láthe biósas – »Lebe im Verborgenen«, was Plutarch ablehnt. Er spricht sich für eine Beteiligung am Staatswesen aus, die unter den Römern im Bereich der griechischen Stadtverwaltungen durchaus noch möglich, ja erwünscht war. Auch gegen die Stoiker wendet er sich, wegen ihrer oft allzu spitzfindigen Definitionen, wobei er ihre Ethik durchaus anerkennt und in manchem befürwortet. Seine farbige, anekdotenreiche Darstellung findet sich unter anderem in seinem Gastmahl der Sieben Weisen, zu dem sich der Leser eingeladen fühlen kann.
Anerkennung in jüngster Zeit hat Plutarch für seine humanen Ansichten erhalten, ob es um Frauen, Kinder oder auch Tiere geht. Ehe und Familie gehören zu seinen wichtigsten Themen. In seinem Dialog Erotikós – Über die Liebe wertet er die traditionellen Ansichten über die Liebe, die Frauen und die Ehe nachdrücklich ab, »eines der glühendsten Plädoyers für eheliche Zuneigung« (Michel Foucault). Die vielgepriesene Homoerotik – man denke an Platons Gastmahl – muss ihm zufolge hinter einer Partnerschaft von Mann und Frau zurückstehen, die durchaus zu einer leibseelischen Gemeinschaft in einem lebenslangen erfüllten Miteinander werden kann. Die Ehe ist keine bloße Zweckgemeinschaft zur Kindererzeugung, und die Frau ist durchaus fähig zur areté, zur sittlichen Vervollkommnung.
Die praktische Umsetzung dieser Gedanken über die Ehe und das Verhältnis der Geschlechter bietet Plutarch in einem Lehrbrief an ein jungverheiratetes Paar (Ratschläge für die Ehe). Beide sind seine Schüler, was beweist, dass bei ihm die Gleichberechtigung der Geschlechter gilt. Bei den jungen Eheleuten soll alles zur Einheit werden: Der Mann darf keine Vorrangstellung in Anspruch nehmen, die Frau sich nicht auf ihre vornehme Herkunft oder ihre reiche Mitgift berufen. Austausch im Gespräch, Übereinstimmung in Fragen des Alltags, vertrautes Beisammensein, nicht zu vergessen gute Laune und Freundlichkeit sollen ihr Eheleben prägen. Und die junge Ehefrau soll daran denken, was sie bei ihm, ihrem Lehrer, gelernt hat. Sie kann sich durchaus mit ihrem Mann zusammen weiterhin mit Philosophie beschäftigen, wie das andere Frauen, wie die als Philosophin bekannte Theano, getan haben. Das wird ihr Schmuck sein, wertvoller als Perlen. Ein solches Einvernehmen herrschte offenbar in Plutarchs eigener Ehe, wie der Trostbrief an seine Gattin Timoxena zeigt, den er ihr nach dem Tod ihres gleichnamigen kleinen Töchterchens schreibt. In dem innigen Zusammengehörigkeitsgefühl und der Wertschätzung für die Gattin wie für das kleine Mädchen bietet der Brief ein einzigartiges Zeugnis eines Gefühlslebens in der Römerzeit. Es erscheint durchaus naheliegend, dass der liebevolle Vater der kleinen Timoxena, der seine Frau daran erinnert, wie sie mehrere Kinder gemeinsam großgezogen haben, auch eine Schrift über Kindererziehung verfasst hat. Als einzige erhaltene griechische Schrift über dieses Thema (im Römischen ist Quintilian zu nennen) hat sie als ein »güldnes Büchlein« große Wirkung auf die Nachwelt gehabt. Seit den ersten gedruckten Ausgaben der Moralia ist sie noch heute die Nr. 1