
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Chi sieht aus wie ein Kind. Blass und schmal. Die Züge so bleich. Die Haut zart und durchscheinend. Lange Wimpern an den Lidern der mandelförmigen Augen. Fast echt. Denn Chi ist ein Roboter, an dessen Programmierung die 19jährige Celine während ihres Praktikums am Institut für neuronale Informatik mitarbeiten soll. Obwohl Celine weiß, dass Chi nur eine Maschine ist, baut sie eine Beziehung zu ihr auf. Aber als es zu ungeklärten Todesfällen am Institut kommt, ist klar, dass das Projekt gestoppt werden muss. Ein atmosphärischer Thriller über künstliche Intelligenz, computerdatenbasierte Zukunftsprognosen versehen mit einem Schuss Westworld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Widmung
Gedankengewitter
Kapitel 1 – Meine Geschichte beginnt …
Kapitel 2 – Ich schiebe mein …
Kapitel 3 – Ich starre auf …
Kapitel 4 – Wir sollten nie …
Kapitel 5 – Wir gehen einen …
Kapitel 6 – Ich lasse den …
Kapitel 7 – Später würde ich …
Kapitel 8 – »Hi Pandora!«, sagt …
Kapitel 9 – »Was ist das?« …
Kapitel 10 – Ich arbeite viel …
Kapitel 11 – So arbeite ich …
Kapitel 12 – Ein paar Tage …
Kapitel 13 – Du hast keine …
Kapitel 14 – Ich habe es …
Kapitel 15 – Ich sehe mich …
Kapitel 16 – Der Zug hat …
Kapitel 17 – »Warum hast du …
Kapitel 18 – Wenig später sitzen …
Kapitel 19 – Er muss hier …
Kapitel 20 – Irgendwie bringe ich …
Kapitel 21 – Eric – ist …
Kapitel 22 – Sein Bruder! Ich …
Kapitel 23 – Kairos verschwindet in …
Kapitel 24 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 25 – Jemand steht neben …
Kapitel 26 – »Wie kannst du …
Kapitel 27 – Kim ist gegangen. …
Kapitel 28 – Später kauere ich …
Kapitel 29 – Ich sehe über …
Kapitel 30 – Als wir ankommen, …
Kapitel 31 – Vor uns steht …
Kapitel 32 – Sie sieht genauso …
Kapitel 33 – Da geschieht etwas …
Kapitel 34 – Habe ich sie …
Pandora
Dank
Bisher von Margit Ruile im Loewe Verlag erschienen
Über die Autorin
Weitere Infos
Impressum
GEDANKENGEWITTER
Ich sage es gleich vorneweg. Ich kann in die Zukunft sehen. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr das nicht glaubt. Ich glaube mir ja selbst kaum. Das heißt – ich habe mir lange Zeit verboten, daran zu glauben, denn es erschien mir immer zu abseitig und zu verrückt, als dass es wahr sein könnte. Trotzdem habe ich dem, was ich kann, einen Namen gegeben. So als könnte ich es mit einem Namen zähmen und in Schach halten. Ich nenne es »die Gabe«. Die Gabe – so wie »das Geschenk«. Ja, es ist so etwas wie ein Geschenk. Allerdings eines, das mich nicht glücklich gemacht hat und das ich nicht zurückgeben kann, auch wenn ich mir das immer gewünscht habe.
Als ich Kind war, hatte ich einen anderen Namen dafür. Einen, der viel greifbarer ist und es vielleicht besser beschreibt. Ich nannte es »Gedankengewitter« und meinte damit diese Bilder, die aus dem Nichts kommen und in meinem Kopf leuchten wie eine Kaskade von grell aufzuckenden Blitzen. Sie überfallen mich, seit ich denken kann. Ich kann mich nicht an eine Zeit ohne sie erinnern. Sie waren einfach schon immer da. Daher dachte ich erst, dass jeder sie hätte, dass sie etwas ganz Selbstverständliches wären und dass alle anderen auch von ihnen geflutet würden. »Kennt ihr das auch?«, fragte ich. »Du siehst jemanden die Treppe hinunterstürzen und gleich darauf passiert es wirklich. Du weißt, dass das Fenster aufspringen wird und die Katze hereinkommt. Du weißt, dass Lilly gleich vom Stuhl fallen und den Arm in einer Schlinge tragen wird? Kennt ihr das auch?« Aber statt Zustimmung zu ernten, blickte ich nur in erstaunte Gesichter. Keiner außer mir sah solche Bilder. Niemand konnte das, was ich konnte. Und so hörte ich auf zu fragen. Denn jede meiner Fragen zog diesen speziellen Blick nach sich. Unglauben war darin, Verwirrung, aber auch Angst. Ich spürte, wie die anderen vor mir zurückwichen, und es tat mir weh. Oh, ich wollte nicht, dass man mich so ansah! Ich wollte nicht, dass man über mich tuschelte und mich für verrückt hielt. Ich wollte nicht Gegenstand von Spekulationen sein. Ich wollte genau so sein wie alle anderen.
Tief in mir spürte ich aber, dass ich nie so sein würde. Denn da war die Gabe, die mich von den anderen trennte und einsam machte. Wem sollte ich von dem Gewitter erzählen? Wer sollte diese Bilder verstehen? Ich hatte noch niemanden getroffen, der so war wie ich, und daher fühlte ich mich auf eine seltsame Art heimatlos, obwohl ich damals noch ein Zuhause hatte.
So lernte ich, das, was ich sah, für mich zu behalten. Und schließlich gelang es mir, die Bilder nicht nur vor den anderen zu verbergen, sondern sogar vor mir selbst so zu tun, als würde es sie gar nicht geben. Ich beschloss, sie zu ignorieren, und hoffte, sie so aus meinem Leben zu verbannen.
Eine Zeit lang schien das ganz gut zu funktionieren, denn je älter ich wurde, desto mehr Zeit verging zwischen den Gedankengewittern. Manchmal ließ mich die Gabe sogar monatelang in Ruhe und wiegte mich in der trügerischen Sicherheit, sie wäre für immer aus meinem Leben verschwunden. Doch sie kam wieder. Dabei zeigte sie sich ganz unterschiedlich. Oft war es nur ein kleines Aufblitzen. Ein Bild, das in hoher Geschwindigkeit durch meinen Kopf zog, wie ein Luftzug, kaum festzuhalten, eine flüchtige Erinnerung an das, was sein wird. Ich holte das Essen in einer Kantine und sah, wie hinter mir der Mann gleich sein Tablett fallen lassen würde. Ich sah eine alte Frau im Park und wusste, dass sie gleich einen Fahrradfahrer mit dem Stock bedrohen würde. Die Bilder schossen mir durch den Kopf, sie waren nichts Besonderes, keine spektakulären Ereignisse, nur winzige Risse in der Zeit, durch die ich schauen konnte.
Manchmal entfaltete sich aber auch eine ganze Szene. Ich hörte, was die Menschen sprachen, und fühlte ihre Gefühle, so als würde ich im Kino sitzen und mir einen Film ansehen.
Ich verstand nie, warum sich die Gabe einmal so beiläufig zeigte und ein andermal so bedeutsam. Irgendwann glaubte ich, dass es vielleicht gar nichts mit mir zu tun hatte und dass ich nur ein Medium war. Wie eine Hülle, durch die irgendeine unverständliche Naturkraft floss – mal stärker, mal schwächer, gerade wie es ihr beliebte. Diese Kraft spielte mit mir. Ich konnte mir die Bilder weder herbeiwünschen noch darum bitten, dass sie verschwanden. Es gab nichts, womit ich diese Kraft steuern konnte. Ich war ihr einfach ausgeliefert. Alles, was ich konnte, war warten, bis das Gewitter vorbeiziehen würde, und versuchen, die Bilder, die ich von der Zukunft sah, zu verstehen. Ich wusste, dass ich das Puzzlestück der Zeit, das mir gezeigt wurde, erst später würde einordnen können. In der Zwischenzeit blieb es in meinem Kopf wie ein großes Fragezeichen.
Jetzt befinde ich mich in einer Gegenwart, von der ich Teile gesehen habe, als wäre ich durch einen langen Flur mit vielen Türen gelaufen. Diese Teile befanden sich dort hinter den verschlossenen Türen, von denen ich manche öffnen konnte. Nur für einen Spalt und einen kurzen heimlichen Blick. Dass ich jetzt hier in diesem Zug sitzen würde, habe ich nicht gesehen. Ich sah keine Solarzellen auf den Feldern, keinen Schornstein in der Ferne, keinen dünnen aufsteigenden Rauch, der mich an ein Zeichen erinnert. Ein Signal. Ein geheimes Zeichen. Von jemandem abgeschickt. Für die bestimmt, die es lesen können. So, wie ich einmal ein Zeichen bekam. Ein paar Striche, die alles veränderten.
Das Wasser sammelt sich auf der Scheibe, die Tropfen flitzen mit dem Fahrtwind, draußen ducken sich Bäume unter dem Regen und die Felder leuchten gelb. Ich halte diese Bilder fest und setze sie ein in das große Puzzle. Die Zeit ist nicht linear. Sie ist überall verteilt. Ein Zeitfetzen hier, einer da. Zusammen werden sie einmal ein ganzes Bild ergeben.
Wie soll ich euch das Bild beschreiben? Es gibt keinen Anfang, es gibt nur einen Punkt in der Zeit, den ich vor meinen Augen entstehen lassen kann. Also bitte ich euch, mir zu folgen, und lasse den schmalen Pfad der Gegenwart mit den pfeilschnellen Regentropfen und den Solarzellen hinter mir – und erinnere mich.
1
Meine Geschichte beginnt vor genau einem Jahr. Genauer gesagt an einem heißen Donnerstag im August, in der ersten Woche der Semesterferien. An diesem Tag hatte ich zum ersten Mal seit Langem wieder eine Vision. Sie kam mit ungewöhnlicher Heftigkeit und zeigte mir etwas, das ich nie hätte sehen wollen. Ich hatte keine Ahnung, dass die Gabe ausgerechnet an diesem Tag wiederkommen würde. Nichts deutete darauf hin. Wobei … Ich erinnere mich an ein Flimmern vor den Augen, kurz nach dem Aufstehen. Dieses Flimmern rief einen kurzen Schreck in mir hervor, ein leichtes Zusammenzucken und eine Ahnung, dass der Tag nicht so ruhig und still enden würde, wie er begann. Doch ich schluckte dieses plötzliche Unbehagen hinunter, versuchte, es zu vergessen, und schob die schillernden Dreiecke, die kurz vor meinen Augen aufzuckten, auf die Hitze und die Schwüle, die schon am Morgen dieses Tages herrschten.
Ich wohnte in einem der Studentenbungalows im olympischen Dorf. Stellt euch diesen Bungalow vor wie eine hochkant aufgestellte Garage, vorne mit einer Tür und einem großen Fenster, innen mit einer Treppe an der hinteren Wand und einer eingebauten Nasszelle. Zwölf Quadratmeter fanden so auf zwei Stockwerken Platz. Oben gab es sogar einen Balkon. Die Bungalows drängten sich zusammen wie zu klein geratene Reihenhäuser. Sie waren meist bunt angemalt – die Farben dafür bekam man vom Studentenwerk – und bildeten enge Gassen. Diese Gassen waren eigentlich das Einzige, was im olympischen Dorf an ein Dorf erinnerte. Ansonsten war es eine Ansammlung von Betonbauten, begrenzt durch die beiden Stadtringe und die Lerchenauer Straße, breite mehrspurige Verkehrsschneisen, die man durch die Stadt gefräst hatte. Während der Olympiade 1972 hatten hier die Sportler gewohnt. Heute leben Studenten in dem großen Hochhaus vor dem Parkplatz und in den kleinen würfelförmigen Bungalows. Deshalb hatte es auch mich dorthin verschlagen. Ich hatte ein Studium begonnen – Psychologie – und hier einen der begehrten Bungalows ergattert in der Hoffnung, dort endlich ein Zuhause zu finden. Ja, das hoffte ich und zugleich hatte ich Angst, dass mir das nicht gelingen würde. Ich hatte es vorher auch nirgendwo geschafft, für viele Jahre kein Zuhause gehabt. Missversteht mich nicht! Das bedeutet nicht, dass ich auf der Straße leben musste. Ich bin nicht arm. Schließlich habe ich geerbt und immer ein Dach über dem Kopf besessen. Meistens sogar ein eigenes Zimmer und Menschen, die sich um mich kümmerten. Aber ein Dach über dem Kopf ist nicht das Gleiche wie ein Zuhause. Wahrscheinlich muss ich auch davon erzählen, wenn ich will, dass diese Geschichte vollständig ist. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das kann. Aber gut, ich werde es zumindest versuchen.
Stellt euch also das olympische Dorf im Hochsommer vor: Die Hochhäuser werfen scharfkantige Schatten. Dächer flimmern in der Hitze, Autos reflektieren die Sonnenstrahlen wie flitzende kleine Spiegel. Seht ihr mich? Dort! Ich komme gerade aus dem Supermarkt und sperre mein Fahrrad auf. Ja, das bin ich! Das Mädchen mit den schwarzen, langen Haaren und dem gelben Kleid mit den bunten Blumen. Ein Farbfleck zwischen den Hochhäusern, direkt unter dem dicken gelben Rohr, das sich durch das Dorf zieht und die Verbindung zwischen den Völkern symbolisieren soll. Da bin ich. Jetzt schiebe ich mein Fahrrad durch die menschenleere Ladenzeile. Zwei Tüten voll mit Lebensmitteln hängen links und rechts am Lenker und schlackern gegen den Vorderreifen. Als ich unter dem Dach hervorkomme, suche ich den Schatten der Hochhäuser. Ich mag es nicht, wenn die Sonne mir ungeschützt auf den Kopf brennt. Es ist kurz vor Mittag und unerträglich heiß. Ich bin auf dem Weg zurück in meine stille Gasse. Ich nehme an, ich bin die Einzige, die noch dort wohnt, denn es ist der Beginn der Semesterferien und alle anderen sind nach Hause oder in den Urlaub gefahren. Aber – ich bin nicht allein, denn hinter mir höre ich eine Stimme. Jemand ruft meinen Namen.
»Celine?«
Ich drehe mich um und starre in ein breites, von einem Bart umrahmtes Gesicht.
»Robert?«
Er bewohnt den Bungalow mir gegenüber und war der Erste, dem ich begegnet bin, als ich vor zwei Monaten einzog, mit einer Tasche auf dem Radlenker und dem zusammengerollten Teppich auf dem Gepäckträger. Mehr besaß ich nicht. Ein paar Kleidungsstücke, einen Computer, einen Teppich mit dem Muster, das an den Rändern ins Unendliche geht. Robert hat mir geholfen, die Sachen in meinen Bungalow zu bringen.
»Du bist noch da?«, fragt mich Robert. Er sieht mich neugierig an.
»Ja, ich kann nicht weg. Ich muss noch eine Seminararbeit schreiben«, sage ich. Nun, das stimmt nur zum Teil. Es ist nicht das, was mich hier hält.
»Über was?«
Ich muss lachen. »Ich glaube nicht, dass dich das interessiert.«
»Sag schon!«
»Facetten der Wirklichkeitswahrnehmung.«
»Aha – klingt interessant!« Er grinst.
»Du machst Witze.«
»Nein, ehrlich nicht.«
»Okay.«
»Und dann? Fährst du gar nicht nach Hause?«
»Mhmm«, sage ich. Es könnte alles heißen. Zustimmung oder Zeichen für Unentschlossenheit. Ich will ihm nicht sagen, dass ich nirgendwohin fahren kann. Dieser Bungalow, in dem ich jetzt wohne, ist mein Zuhause.
»Und du?«, frage ich schließlich.
»In zwei Wochen bin ich auch weg.«
»Dann ist wenigstens jetzt noch jemand da«, sage ich erleichtert. »Ich hatte schon Angst, allein in der Gasse zu sein.«
»Ich auch«, sagt Robert und lächelt mich an.
»Fährst du in die Stadt?«, frage ich und sehe auf sein Fahrrad, das er in seiner rechten Hand hält. Ein weißes Rennrad. Schmale Reifen. Der Lenker gebogen wie Stierhörner, mit einem weißen Band umwickelt. Hinten auf den Gepäckträger hat er ein Handtuch geklemmt. Es ist das Erste, was ich jeden Morgen sehe, wenn ich aus dem Fenster blicke. Roberts Rennrad. Ich weiß, er hat es selbst aus Einzelteilen zusammengebaut. Er hat mir das ganz stolz erzählt, als er mein Fahrrad reparierte, das plötzlich nicht mehr fuhr.
»Runter zum Eisbach. Willst du mitkommen?« Er sieht so aus, als würde er sich freuen, wenn ich Ja sagte.
»Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich heute noch die Einleitung hinbekommen.«
»Bei der Hitze?«
Ich zucke mit den Schultern. »Sonst habe ich so ein schlechtes Gewissen. Und vor allem Angst, dass ich nicht fertig werde. Fährst du morgen auch?«
»Denke schon.«
»Dann komme ich vielleicht morgen mit. Heute wird es sowieso regnen.«
»Es wird regnen?« Er sieht nach oben und lacht. »Keine Wolke am Himmel.«
Ich lege meinen Kopf in den Nacken. Er hat recht. Der Himmel ist blitzblank, ein strahlendes, überirdisches Blau, das schon fast einen leichten Lilaschimmer hat.
»Wie kommst du denn darauf?«, fragt er amüsiert.
»Ich weiß nicht«, sage ich leise. Meine Kopfhaut kribbelt leicht. Hoch über mir fliegt ein Falke. War er vorher auch schon da? Komisch. Ich kenne diesen Falken. Werde ihn gekannt haben. Mit dem Falken kommen die Wolken. Der Wind treibt sie vor sich her.
»Es gibt ein Gewitter«, sage ich. »Ziemlich bald.«
Robert sieht mich von der Seite an.
»Wenn du das sagst …«
Er glaubt mir nicht.
»Dann kommst du einfach morgen mit. Wenn du die Einleitung fertig hast.«
Er sieht mich erwartungsvoll an. Wieso ist er so weit weg?
»Ja«, sage ich. »Ja, okay.« Meine Stimme klingt seltsam fremd. Die Kopfhaut kribbelt und zieht sich in der Hitze zusammen. Spitze Nadelstiche, die weißen scharfen Punkte vor den Augen. Ein Frösteln trotz all der Hitze um mich herum. Der Falke über mir, er rüttelt mit den Flügeln, steht senkrecht in der Luft. Er hat gefunden, was er suchte.
»Celine, ist alles okay?« Roberts Stimme dringt aus der Ferne zu mir.
Ein leichter Wind kommt auf und fährt mir durch die Haare. Ich muss sie mir aus dem Gesicht streichen. Roberts Rad. Es ist etwas mit seinem Rad. Ich muss mich erinnern. Es ist wichtig! Diese Speichen. Sie fangen an, sich zu drehen. Ist das der Wind? Er rauscht in meinen Ohren. Ich starre auf meine Hände, die das Lenkrad umgreifen. Wieso habe ich Haare auf dem Handrücken? Es muss geregnet haben. Ich bin durchnässt, das rote T-Shirt klebt an meinem Körper. Wind um mich herum. Alles ist dunkel, dann kommen mir Lichter entgegen. Ich bin in einem Tunnel. Unter mir bewege ich kräftige braun gebrannte Beine, die in die Pedale treten. Es sind meine Beine. Ich bin nicht Celine; wer bin ich dann? Ich habe mehr Muskeln, anderes Blut. Ich bin wach und kräftig, schneller als die anderen, was mir eine gewisse Befriedigung verschafft. Es geht bergab, ich lasse das Rad auslaufen, ein Surren der Gangschaltung, die weißen Randstreifen verschwimmen zu einem einzigen, fließenden Band. Schnell und schneller, ein Lastzug neben mir. Die Reifen des Lasters sind fast so groß wie ich. Ich fahre rechts an ihm vorbei. Unter mir glänzt es. Wie kann es im Tunnel regnen? Der Lenker gleitet mir aus der Hand. Glänzendes Licht auf dem Asphalt. Blau. Ein verbogenes Fahrrad. Die Speichen eingeknickt. Ein Rad dreht sich noch. Klick-klick-klick.
»Celine?« Ich sehe Robert wie durch ein umgedrehtes Fernrohr. »Celine?«, fragt er noch mal.
Ich lehne mich seitlich an das Geländer und versuche, die Bilder abzuschütteln. Sie fliegen in meinen Kopf, schnelle Bilder, die mich schwindelig machen, Lichter, Tunnel, Radspeichen. Es fühlt sich an wie ein Traum. Es fühlt sich immer an wie ein Traum.
»Hey, Celine, was ist los?«
Ich starre ihn an. Er hat seine Hand auf meinen Arm gelegt. Ich schlucke. Mir ist kalt und heiß zugleich. Dreiecke flimmern in meinem Kopf.
»Nicht durch die Unterführung! Fahr nicht durch die Unterführung!« Bin das ich, die spricht? Sind das meine Worte?
»Hey, setz dich hin, komm schon!«
Ich lasse das Fahrrad mit den Einkäufen stehen und setze mich auf die Treppe, die von der Ladenzeile zum Vorplatz führt. Ich hasse mich. Verflucht. Wann hatte ich es zum letzten Mal?
»Hier, trink was!« Robert hat sich neben mich gesetzt. Seine Stimme ist so weit weg, als käme sie durch eine Röhre. Er hält mir eine große Plastikflasche mit Wasser hin. Sie ist eiskalt. Ich setze sie an und trinke. Kaltes Wasser rinnt mir durch die Kehle. Es tut gut. Mein Kleid klebt mir am Rücken.
Es ist nicht real. Es ist nicht real.
»Soll ich dich nach Hause bringen?«
Ich sehe in sein erschrockenes Gesicht. Mein Herz klopft schnell und ich nehme seine Hand.
»Du wirst einen Unfall haben«, sage ich leise. Meine Wangen sind nass. Es müssen Tränen sein. Sie laufen mir über die Wangen.
Er wird dir nicht glauben. Keiner tut das.
»Bitte! Es wird regnen, du wirst die rechte Spur hinunterfahren und ein Laster wird von der Seite kreuzen. Es gibt da eine glänzende Fläche, eine Ölspur vielleicht, und du wirst … Dein Rad wird komplett zerquetscht sein.«
»Okay«, sagt er langsam und zieht vorsichtig die Hand zurück.
»Was mit dir sein wird, weiß ich nicht«, sage ich. »Aber … da war Blaulicht …«
»Ich wollte wirklich durch die Unterführung fahren«, sagt Robert. Er kratzt sich am Kopf. »Aber … ich meine … woher willst du das alles wissen?«
»Ich habe es gesehen«, sage ich leise.
»Wann?«
»Jetzt.«
»Jetzt? Du meinst jetzt gerade?«
Ich nicke.
Er atmet einmal tief durch. »Du willst sagen, du kannst irgendwie Dinge sehen, die passieren werden?«
Ich kann ihm nicht in die Augen schauen.
»Ja … Nein. Manchmal. Ich kann es nicht steuern.«
»Echt jetzt?«
Ich spüre, dass ich rot werde. »Es ist mir schon lange nicht mehr passiert.«
Robert fährt sich über den Kopf. »Also, na ja … das klingt ziemlich verrückt.«
Ich sage nichts, sondern sehe auf den Boden, auf meine Füße in den Sandalen. »Ich weiß.«
»Und du glaubst das, was du da siehst? Also ich meine, du hältst das für real?«
»Ja.« Ich muss mich räuspern. »Ich hatte das schon öfter.«
»Mhmm.« Er rückt ein bisschen von mir weg. Ein paar Millimeter, unmerklich, aber ich spüre es.
»Du musst mir glauben, bitte!«, sage ich.
»Das ist jetzt nicht einfach.«
»Ich habe eine Vision und dann passiert es wirklich«, flüstere ich. »Und zwar genauso, wie ich es gesehen habe.«
»Und du bringst da nicht einfach etwas durcheinander?«
»Das habe ich auch immer gedacht. Aber es ist nicht so. Es wird passieren! Es ist alles in meinem Kopf, verstehst du? Die Gegenwart und die Zukunft.«
Wir schweigen eine Weile, dann sieht er mich an »Weißt du, ich hätte dich gar nicht so eingeschätzt.«
»Wie eingeschätzt?«
Er fährt sich über die Haare. »Dass du dich mit so was beschäftigst.«
Ich merke, dass eine leise unnachgiebige Wut in mir hochsteigt. Er nimmt mich nicht ernst. Warum sollte er auch?
»Ich beschäftige mich nicht mit so was. Es kommt einfach, verstehst du? Ich kann nichts dafür. Es wäre mir auch lieber, wenn es nicht da wäre.«
»Puh. Okay.« Er weiß nicht, was er darauf sagen soll, und versucht, sich aus Verlegenheit an einem Lachen. »Tut mir leid. Weißt du, ich verstehe nur etwas davon, wie man Maschinen repariert. Ich studiere nicht Psychologie oder so was. Ich glaube, ich kann dir da nicht helfen.«
Ich schüttle den Kopf. »Du musst mir nicht helfen, ehrlich. Du musst mir nur glauben.«
Wir sehen uns nicht an.
»Es ist einfach verdammt heiß«, sagt er schließlich.
Ich wische mir die Tränen mit dem Handrücken weg. Es schmeckt salzig.
Er steht auf, hebt sein Fahrrad vorne an, gibt dem Vorderrad einen Schubs und starrt in die sich drehenden Speichen. Wahrscheinlich will er überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Schließlich gibt er sich einen Ruck. Ich kann es sehen. Er richtet sich auf und sieht mich an. Oh, ich kenne ihn, diesen Blick, er tut so weh. Er hat Angst vor mir. Ich sehe es in seinen Augen. »Also, dir geht es wirklich gut? Soll ich vielleicht jemanden rufen?«, fragt er. »Das wäre sicher vernünftig.«
Ich schüttle den Kopf. »Nein, ich bin okay.«
»Sicher?«
»Ich bin nicht in Gefahr. Du bist es! Fahr nicht durch diese Unterführung, bitte!«
Ich kann nichts ausrichten. Was soll ich tun? Kann ich das, was ich sehe, überhaupt ändern?
»Du musst mir nicht glauben. Aber tu es einfach nicht!«
Er seufzt, steckt die Flasche in seinen Rucksack und wiegt den Kopf hin und her, als würde er mit sich selbst sprechen. Dann dreht er sich zu mir um.
»Also gut. Ich passe auf, versprochen«, sagt er. »Keine Angst!«
Ich sehe, wie seine Hände das Lenkrad umgreifen, und widerstehe einer plötzlich hochsteigenden Übelkeit.
Ich sollte ihn aufhalten. Ein Messer holen, seine Reifen zerstechen. Irgendetwas tun!
»Nimm einfach einen anderen Weg!«
Er schüttelt den Kopf und versucht sich an einem Lachen. »Mach dir keine Sorgen, ja! Ruh dich einfach aus!« Er nickt mir kurz zu, dann wendet er sein Rad und fährt schnell davon. Ich starre ihm nach, sehe, wie er in die Pedale tritt und dann hinter dem Weg neben den Bungalows verschwindet. Er hat sich nicht noch einmal umgedreht.
Es ist schrecklich, ihn wegfahren zu sehen. Es hat keinen Sinn, ihm nachzulaufen, denn er glaubt mir nicht. Er wird einfach weiterfahren. Was soll ich tun? Könnte ich die Polizei verständigen? Was soll ich ihnen sagen? »Ein Unfall wird geschehen«? Wie lächerlich! Ich wische mir die Tränen weg, dann stehe ich langsam auf.
Der Schwindel ebbt ab. Die Kopfhaut ist kribbelfrei. Alles normal, wie immer. Die Häuser werfen klare Schatten. Die Uhr, eine nüchterne Bahnhofsuhr neben der Bäckerei, zeigt halb eins. Wespen schwirren um die Theke. Die Verkäuferin sieht zu mir her. Ich wende den Blick ab und sehe an mir herunter. Ich weiß, wer ich bin, wo ich bin. Ich bin auf dem Rückweg vom Einkaufen. Es sind Semesterferien. Ich studiere Psychologie. Zweites Semester. Ich heiße Celine. Ich wohne in dem Bungalow mit der Nummer C308.
Verflucht, und ich habe diese Gabe. Sie ist wieder da.
Ich blicke hoch zum blitzblanken Himmel. Der Falke, er ist verschwunden.
Natürlich ist er verschwunden. Es gibt keinen Falken.
Von irgendwoher trifft mich ein Regentropfen.
2
Ich schiebe mein Fahrrad zurück zu meinem Bungalow und werfe dort die Lebensmittel in den Kühlschrank. Hier ist es kühl und dunkel. Nur oben dringt Licht durch das Fenster. Ich schleppe mich die Treppen in den oberen Stock hoch, lasse mich auf mein Hochbett fallen, das aus vier Brettern besteht, die auf dem Treppengeländer aufliegen und an der rückseitigen Wand befestigt sind. Die orangefarbene Matratze vom Studentenwerk riecht muffig, die Sonne scheint durch die großen Scheiben. Der Blick in die Zukunft hat mich völlig erschöpft und verängstigt, und obwohl ich noch kurz dagegen ankämpfe, falle ich ein paar Sekunden später in tiefen Schlaf.
Hier schlafe ich also, im oberen Stockwerk auf einem Hochbett. Direkt unter meinem Bett liegt die Küchenzeile, zwei Kochplatten, ein schmaler Kühlschrank und eine Spüle, unter der sich, wenn man die Türen öffnet, die blanke Erde befindet. Vor ein paar Wochen waren die Ameisen über den grauen Teppichboden gekrabbelt. Eine ganze Straße. Sie hatten weiße Flügel und schwirrten bis hinauf in mein Hochbett. Ich kaufte mir eine gelbe Dose mit Ameisengift und sie kamen nie wieder. Die Kochplatte war schon beim Einzug kaputt. Mir war nicht klar, dass man den Hausmeister anrufen konnte, der sie dann auswechseln oder reparieren würde. Ich nahm es hin, so wie ich bisher alles hingenommen hatte. Ich versuchte, mich mit allem zu arrangieren und einen Weg darum herum zu bauen. Ich konnte also in meinem Bungalow nicht kochen, fand aber eine Kaffeemaschine bei den Müllcontainern. Jemand hatte sie dort abgestellt mit einem »Zum Mitnehmen«-Schild, das ich sofort wörtlich nahm. Ich konnte mir nun Kaffee aufbrühen und sogar heißes Wasser machen, das ich ab und zu auf Instantnudeln goss und mir so eine warme Mahlzeit leistete. Die aß ich mit zwei Stäbchen, wie ich es vor langer Zeit von meiner Mutter gelernt hatte, und saß dabei unter der Treppe, die in den oberen Teil des Bungalows führte, an einem zerkratzten Holztisch, den mein Vormieter mir einfach dagelassen hatte. Es war das erste Mal, dass ich alleine wohnte. Bisher lebte ich immer mit anderen Menschen zusammen. In Heimen, in den bunten Zimmern mit den Bildern von Fuß- oder Handabdrücken, deren fröhliche Farben mir seltsam trostlos vorkamen, in Pflegefamilien, die mir fremd waren und vor denen ich früher oder später davongelaufen war, denn niemand konnte mir meine echte Familie ersetzen. Meine echte Familie. Über sie will ich jetzt nicht sprechen. Nicht jetzt. Vielleicht kann ich nie von ihr erzählen. Wir werden sehen.
Ich habe jedenfalls nie gelernt, mich einzurichten und aus einem Platz ein Zuhause zu machen, indem ich Wände strich, Bilder aufhängte, Vorhänge aussuchte, all diese Dinge, die meine Nachbarn wunderbarerweise beherrschten und die aus ihren Bungalows kleine heimelige Hütten machten. Ich nahm die Dinge, die ich fand, und stellte sie an den Platz, den man mir zugewiesen hatte. Ich beklagte mich nicht. Ich hatte nicht gelernt, mich zu beklagen. Beklagen können sich nur die, die von jemandem gehört werden.
Ein Blitz zuckt vor meinem Fenster, ich wache davon auf oder von dem dunklen Grollen, das dem Blitz folgt. Es zerreißt die Luft. Zerfetzt die Hitze.
Ich bin ganz verwirrt, denn draußen ist es bereits dunkel. War es nicht eben noch mittags? Tropfen schlagen gegen die Scheiben, ich habe vergessen, den Vorhang zuzuziehen. Draußen gluckert der Regen in den Dachrinnen und schießt durch die Fallrohre. Ich schließe das Fenster, denn es regnet durch die gekippte Scheibe direkt in mein Bett hinein. Ich sehe auf mein Handy, es ist noch in meiner Tasche. 00:03Uhr. Ich habe fast zwölf Stunden geschlafen. Mein Kopf ist schwer. Dann höre ich das Klopfen. Was ist das? Es pocht wieder – dreimal. Durch das Fenster kann ich nur auf den Balkon sehen, aber nicht vor die Tür. Ich schleiche mich die Treppe hinunter und ziehe die schwere Eisentür auf – jeder Bungalow hat dünne Betonwände und eine schwere Tür. Da ist niemand. Es muss der Regen gewesen sein oder eine Sinnestäuschung. Ein Blitz zuckt am Himmel. Ich sehe an Roberts Hausfassade gegenüber die verwaschene Snoopy-Figur. Snoopy sitzt mit einer Fliegerbrille über dem Fenster, dem außen die Konturen einer Hundehütte gegeben wurden, und tut so, als steuere er ein Flugzeug. Es ist ein vertrauter Anblick. Ich sehe ihn jeden Tag. Aber etwas fehlt. Die Mauer darunter ist leer. Roberts Fahrrad ist weg und kein Licht im Bungalow zu sehen.
Ich muss schlucken, denn langsam kommt die Erinnerung zurück. Das Fahrrad. Der Unfall. Ich habe es gesehen und habe es nicht verhindern können. Was soll ich tun?
Ein weiterer Blitz schießt vom Himmel und erleuchtet ein Gesicht direkt vor mir. Es ist hell und bleich. Die rechte Seite von mir abgewandt. Ich unterdrücke einen Schrei. Robert steht vor der Tür. Robert. War er schon immer so groß gewesen? Seine Haare und sein Bart sind durchnässt und zerzaust. Regentropfen laufen über sein Gesicht. »Hallo, Celine«, sagt er leise. Ich starre ihn an.
»Hast du geklopft?«, frage ich.
»Ja, ich bin gerade eben zurückgekommen.«
Ich zittere vor Erleichterung. Er ist kein Geist und er ist lebendig. Gott sei Dank ist nichts passiert. Es war kein Blick in die Zukunft oder eine Vision. Nur Bilder, die nichts zu sagen haben, ausgelöst durch die Hitze vielleicht oder durch die Müdigkeit.
»Ich bin so froh, dich zu sehen«, sage ich. Dabei – ich gebe es zu – geht es nur zum Teil um ihn. Ich bin auch um meinetwillen froh. Ich habe es mir nur eingebildet.
Er antwortet nicht. Seine rechte Gesichtshälfte ist seltsam dunkel. War das heute Mittag auch schon so?
»Willst du reinkommen?«, frage ich.
Er sieht mich an und schüttelt dann den Kopf. »Nein, ich … ich bleibe lieber hier draußen.«
»Aber du wirst ganz nass!«
»Das macht nichts.« Er steht vor mir und starrt mich an. »Wie hast du das gemacht?«, fragt er nach einer Weile. Seine Stimme seltsam hoch.
»Was meinst du mit gemacht?«
»Du weiß genau, was ich meine.« Er mustert mich. Ich habe immer noch das kurze Kleid von heute Mittag an. Es ist völlig zerknittert, was mir plötzlich peinlich ist.
»Ich verstehe nicht …«, sage ich langsam.
Er atmet einmal kurz durch. »Weißt du, mein Fahrrad ist nur noch ein Haufen Schrott.«
Ich schlucke. Ein Haufen Schrott, ein Haufen Schrott …
»Du hattest recht: da war wirklich ein Laster.« Er hebt jetzt den Arm und ich halte die Luft an. Um den rechten Ellbogen zieht sich ein Verband. »Aber ich hatte Glück«, fährt er fort. »Nur ein paar Abschürfungen. Und dann das hier im Gesicht.« Er dreht sich zu mir. Der dunkle Fleck ist ein Bluterguss. Er zieht sich vom rechten Auge nach unten bis zum Kinn.
»Nein!«, entfährt es mir.
»Also, wie hast du das gemacht?«, fragt er ruhig. »Mit dem Regen, dem Laster. Wie konntest du das wissen?«
»Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe es einfach gesehen«, sage ich leise.
»Aber das ergibt einfach keinen Sinn.«
»Nein, das tut es nicht«, gebe ich zu.
Er beißt sich auf die Lippe. »Weißt du … Ich habe eine Erklärung. Es gibt doch dieses Ding, eine … eine selbsterfüllende Prophezeiung … Hättest du nichts gesagt, es wäre anders gewesen. Ich hätte nicht dauernd daran denken müssen, als ich im Tunnel war.«
Ich schnappe nach Luft. »Du meinst, es ist passiert, weil ich es vorausgesagt habe?«
»Nein. Doch.« Er zögert. »Was weiß ich …«
»Du glaubst, ich bin schuld?«
Er schweigt und sieht zu Boden. Sein T-Shirt ist völlig nass und das Wasser läuft ihm von den Haaren.
Ich räuspere mich leise. »Es wäre passiert, ob ich dir das gesagt hätte oder nicht.«
Er hebt seinen Kopf und sieht mich misstrauisch an.
»Das macht es eigentlich nur noch unheimlicher.«
Ich beiße mir auf die Lippe. »Du musst keine Angst vor mir haben!«, flüstere ich und wünsche mir, es würde nicht so verzweifelt klingen. »Ich bin genauso wie du. Ich habe nur diese eine Fähigkeit. Es ist wirklich das Einzige, was mich von dir unterscheidet.«
»Hey, ich hab keine Angst vor dir, echt nicht«, sagt er, aber seine Augen sagen etwas ganz anderes. Eine verlegene Stille macht sich zwischen uns breit.
Er fährt sich über die Haare. »Okay dann! Ich geh jetzt!« Er wendet sich um und geht zu seinem Bungalow. Dabei hinkt sein Fuß nach. Mein Herz zieht sich zusammen.
»Warte!«
Er sieht mich zweifelnd an.
»Soll ich dir vielleicht mit irgendwas helfen? Ich könnte was für dich einkaufen oder so. Morgen?«, frage ich.
Er kratzt sich am Kopf. »Ja. Vielleicht. Mal sehen. Ich gebe dir Bescheid, ja?«
Es klingt eine Spur zu freundlich, sodass mir klar wird, dass er mir nicht Bescheid geben wird. Nein, er wird mir ab jetzt ausweichen. Ich sehe es an seinem Blick. Er tritt einen Schritt zurück. »Ich muss jetzt wirklich rein.«
Ich schäme mich und trete zurück. Sein Blick tut mir so weh wie ein Schnitt mit dem Messer.
»Also dann! Bis morgen!!«
Ich schließe die Tür. »Bis morgen!« Das Echo der Worte klingt mir in den Ohren. Ich lehne mich an die geschlossene Tür. Ob er wohl noch draußen steht? Nein, er ist sicher hineingegangen, froh, mit mir nichts mehr zu tun zu haben. »Ich kann nichts dafür!«, hätte ich ihm am liebsten gesagt. »Ich bin nicht die, die für die Sachen verantwortlich ist, ich bin nur die, die sie sieht!« Aber hatte man nicht schon früher dem Boten, dem Überbringer der schlechten Nachricht, den Kopf abgeschlagen und nicht dem Verursacher? Ich wollte nie der Bote sein! Ich habe mir das nicht ausgesucht. Glaubt ihr mir das?
Ich warte ein paar Herzschläge, dann öffne ich die Tür einen Spalt. Der Regen hat nachgelassen. Wasserpfützen glänzen in der Straße. Robert ist tatsächlich verschwunden. Das heißt – nicht ganz. Drüben in dem oberen Fenster seines Bungalows brennt Licht. Ich kann nicht erkennen, ob er am Fenster steht, aber ich bin mir sicher, er beobachtet mich.
Ich wechsle die Seiten, krieche in seinen Kopf und sehe mich durch seine Augen. Ich stehe dort im Türrahmen. Mit zerknittertem Blumenkleid und wirren schwarzen Haaren. Die Augen dunkel und undurchdringlich. Ausgestattet mit einer unbegreiflichen unheimlichen Macht. Vielleicht hatte er recht? Vielleicht hatte meine Voraussage die Zukunft beeinflusst? Wer weiß das schon? Es war schon schlimm genug, dass ich sie gemacht hatte.
Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich ein Unheil voraussehe. Das zweite Mal überhaupt. Nur – dieses Mal ist niemand zu Tode gekommen. Nein. Ich habe Glück gehabt, genau genommen. Dieses Mal habe ich Glück gehabt. Trotzdem: Wahrscheinlich hält er mich für verrückt. Oder schlimmer – für eine Art Hexe!
Das ist alles Unsinn. Es passt nicht in die Welt, über der ein Gitternetz von Logik und Naturwissenschaften geworfen ist. Nur – ich passe nicht in dieses Gitternetz und diese Bilder, die so flüchtig in meinem Kopf herumschwirren, haben auch darin keinen Platz. Mir ist klar, dass es diese Bilder gar nicht geben darf. Dass sie mit allem, was ich gelernt habe und glaube von der Welt zu wissen, nicht in Einklang zu bringen sind. Könnte ich wirklich in die Zukunft sehen, würde das bedeuten, dass die Zukunft vorherbestimmt ist und dass die Zeit keinen linearen, sich fortentwickelnden Verlauf hat, sondern sich anders verhält. Wie gefalteter Stoff, Falten, die sich übereinanderlegen und die sich treffen. Wie Zeitfetzen.
Es kann nicht sein. Es ist nicht logisch.
Aber was ist es dann, das ich sehe? Sind es Halluzinationen? Bilderanfälle, wie sie bei Epilepsie vorkommen? Es muss irgendwo klare wissenschaftliche Erklärungen dafür geben. Was könnten die Bilder schon anderes sein als Konstrukte meines Geistes? Bloße Produkte der Fantasie und des Zufalls? Vielleicht ist es mein Gehirn, das mir die Bilder nur vorgaukelt, dann die Ereignisse rückdatiert oder irgendwelche anderen seltsamen und beunruhigenden Dinge mit mir anstellt.
Es könnte also gut sein, dass ich schlicht und einfach verrückt bin.
Andererseits – hier stehe ich im Türrahmen, vor mir die Pfützen und der Regen, die nackte Wand ohne Fahrrad und das Licht im Haus meines Nachbarn. Die Gabe war da, die Bilder sind eingetroffen: es gibt sogar einen Zeugen. Er sitzt drüben hinter seinem Fenster und hält mich für verrückt oder – für eine Art Hexe. Er hat recht: ich muss eines von beiden sein.
Und ich weiß nicht, welches davon schlimmer ist.
Die nächsten Tage verbringe ich zwischen Angst und Hoffnung, Robert wiederzusehen. Aber er klingelt nicht. Einmal sehe ich ihn mit einem Handtuch unter dem Arm den Bungalow verlassen. Er öffnet die Tür und schließt sie schnell wieder. Blickt zu meinem Fenster hoch und biegt schnell um die Ecke. Es sieht so aus, als wäre er auf der Flucht.
Er hat mir nicht Bescheid gegeben. Natürlich nicht.
Ich ziehe den Rollladen herunter, tue so, als wäre ich nicht da, verschanze mich in der Dunkelheit meines Bungalows unter der Treppe und versuche, meine Arbeit weiterzuschreiben. Was sollte ich auch sonst tun?
Am dritten Tag dann klingelt endlich mein Telefon.
3
Ich starre auf die Nummer. Sie ist mit keinem meiner Kontakte verknüpft. Sollte ich sie annehmen? Warum nicht?
»Celine?« Eine tiefe Stimme. Mann oder Frau? Schwer zu sagen.
»Ich bin’s, Pandora.«
Pandora? Mein Herz klopft schneller. »Woher hast du meine Nummer?«
»Ich habe bei deinem Institut angerufen.«
»Bei den Psychologen?«
»Ja, stell dir vor.« Ihre Stimme klingt spöttisch. »Dieser Assistent hat mir deine Nummer gegeben.«
Ich sortiere meine Gedanken. Es dauert ein bisschen. Wie ein Programm, das langsam hochfährt. Sebastian Mende. Mein Dozent an der Uni. Ich sehe ihn vor mir in seinem kleinen unaufgeräumten Büro, wie er versucht, Autorität auszustrahlen, was ihm nie recht gelingt. Er hat einfach meine Nummer herausgegeben. Pandora hat ihn sicher mit ihrer dunklen Stimme um den Finger gewickelt. Warum hat sie sich die Mühe gemacht? Zu einer der vielen Merkwürdigkeiten unserer Freundschaft – ist es eine Freundschaft? Und wenn es keine ist, wie nennt man es dann? – gehört es, dass wir nie unsere Nummern oder E-Mail-Adressen austauschen. Wir verlassen uns darauf, uns zufällig über den Weg zu laufen.
Und jetzt hat Pandora diese unausgesprochene Regel gebrochen.
Die Pause ist lange. Vielleicht meint sie, dass ich sauer bin. Bin ich nicht, wie ich überrascht feststelle.
»Was machst du so die ganze Zeit?« Ihre Stimme klingt beiläufig, vielleicht mit einer Spur Nervosität darin.
»Ich? Keine Ahnung. Ich sehe aus meinem Fenster und beobachte meinen Nachbarn.« Ich klinge auch beiläufig, aber mein Herz macht kleine Sprünge.
»Klingt aufregend.«
»Hmm.«
»Sieht er gut aus?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Du könntest mir ein Foto schicken.«
»Es ist nicht so, wie du denkst.«
»Okay, ich frage nicht weiter.« Sie lacht. Es klingt sehr befreiend. Ich bin ihr dankbar für dieses Lachen.
»Und was treibst du so?«, frage ich schnell.
»Ich arbeite. Deshalb rufe ich dich an.«
»Ja?«
»Also. Ich bin hier am Lehrstuhl und wir suchen für die Semesterferien noch eine Praktikantin.«
Sie ist bei den Neuroinformatikern, hatte dort ihr Studium schon abgeschlossen und eine der raren Assistentenstellen ergattert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Bereich, an dessen Namen ich mich nie richtig erinnern kann, und schreibt ihre Doktorarbeit. Über was genau, das hat sie mir nicht erzählt. Es scheint jedenfalls Lichtjahre von meinem Psychologiestudium entfernt zu sein.
»Hm, Praktikantin. Du meinst, ihr sucht jemanden, der für euch Kaffee kocht?« Ich klinge distanziert, cool, als würde mich das eigentlich gar nicht interessieren. Was natürlich nicht stimmt.
»Nein …, ich meine, das auch, … aber auch noch für andere Dinge.« Pandora ist durch meine Gleichgültigkeit tatsächlich kurz ins Schlingern geraten. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen sollte.
»Dinge?«
»Wir suchen Psychologen, die an einem Projekt mitarbeiten.«
»Was wollt ihr denn von uns? Reden?«
Sie lacht. »Sie glauben eben, dass ihr uns nützlich sein könnt.«
Pandora räuspert sich. »Bist du noch dran?«
»Wie … wie kommst du auf mich?«
Auf der anderen Seite gibt es ein kleines Zögern. Es ist nur minimal, aber ich bemerke es.
»Du warst die Einzige vom Lehrstuhl, die noch erreichbar war. Alle anderen sind zu Hause oder im Urlaub oder was weiß ich …«
Wieder ein Zögern.
»Das ist zumindest das, was ich Hektor gesagt habe.«
»Hektor?«
»Meinem Prof.Du wirst ihn noch kennenlernen.«
»Und was war der eigentliche Grund?«
Pandora seufzt. »Ich würde einfach gerne mit dir zusammenarbeiten.«
Ich werde rot. Gut, dass sie es nicht sehen kann. »Danke, dass du an mich gedacht hast.« Es klingt jetzt gar nicht mehr cool. Egal.
»Ab wann sucht ihr denn jemanden?«
»Du kannst jederzeit anfangen«, sagt Pandora. »Wenn du willst, noch heute.«
»Okay«, sage ich überrascht. »Also … ich weiß nicht …«
»Fühl dich jetzt nicht überrumpelt. Aber es wäre gut, wenn du dich schnell entscheiden könntest.«
»Hat euch jemand abgesagt?«
Sie schweigt eine Weile. »Ja. So kann man es sagen.«
»Das heißt, ich soll zu dir ans Institut kommen?«
Sie lacht. »Das wäre sehr hilfreich, ja.«
Ich warte ein, zwei Herzschläge lang. Vielleicht sollte ich doch nicht zu interessiert klingen. Nicht so, als wäre dieser Job meine einzige Rettung aus meiner grauen Existenz unter der Treppe und dem viereckigen Fenster meines Laptops, das seit ein paar Tagen mein einziger Zugang zur Welt ist.
»Mhmm. Ich kann es mir ja mal ansehen.«
»Ja, das kannst du.«
»Ich … ich muss nur sehen, wann ich hier rauskann.«
»Du bist also gerade sehr beschäftigt?« Sie klingt belustigt.
»Äh …« Ich werfe einen Blick zum Fenster mit den heruntergelassenen Jalousien. »So ähnlich.«
»Wir sind heute bis mindestens um acht Uhr da. Heisenbergstraße 12.«
»Gut«, sage ich. »Vielleicht schaffe ich es bis dahin. Mal sehen.«
Sie lacht wieder, als hätte ich einen Witz gemacht. »Bis gleich, Celine.«
Ich stecke mein Handy weg und spüre meine Aufregung. Ein glückliches strahlendes Gefühl, in das sich, wie graue Farbe, Verwirrung einschleicht. Wie sehr hatte ich mir in den letzten Wochen gewünscht, Pandora zu sehen.
Ich hatte mir ausgemalt, ihr auf der Straße zu begegnen oder irgendwo an der Uni, bei den großen Brunnen. Wir hätten alle anderen Pläne über den Haufen geworfen und etwas zusammen unternommen. Ihr Anruf hat mich aber nun ganz durcheinandergebracht. Sie will, dass ich mit ihr zusammenarbeite? Ich google das Institut für neuronale Informatik, ein großes schmuckloses Gebäude in undefinierbarer Farbe. Beige? Hellgrün? Es liegt auf der orangefarbenen U-Bahnlinie, die das Dorf mit der Stadt verbindet, sechs Haltestellen weit entfernt. Ich wäre in einer halben Stunde da. Ich habe keine Ahnung von Neuroinformatik, ich weiß nicht, was ich dort eigentlich soll, aber die Aussicht, Pandora zu sehen, versetzt mich in Aufregung. Eine Praktikumsstelle! Und sie hatte an mich gedacht. Ich denke an das seltsame Zögern in ihrer Stimme, verbanne aber diesen Gedanken schnell nach hinten.
Sollte ich morgen hingehen? Oder doch ein bisschen Zeit verstreichen lassen? Es würde besser aussehen. Nicht so, als ob ich es nötig hätte und als ob ich ihrem Ruf sofort folge. Andererseits halte ich es keinen Tag mehr auf dieser Treppe aus. Nicht wenn ich weiß, dass es noch etwas anderes zu tun gibt, als zum zehnten Mal meine Einleitung umzuschreiben und darauf zu warten, dass Robert seinen Bungalow verlässt. Ob er schon weg ist? Oder schläft er heute länger? Ich steige die Treppe hoch, um aus dem Fenster zu spähen. Durch die gelben Papierjalousien, die ich heruntergelassen habe, scheint das Sonnenlicht und beleuchtet die tanzenden Staubteilchen im Zimmer. Es ist heiß und stickig, und ich wünschte, ich könnte wieder das Fenster öffnen. Ich lasse es geschlossen, hebe aber die Jalousie vorsichtig von der Scheibe. Der Bungalow gegenüber ist wie meiner – nur spiegelverkehrt. Dort, wo sich mein begehbarer Wandschrank mit dem quadratischen Fenster befindet, ist auf der anderen Seite die Lüftung des Badezimmers. Das »Badezimmer« ist in beiden Fällen eine aus einem einzigen Plastikguss bestehende Kabine, die ungefähr so aussieht und so groß ist wie eines dieser französischen Klohäuschen, nur dass sie sich bedauerlicherweise nicht selbst reinigt, wenn man sie wieder verlässt.
Auf dem Fenster zum Wandschrank sitzt Snoopy mit Fliegerbrille und wartet mit hängenden schwarzen Ohren darauf, dass der Bewohner aus der Tür unter ihm tritt. Genauso wie ich. Es dauert lange, ich bin schon ganz steif und bewegungslos hinter meiner gelben Jalousie, dann öffnet sich tatsächlich die Tür und er kommt heraus. Ich ducke mich und hoffe, er würde nicht nach oben sehen, was er nicht tut. Aber er wirft einen kurzen Blick auf meine Tür, bleibt kurz stehen, als überlege er sich, ob er klingeln solle. Warum sollte er klingeln? Ich wage mich nicht zu rühren und spüre meinen Puls. Er scheint es sich anders zu überlegen, zupft sich nervös an seinem Bart, dreht sich schließlich um und geht. Er ist kleiner und weniger bärtig, als ich ihn in Erinnerung habe, und er zieht sein Bein nach. Ich verstecke mich wieder hinter der Jalousie und warte genau zehn Minuten. Als ich die ausgebleichte Pappe wieder hebe, hat sich nichts verändert. Die Tür ist geschlossen. Er ist nicht zurückgekommen. Die Luft ist rein.
Ich gehe nach unten, ziehe mir ein dunkelblaues T-Shirt über, das nicht verknittert aussieht, schlüpfe in eine saubere Jeans, kämme meine langen schwarzen Haare und bändige sie zu einem Pferdeschwanz und werfe einen Blick in den Spiegel, den ich auf die Treppe gestellt habe. Er ist nicht aufgehängt – nichts ist hier aufgehängt. Ja. Ich werde losgehen – jetzt.
Ich finde, ich sehe sehr mutig aus.
4
Wir sollten nie dem Menschen trauen, den wir im Spiegel sehen. Wir meinen, dass wir es selbst sind. In Wirklichkeit ist es nur unser spiegelverkehrter Zwilling mit seinem falschen Lächeln und dem eingezogenen Bauch. Die Version von uns, die wir für besser halten. Zuverlässiger sind die Spiegelbilder, die wir im zufälligen Vorbeigehen erhaschen. In Schaufensterscheiben, Rückspiegeln, Kaffeekannen, Silberlöffeln, in all den glänzenden Folien. Flüchtige verzerrte Bilder, die uns verwundern, manchmal erschrecken. Das bin ja ich! Ein flüchtiges Aufblitzen der Wahrheit. Das Bild geht vorbei und ist schon wieder Vergangenheit. So wie ich mich jetzt sehe, in der schmutzigen Spiegelung des Zugfensters.
Ich sehe müde aus, vielleicht fürchte ich mich vor dem Ende der Zugfahrt. Meine Haare sind nun kurz geschnitten. Sie sitzen auf meinem Kopf wie ein Helm. Ich bin die neue Celine-Version, ein moderneres, mutigeres Update der alten.
Ich denke an Pandora, schlucke kurz. Ich muss die salzigen Tränen wegputzen und hoffe, dass keiner mich beobachtet.
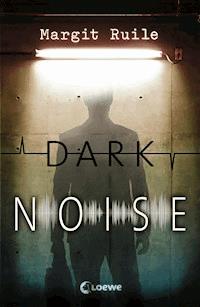


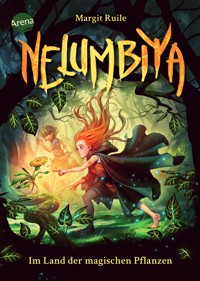
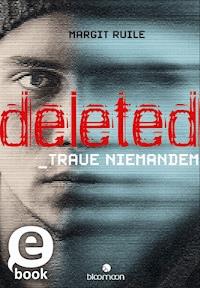














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









