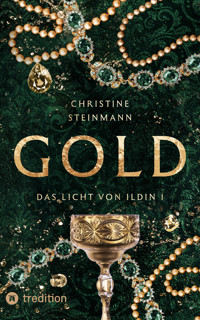
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Fantasyroman über Verlust, Neuanfang und die Magie der Hoffnung. Jenna James ist eine attraktive Frau auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, doch hinter der Fassade kämpft sie mit quälenden Depressionen. Nach einem Schicksalsschlag trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. In einer anderen Welt, weit entfernt von ihrem alten Leben, beginnt Jenna einen neuen Weg. Umgeben von schönen und liebenswerten Wesen findet sie langsam wieder Hoffnung, doch die Schatten lassen sie nicht so einfach los. Kann Jenna Frieden mit sich selbst schließen und im Licht von Ildin das Glück finden? Dieses Buch ist auch als Printausgabe erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
GOLD
Das Licht von Ildin I
Christine Steinmann
Inhalt
Für Kurt
JennasGeschichteenthältauch schwere Themen. Einige sind hinten im Buch aufgelistet, um hier am Anfang noch nicht zu viel zu verraten. Gehen Sie sie gerne vor dem Lesen durch, wenn Sie es möchten, denn sie können Reaktionen triggern. Falls es bei Ihnen der Fall sein sollte, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie die Balance schnell wiederfinden.
Die Themen wegzulassen, war keine Option. Sie gehören dazu, den Weg einer Frau mit allen Aspekten darzustellen. Ich hoffe aber, dass Jennas Humor und ihre guten Erlebnisse Sie durch dieses Buch tragen werden.
Es gibt viele Wege, und jeder hat den eigenen. Manchmal benötigt man beim Gehen ein wenig Hilfe und darf sie jederzeit annehmen. Sie finden sie zum Beispiel bei Organisationen, die Ihnen mit ihrer Erfahrung und ihren wunderbaren Menschen gerne zur Seite stehen. Die Veröffentlichung der aktuellen Kontaktdaten an dieser Stelle ist mit ihnen abgesprochen, sodass Sie sie voller Vertrauen nutzen können.
„Verwaiste Eltern und Geschwister Hamburg e.V.“
Bogenstr.26, 20144 Hamburg
Kontakt: 040-45 000 914 und
[email protected], www.verwaiste-eltern.de
Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention
www.deutsche-depressionshilfe.de
Info-Telefon Depression: 0800-3344533
E-Mail-Beratung Depression: [email protected]
Die TelefonSeelsorge
bietet Hilfe in schwierigen Lebenslagen – kostenfrei, anonym und rund um die Uhr.
Per Telefon:
0800-111-0-111 oder 0800-111-0-222
Per Chat oder Mail:
https://online.telefonseelsorge.de
Zum Download in den Appstores:
Der KrisenKompass als Notfallhilfe für die Hosentasche
In über 20 Städten in Deutschland auch im direkten Gegenüber mit hauptamtlichen Beraterinnen und Beratern:
https://www.telefonseelsorge.de/vor-ort/
Ein Angebot der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland.
Dies ist nur eine Auswahl des Angebotes an Möglichkeiten.
Allesfingdamitan, dass ich eine falsche Entscheidung traf. Sie war sogar grundfalsch, und darüber kann es keine zwei Meinungen geben. Aber das verstand ich erst später, wobei ich vermutlich die einzige Person in der Geschichte des Universums bin, die dazu jemals eine Chance hatte. Viele andere vor mir haben sich ähnlich entschieden und konnten ihren Fehler nicht bereuen oder ihn wiedergutmachen.
Nicht so wie ich. Etwas von solcher Art passiert nur einmal, und bis jetzt habe ich noch nicht ganz begriffen, warum ausgerechnet mir. Dafür kann ich aber den altbekannten Shakespeare-Spruch aus dem Hamlet bestätigen:
„Es gibt mehr Ding' im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt, Horatio.“
Der gilt auch, wenn man nicht Horatio heißt oder wie Hamlet gerade einen Geist gesehen hat. Selbst für einen Geist passt er. Es klingt eigenartig, wenn man nicht weiß, worum es hier geht, doch Sie werden noch alles verstehen. Bitte lesen Sie einfach, was ich Ihnen zu sagen habe. Mir ist es wichtig, denn ich möchte, dass niemand denselben Weg beschreitet, auf den ich mich verirrt habe. Er ist eine Einbahnstraße und führt direkt in die Dunkelheit.
Aber was wir suchen, was wir brauchen und was wir wirklich sind, das ist das Licht.
Entscheiden Sie sich immer dafür.
IchbinJennaJulia James.
Man stolpert über das holprige JJJ, meine Eltern hatten ihren ganz eigenen Humor. Ihr Werk kann man aber nicht mehr ändern, und im Grunde finde ich den Namen „Jenna“ für sich gesehen in Ordnung. Nicht speziell und nicht bezaubernd, aber in Ordnung.
Ich komme aus Southsea, das ist zwar schon wieder so ein Zungenbrecher, aber dafür ist es der schönste Stadtteil von Portsmouth in England. Mehr als in Ordnung und wirklich bezaubernd. Dort gibt es eine viktorianische Promenade am Meer namens Clarence Parade, und genau an dieser Straße war eine große Wohnung mit meinem Namen auf dem Klingelschild.
***InihrenaltenWänden lebte ich mit meinem Sohn Gabriel, was ich sehr genoss, und ohne meinen Exmann, was ich ebenfalls sehr genoss. Geld für dieses Zuhause und alles sonst hatte ich ausreichend zur Verfügung, denn wenn ich etwas beherrschte, dann war es mein Job als Immobilienmaklerin. Ich war dafür bekannt, für jeden das richtige Domizil zu finden, und auch für mich war mir das gelungen. Mein helles Apartment mit seinem wundervollen Blick auf den Solent war wie eine Visitenkarte und die beste Werbung.
***Wasichhatte,war selbst verdient, und daher erlaubte ich mir, darauf stolz zu sein. Im Leben war ich gut aufgestellt und ziemlich glücklich. Aber alles ist im Fluss, und nichts ist sicher, auch wenn es so erscheint.
Was ich Ihnen bis hierher erzählt habe, ist nett zu wissen, jedoch nicht das, was ich Ihnen eigentlich mitteilen wollte. Das Eigentliche schiebe ich vor mir her, aber jetzt habe ich angefangen und muss auch weitermachen. Dafür gibt es einen Grund: Ich will die Vergangenheit loslassen, um eine Zukunft zu haben. Das klingt hochdramatisch, aber es ist wahr.
Meine Worte haben Sie erreicht, und das ist unter den Umständen ein kleines Wunder. Sie werden wissen, was ich damit meine, wenn Sie sie lesen. Weiterlesen.
***Ichhabesieaufgeschrieben, um eine Geschichte zu erzählen, die mir geschehen ist. Um die Geschichte zu erzählen, die dabei auch in mir geschehen ist. Hier ist mein Bericht über das Innen und das Außen.
Er gehört jetzt Ihnen.
AmTagvonGabriels Beisetzung war widerlich schönes Wetter. Warum schien an einem Tag wie diesem die Sonne? Mein Sohn war fort. Alle Vögel hätten vom Himmel fallen sollen, alle Uhren hätten stehenbleiben müssen, und vor allem hätte mein Herz gerne mit dem Schlagen aufhören können. Aber es schlug unbeirrt weiter, die Zeit lief und die Sonne schien vom Himmel mit den fröhlich singenden Vögeln.
Ich stand auf dem Friedhof und starrte in das grelle Licht dieses blöden Sterns, während aus meinen Augen immer mehr Tränen strömten, auch wegen der Helligkeit. Eine Sonnenbrille wäre gut gewesen, um das unpassende Strahlen abzuhalten und mich dahinter zu verkriechen, damit die Leute endlich aufhörten, mich anzustarren. Sie beobachteten mich wie ein Tier im Zoo.
Hinter jedem freundlichen Lächeln glaubte ich, Neugier im besten und Sensationslust im schlimmsten Fall zu erkennen. Es waren unfassbar viele Menschen gekommen, das hätte mich freuen sollen, aber ich wollte überhaupt keine Menschen sehen. Ich wollte allein sein mit meinem Schmerz. Der Wunsch erfüllte sich mir in ganz großem Stil, denn ab diesem Tag war ich allein. Ohne mein einziges Kind und ohne meinen besten Freund, dafür mit meinem Schmerz.
Jetzt wissen Sie schon einen Teil von dem, wovor ich mich eben noch gedrückt habe. Da ist noch mehr, also mache ich lieber weiter, bevor ich wieder mit Klingelschildern und Strandpromenaden anfange.
***Gabewareinjunger, gesunder Mann von 21 Jahren. Wie konnte so jemand nicht mehr da sein? Sicher möchten Sie erfahren, warum seine Mutter ohne Sonnenbrille auf dem Friedhof stand und die helle Sonne und die Menschen hasste, die ihr Sohn geliebt hatte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren ständig, überall um einen herum verunfallen Menschen. Der Unterschied war, dass nach diesem Unfall nicht nur jemand einen Gipsarm hatte, sondern dass mein Sohn fehlte. Der Fahrer eines schwarzen BMW trug die volle Schuld. Sein Leben ging in einem Gefängnis weiter, weil er das von Gabriel beendet hatte. Er war bei Rot auf die Kreuzung gerast und in seinem Blut fand man illegale Substanzen – die Sache war also eindeutig.
Das wusste ich, doch es bedeutete mir gar nichts. Ich brach trotzdem alles auf mich herunter. Sie müssen wissen, dass ich eine Grüblerin bin und dazu neige, alles so lange zu zerdenken, bis es irgendwann wehtut. Dann hänge ich in meinen Gedanken fest wie die Nadel auf einer kaputten Schallplatte. Wie besessen las ich unseren letzten Chat bei WhatsApp immer wieder durch, auch wenn ich es nicht wollte. Ich war die Nadel geworden und konnte mich nicht mehr aus der Rille befreien. Hier ist der Austausch, Sie sollen alles erfahren. Satzzeichen gab es keine, zumindest nicht bei Gabe. Er schrieb genauso, wie er sprach und wie er war, übersprudelnd vor Leben. Keine Punkte und Striche konnten seine strahlende Wucht aufhalten.
Gabe: was gibts zumabendbrot
Ich: Kacke mit Ei.
Gabe: iiiih schon wieder ei
Ich: Shepherds Pie mit Möhrchen.
Gabe: iiiih schon wieder nein quatsch leck er
Ich: Hatten wir lange nicht…
Gabe: ja geil meine ich ernst hben wir alles
Ich: Ich war vorhin noch einkaufen, alles da!
Gabe: trinken aber nicht diesen schrott von gestern
Ich: Doch - ist noch eine halbe Flasche von da…
Gabe: nix der schrott ich hjol richtigen
Ich: Ja gerne, ich mag den ja auch nicht. Einen Riesling?
Diesen deutschen mit dem Etikett mit blauer Schrift,
wo hatten wir den neulich mal her?
Gabe: ja der war gut dann muss ich ib die stadt zu
m und spence wird dann später
Ich: ok
***Fürmichstandfest: Mit diesen zwei Buchstaben – o und k – hatte ich Gabriel in den Tod geschickt. Er war für eine Flasche deutschen Riesling gestorben. Ich weiß genau, dass er selbst vorgeschlagen hatte, bei Marks & Spencer am Foodcourt in der City vorbeizufahren, aber ich grübelte mich so lange in meine eigene Hölle, bis ich mich selber nicht mehr erkannte. Mit Gabriel verlor ich nicht nur das einzige Kind und den besten Freund, sondern auch einen Teil meiner Identität. Ich war keine Mutter mehr. 21 Jahre lang war ich aber eine gewesen und hatte damit gerechnet, meinen weiteren Weg irgendwann als lässige Oma in Jeans zu beschreiten. Die Linie der Familie konnte nicht mit mir enden, nachdem sie mit einer neuen Generation schon fortgesetzt war.
wird dann später
ok
***Ichkamnichtklar. Derjenige, der mir hätte helfen können, fehlte nun. Immer hatte ich Phasen gehabt, in denen mir die Welt zu viel geworden war. Manche nennen das „Depressionen“. Ich nannte es „Grübeln“. Freunde und Familie kamen schon vor Gabriels Tod nicht damit zurecht. Mit dem Grübeln. Da ich offensichtlich ein tolles Leben hatte, sollte ich mich bitte auch so fühlen. Dass ich mich nur als ziemlich glücklich bezeichnete, reichte ihnen nicht. Zur Not sollte ich mich endlich zusammenreißen, und gesunde Ernährung oder Sport halfen laut selbst ernannter Experten im Bekanntenkreis bestimmt auch. Meditieren. Massagen. Mehr ausgehen.
Die Ideen ohne Verständnis waren endlos, und sie waren endlos sinnlos. Der Druck durch das gesammelte Unverständnis machte mich nur noch dunkler und noch schwerer. Aber es bedeutete nichts, denn wenn es wieder so weit war und selbst eine Dusche mir wie eine zu große Aufgabe vorkam, dann schickte mir mein Sohn, dessen Seele voller Sonne war, seine Lichtfunken in den Kopf. Er konnte das.
Als ich einer Kollegin unser Treffen im Pub absagen wollte, weil mir menschliche Nähe an dem Tag unvorstellbar schien, sah Gabriel mich nur an und sagte leise:
„Menschen sind wunderbare Wesen.“
Nichts sonst, nur das. Aber es reichte, und ich hielt widerwillig die Verabredung ein. Meine Kollegin und ich schwankten auf unseren zu hohen Absätzen zwischen schale Pints kippenden Männern und tranken Wein, als sei es für mich ganz leicht und völlig normal, dort zu sein. Wir lachten, und sie bemerkte keinen Schatten an mir. Nur Gabriels Lichtfunken.
Wein.
Die Flasche, die Gabriel noch bei M&S gekauft hatte, wurde aus dem Wrack seines blauen Triumph Herald geborgen und mir zusammen mit seinen anderen Sachen übergeben. Er hatte sein Versprechen erfüllt und wir hätten keinen „Schrott“ trinken müssen. Der Anblick dieser Flasche gehörte zu dem Schlimmsten, das ich jemals ertragen musste. Er machte das Unfassbare real.
Mir war immer versichert worden, dass die Zeit die Wunde heilen oder zumindest der Schmerz leichter zu ertragen werden würde. Das stimmte für meine Mutter, die den Verlust ihres einzigen Enkelkinds irgendwie an die Seite packte und äußerlich zur Normalität zurückkehrte. Das war ihr bereits nach dem Tod meines Vaters erstaunlich gut gelungen und machte mich damals schon wütend. Sie glaubte fest daran, dass man offiziell bestimmbare Phasen von Trauer durchlief und nach einem Jahr dann mit dem Schlimmsten durch war. So ähnlich hatten auch meine Freunde gedacht, die am Anfang rücksichtsvoll und schließlich nur noch genervt von mir waren, weil sie die alte Jenna vermissten. Den Teil zumindest, den ich ihnen von mir gezeigt hatte. Diesen gab es aber nicht mehr, und die neue Version von mir wollte sich nicht an die Erwartungen der anderen halten. Ein paar von ihnen warfen mir Schwäche vor.
Trauer ist keine Schwäche.
Trauer ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir geliebt haben, und für große Liebe ist er eben hoch.
***Ichzogmichvon ihnen allen zurück, weil ich ihre ständigen Ermunterungen nicht ertrug. Nimm wieder am Leben teil, das hätte Gabe so gewollt. In allen Variationen.
Das weckte in mir Hassgefühle. Woher konnten sie wissen, was Gabriel gewollt hätte? Ich wollte es jedenfalls nicht, und die Zeit heilte mich auch nicht. In mir klaffte ein Loch, das verstreichende Tage ganz bestimmt nicht füllen konnten. Womit denn auch? Wie sollten Minuten und Stunden einen Menschen ersetzen? Ich konnte den Schmerz und dieses Loch nicht mehr ertragen. Darüber lag wie ein Ölfilm die alles erstickende Schuld. Ich liebte eigentlich das Leben, daher kämpfte ich auch ein ganzes langes Jahr darum. Diese dunkle Phase endete jedoch nicht, da war kein Lichtfunken mehr in meinem Kopf. Niemand machte mir mit den richtigen Worten wieder Mut.
Menschen waren nicht mehr wunderbar.
***Ichfunktionierte.Ichging irgendwann wieder arbeiten, fotografierte Wohnungen, vermittelte Häuser und machte mich für Kundentermine zurecht. Das alles blieb außen und erreichte nicht mein Inneres. Mein Vater hätte gesagt, ich hätte Schlachten gewonnen, den Krieg jedoch am Ende verloren.
Strengt Militärisches Sie an? Das geht vielen Leuten so, aber ich stamme aus einem Offiziershaushalt. Dad war bis zu seinem Tod Captain eines Kriegsschiffes, genauso wie mein Grandpa. Der hatte mehrfach als Kommodore ganze Verbände von diesen schwimmenden Festungen kommandiert und galt als das leuchtende Beispiel vorbildhafter Männlichkeit in unserer Familie. Auch Gabriels Vater war als Kampfschwimmer in der Navy und hatte Minen entschärft, aber mit meinem Exmann hatte ich bereits keinen Kontakt mehr, als unser Sohn noch in seinen A-Levels steckte. Mein Leben verbrachte ich immer mit Soldaten, Gabriel beeinflusste das jedoch überhaupt nicht.
Er war trotz aller familiären Bemühungen aus ganzem Herzen ein Pazifist. Ein richtig guter Mensch.
Das war ich nicht. Nicht mehr ohne ihn.
EinesMittagsschaffteich wieder nur einen Streifen Käse als Lunch, mehr Aufwand schien mir sinnlos. Während ich mit dem Käsemesser hantierte, fiel mir auf, wie traurig und armselig das war, und die Klinge zog meinen Blick auf sich. Dazu spielte Natasha Bedingfields „Unwritten“ im Radio, Gabriels Lieblingslied. Für ihn war nichts mehr ungeschrieben, sein kurzes Buch war beendet. Beenden.
Ich räumte alles weg, wischte die Arbeitsplatte ab und ging nach oben in meine Ankleide. Dort zog ich das goldene Abendkleid an, das der richtig gute Mensch und ich bei einem Einkaufsbummel nachhaltig in einem Second-Hand-Laden erstanden hatten. Es besaß eine kleine Schleppe, war hauteng und von oben bis unten voller glitzernder Pailletten, wodurch es eine gefühlte Tonne kaltes Gewicht hatte. Gabriel hatte es gefunden und lachend gesagt, es hätte die Farbe meiner Haare. Dieser Moment strahlte in meiner Erinnerung nun wie ein Schatz.
***MitSchätzenbehängteich mich tatsächlich, denn es erschien mir aus irgendeinem Grund bedeutsam, bei meinem Vorhaben nicht nur das besondere Kleid, sondern auch all meinen Schmuck zu tragen. Es wurde am Ende eine ganze Menge glänzendes Gold und sah mit Sicherheit absurd aus, doch das war nicht ausschlaggebend. Jedes Stück hatte seine eigene Geschichte und sollte für immer bei mir bleiben. Auf eine Schicht aus anderen Ketten platzierte ich zuletzt noch das aus großen goldgefassten Smaragden bestehende Familienerbstück aus dem 18. Jahrhundert.
Es stand für alle, die vor mir gegangen waren, und für den einen, der es nach mir hätte besitzen und der Mutter meiner Enkel anlegen sollen.
Ich schminkte mich sorgfältig. Mein attraktives Äußeres war mir immer noch wichtig, denn es war während der zurückliegenden Monate meine Rüstung geworden, hinter der ich meine Wunden verbergen konnte. Einen sarkastischen Humor hatte ich aus diesem Grund ebenfalls entwickelt, der die nötige Distanz zwischen mich und die Welt brachte. Mich schützend zu verschönern, beherrschte ich mittlerweile hervorragend, und ich besaß ein ganzes Arsenal von Kosmetik. Wenigstens diese eine Sache musste ich gut machen.
An der Sache war nichts Gutes, aber von normalem Denken war ich in dem Moment weit entfernt, und so wurde meine Erscheinung zum zentralen Thema. Sie konnte ich noch kontrollieren. Meine Nägel waren frisch in dem tiefen Kirschrot von Chanel lackiert, mit dem Lady Diana in den Neunzigerjahren gegen das Königshaus und seine überholten Regeln rebelliert hatte. Den Lack hatte ich jedes Jahr von Gabriel zu Weihnachten neu geschenkt bekommen. An diesem Tag war ich also gut zurechtgemacht, und mein Sohn hätte das zu schätzen gewusst, denn er hatte ein Auge für Schönheit.
Ich würde ihm Ehre machen mit meinem Abgang in Gold.
In meinem Badezimmer setzte ich zuerst meine Brille ab. Die brauchte ich nicht ständig und hatte sie wegen leichter Kurzsichtigkeit meistens nur zum Autofahren auf oder wie eben zum Hübschmachen. Jetzt brauchte ich sie überhaupt nicht. Meine hochhackigen Schuhe stellte ich ordentlich nebeneinander auf den flauschigen Vorleger an der Badewanne.
Dann stieg ich vollbekleidet in die Wanne hinein, und das Kleid wurde noch schwerer.
Im warmen Wasser trank ich ohne Umweg über ein Glas eine ganze Flasche Champagner, obwohl es erst Mittag war. Nicht sehr edel, aber zum Ausgleich trug ich viel teuren Schmuck.
Die Flasche Riesling von M&S wäre wahrscheinlich die passende Wahl gewesen, aber ich konnte sie nicht anrühren. Den Champagner hatte ich nach einem Abschluss von einem glücklichen Kunden bekommen, der zum Glück nichts von ihrer Verwendung erfahren würde. Dann weinte ich ein bisschen, und im Anschluss öffnete ich recht betrunken, aber sorgfältig meine Pulsadern mit dem Skalpell aus unserem Bastelkasten. Wir hatten zu jedem Fest aufwendige Karten für Freunde und Verwandte hergestellt, und dieses Messerchen brauchten wir für die besonders feinen Teile. Das waren intensive Erinnerungen. Darum wählte ich es aus, und weil es extrem scharf war. Gabriel war es einmal in die Fingerkuppe abgerutscht und hatte eine tiefe Wunde hinterlassen, die später zu einer Narbe wurde. Das perfekte Werkzeug für meinen Zweck also, in mehr als einer Hinsicht.
***Estattrotzdemüberraschend weh, mit zusammengekniffenen Augen in mein eigenes Fleisch zu schneiden, aber ich konnte nach dem ersten Verwunden nicht mehr zurück. Dabei war ich mir meiner Sache gar nicht sicher. Wenn es an der Tür geklingelt hätte, wäre ich vielleicht öffnen gegangen. Das Leben war doch an sich schön, nur nicht ohne Gabriel – und mit dem geballten Druck meiner verständnislosen Umwelt.
Ich zog es trotzdem durch, bevor mich der nötige Mut dazu verließ.
Ob man in diesem Zusammenhang von Mut sprechen kann, ist Ansichtssache. Mein Blut wirbelte in zarten Spiralen durch das schaumlose Wasser, und ich sah ihm erstaunt dabei zu. Zusammenhanglos freute ich mich kurz darüber, dass ich die Küche ordentlich und sauber hinterlassen hatte. Der Käse war im Kühlschrank. Dann ging plötzlich alles sehr schnell.
Das Wasser wurde kalt, mir wurde kalt, und endlich wurde es dunkel.
Dannwurdeeshell. Ich hatte nicht damit gerechnet, wieder aufzuwachen. An ein „Leben danach“ oder das Konzept von Himmel und Hölle glaubte ich nicht. Das Licht zu sehen, war nicht mein Plan gewesen, aber es war da, und ich konnte es sehen. Das musste bedeuten, dass ich auch noch da war. Benommen sah ich mich um und wunderte mich darüber, dass ich mich umsehen konnte. Ich war erstens nicht nass, obwohl ich eben noch in einer Badewanne lag, und zweitens befand ich mich auf einer Wiese. Immerhin liegend.
Natur war nie mein Ding, und einfach so auf einer Wiese herumzuliegen, wäre mir im Traum nicht eingefallen. Daher richtete ich mich auf, um weniger Kontakt mit dem Gras und den Insekten zu haben, die bestimmt darin herumkrochen. Warum konnte ich das? Liegen Tote nicht eher flach und haben die Tendenz, auch so zu bleiben? Zaghaft sah ich nach meinen Wunden. Die Schnitte an meinen Handgelenken waren nur feine Linien auf meiner Haut, die ihre normale Farbe hatte. Die Farbe der Wiese war nicht normal, denn sie war golden. Mit meiner Aufmachung fügte ich mich hier ins Gesamtbild ein, denn mein Kleid und den überdosierten Schmuck trug ich weiterhin.
***IchließmeinenBlick wandern und suchte nach mehr seltsamen Farben. Über mir war ein Stück unspektakulärer hellblauer Himmel. Die Sonne schien, doch sie stand nicht über mir, und ich konnte sie nicht direkt sehen. Falls es die Sonne war und kein leuchtender Engelschor. Dem Licht nach musste es früher Vormittag sein, ich war aber spätmittags in meine Badewanne gestiegen. Warum war es früher statt später?
Ein Hauch von würzigen Kräutern lag in der warmen Luft, nur ganz zart, aber doch deutlich wahrnehmbar. Ich schnupperte mit geschlossenen Augen am Boden. Der Geruch machte mich zwar neugierig, aber ich war noch nicht so weit, mir goldenes Gras aus der Nähe anzusehen. Es war eindeutig die Quelle des Duftes. Ich atmete tief ein und meine Nebenhöhlen weiteten sich dabei, als hätte ich ein Erkältungsspray genommen. So etwas hatte ich noch nie gerochen, und das sanfte Aroma durchdrang mich. Obwohl der Effekt angenehm war, machte er mich auch misstrauisch, und ich richtete mich wieder auf.
Wo war ich hier?
Diese Wiese erinnerte mich bis auf ihre Farbe und den Geruch an den Garten meiner Eltern, in dem ich als Kind glückliche Stunden verbracht hatte. Es war ein Stück wilder Rasen mit Büschen und Bäumen am Rand. Weiter als bis zu diesen hohen Gewächsen konnte ich ohne meine Brille nicht schauen. Mein ganzer Körper war gleichzeitig schlaff und eisig steif. Ich schauderte trotz der Wärme, an einem sonnigen Vormittag, der ein Mittag sein sollte, dachte dabei mit freier Nase an meine Kindheit und sollte nur eins sein: weg.
Leider war ich aber hier.
Ich wollte nicht hier sein, sondern nirgendwo, und machte meinem Missfallen auf die einzige Weise Luft, die mir zur Verfügung stand: Ich schrie es in den Wind. Den Wind kümmerte das erwartungsgemäß wenig, und so saß ich lange Zeit später immer noch auf der leuchtend goldenen Wiese. Ich schrie auch immer noch. Man kann das ziemlich lange, wenn man muss. Es hat außerdem die Eigenschaft, zumindest am Anfang recht laut zu sein und somit deutlich hörbar.
Für alles und jeden im näheren Umkreis.
NacheinerWeilekonnte ich nicht mehr schreien und verlegte mich auf stummes Schluchzen. Als auch diese Phase vorbei war, kam nur noch ein leises Wimmern. Das machte keinen Unterschied mehr, denn mein vorheriges Lärmen war bereits wahrgenommen worden. Aus den Bäumen rings um die Wiese herum traten Menschen. War es gut oder schlecht, dass ich hier nicht allein war? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ich theoretisch gerade in meinem Badewasser gestorben und praktisch doch noch anwesend war.
Die Menschen waren drei Männer und eine Frau, und ich verengte angestrengt die Augen, um sie etwas besser sehen zu können. Über ihren Schultern trugen sie lange Bögen und dazu Köcher mit reichlich Pfeilen. An den Hüften hingen kurze Messer oder Dolche und bei einem von ihnen etwas Längeres, wie ein Schwert. Zwei hielten Speere und wer wusste, was sie noch verborgen bei sich hatten. Das war nicht unbedingt das Erste, was ich an neuen Bekanntschaften entdecken wollte.
Außer den Waffen trugen sie ungewöhnliche Kleidung. Lange Tuniken über engen Hosen bei den Männern und ein Mieder mit wallendem Rock bei der Frau, wie auf einer LARP-Veranstaltung oder einem Reenactment. Die Truppe wirkte dabei absolut echt, falls es sich um so etwas handelte. Ich hatte zwar andere Probleme, aber es war beeindruckend, wie sie eine Kämpferpose am Waldrand einnahmen und mich schweigend ansahen. Diese Wiese gleichmäßig golden einzufärben, musste die Veranstalter ein Vermögen gekostet haben. Das Gras war trotzdem weich unter meinen Händen.
Die vier Gestalten standen weiterhin unbewegt darauf und hatten die Waffen hoffentlich nur zum Spaß dabei. Stellten sie hier friedlich etwas dar oder planten sie ganz andere Dinge? Die Utensilien sahen bedrohlich genug aus, und dass ich unter Kriegern aufgewachsen war, verstärkte in mir diesen Eindruck. Erst geschah nichts, ich sah die Leute an und sie sahen mich an. Schließlich war der Zeitpunkt gekommen, um mehr zu tun, als einander anzustarren.
***Ichfunktionierteeinfach.Das hatte ich das ganze letzte Jahr getan, warum nicht auch jetzt. Ein automatisches Kundenlächeln ging in die Richtung meiner Gesellschaft, obwohl sich mein Gesicht dabei fremd anfühlte. Angreifen konnte ich sie schlecht, für diese Erkenntnis brauchte ich nicht einmal meine militärische Familie. Sie waren in der Überzahl, und ich hatte keine Waffe. Simpel. Das Skalpell war nirgends in Sicht, trotzdem mein Schmuck und mein Abendkleid mich an diesen Ort begleitet hatten. Offenbar waren mir nur die Gegenstände geblieben, die ich berührt hatte. Das Messerchen lag auf dem Rand der Wanne und nicht in meiner Hand. Wo dann die Badewanne war, die hatte ich auch berührt. Aber das war ohne emotionale Bindung gewesen, während ich das Kleid und den Schmuck bewusst gewählt hatte… Halt, das reichte, ich musste nicht über Telekinese spekulieren, sondern sollte besser handeln.
Hier waren Menschen, deren Rollenspiel ich gestört hatte, und die mich gleich fragen würden, was ich auf ihrer Veranstaltung machte. Wenn es eine war. Was sollte ich ihnen dann sagen?
Eine Ausrede: Ich bin ein Überraschungsgast und zeige euch die Nebenquest.
Oder ehrlicher: Begleitet mich nach Southsea, da gehen wir zusammen in meine Wohnung und finden meinen Körper im Badezimmer. Mein morbides Kopfkino wollte nicht aufhören. Wäre der Körper überhaupt dort, oder war er hier bei mir? Gab es mich jetzt einmal als Verstorbene und einmal als Quest-Geber? Von schlaff und starr blieb ich nur noch schlaff. Plötzlich war ich wie aus Gummi. Ich sackte zusammen und vergrub mein Gesicht in den Händen. Sollten die anderen mich ansprechen, sollten sie doch irgendetwas machen. Entscheidungen traf ich besser nicht mehr, denn ich hatte gesehen, wohin sie mich führten.
***Die vier Gewandeten bildeten einen kleinen Ring um mich. Es überraschte mich, dass sie mir schon so nahe waren. Ich musste noch sehr benommen sein, weil ich gar nicht mitbekommen hatte, wie sie sich genähert hatten. Sie beobachteten mich intensiv, sprachen mich aber nicht an. Ich wollte sie fragen, wo ich hier war und wer sie waren, aber es kam nur ein kleines Krächzen aus meinem Mund, als hätte ich meine Stimme wochenlang nicht benutzt. Auch bei einem weiteren Versuch brachte ich lediglich einen leisen Laut zustande, aber keine Worte, mit denen ich mir Klarheit verschaffen konnte. Nach diesem zweiten Anlauf tat es weh. Daraufhin räusperte ich mich und fasste mir verwirrt an den Hals. Hoffentlich würden sie nun von sich aus aktiv, denn ich musste langsam wissen, was los war.
Einer der Männer ging vor mir in die Knie und betrachtete mich eindringlich. Er bewegte sich elegant, wirkte dabei aber vorsichtig, als ob er Rückenschmerzen hätte und etwas aufpassen müsste.
Wie ein viktorianischer Herrenclub duftete er nach kaltem Pfeifenrauch. Was immer er aufgelegt hatte, war betörend und roch noch besser als die Wiese. Gern hätte ich ihm gesagt, dass ich nicht zum Spiel gehörte und er das nervige Schweigen brechen konnte. Dass er ruhig dieses lange Schwert wieder weglegen durfte, das er gerade aus seinem Gürtel zog. Sein Rauchhauch umhüllte mich noch stärker, ich sog ihn unwillkürlich weiter ein und sah den Mann direkt an.
Dann vergaß ich meinen ungeäußerten Protest und starrte ihn direkt an, denn er war viel zu schön, um wieder wegzusehen. Das lag nicht unbedingt daran, dass er sich für seine Rolle zurechtgemacht hatte, denn er schien nicht geschminkt zu sein, und er trug auch keine Perücke. All die Pracht war echt. Tiefrote Haare umrahmten ein schmales, makelloses Gesicht mit einem herrischen Männermund. Er hatte hohe Wangenknochen und eine wohlgeformte Nase, die man nur „aristokratisch“ nennen konnte. Die Haare waren nach vorne gefallen und so lang, dass sie in roten Schlaufen zwischen uns im Gras lagen. Wie die hübschen Spiralen im Wasser meiner Badewanne.
Ein solches Antlitz war mir bisher noch nicht einmal im Fernsehen oder auf Instagram begegnet. Trotzdem wirkte der Mann nicht anziehend auf mich, und ich wurde weder angenehm nervös, noch wollte ich mir mit geöffneten Lippen flirtend durchs Haar fahren. Stattdessen war mir seine Gegenwart unangenehm. Er schaffte es wortlos, dass ich mich vor ihm unsicher fühlte, und das auch noch mit einem Unterton von Angst.
Unsere Blicke trafen sich, und ich sah aus nächster Nähe in seine Augen. Sie waren leuchtend golden mit einer viel zu großen Iris.
Ich hatte Kontaktlinsen ausprobiert und wusste, wie das aussah. Er trug keine. Den feinen Rand hätte ich sehen können, denn sein perfektes Gesicht war nur noch eine Handlänge von meinem entfernt. Diese riesigen Augen in einer unnatürlichen Metallfarbe hatte er offensichtlich nicht mit Hilfsmitteln erzeugt. Er hatte sie einfach, und noch verstörender als ihr Aussehen wirkte ihre Kälte.
Das hier war kein Rollenspiel.
***NiemandhattesolcheAugen. Niemand roch so gut. Niemand bewegte sich so schnell. Niemand jagte mir nur durch seine Gegenwart einen Schauer über den Rücken. Der Mann war womöglich gar kein Mann, sondern… was auch immer, ein Wesen aus dem Engelschor über uns. Oder das genaue Gegenteil. Dieses Wesen kniete vor mir auf einer Wiese, die kein Veranstalter eingefärbt hatte. Goldenes Gras, goldene Augen.
Ich war irgendwo, aber es war kein Ort, den ich kannte. Es schien auch kein Ort zu sein, der so war, wie ich es kannte. Hier gab es Wesen und Düfte und es war nicht Mittag. Meine Wunden und meine Stimme waren weg. Ich konnte nichts fragen, aber das war nicht mehr so schlimm, denn wollte ich die möglichen Antworten wirklich wissen? Hier war etwas grundlegend anders, als ich es gewohnt war und erwartet hatte. Ich war meine Welt gewohnt und hatte den Tod erwartet. Ihn selber herbeigeführt. Ich musste aus ihm erwacht, aber nicht wach geworden sein.
So einfach war das, und so furchtbar.
Noch nie hatte ich solche Angst empfunden wie in diesem Moment. Schmerz und Verzweiflung hatten mich hierhergebracht, aber dieses reine Entsetzen war mir neu.
Ich hatte angenommen, tot zu sein, und doch lebte ich. Es gab keine goldäugigen Wesen, und doch befand sich eines direkt vor mir. Mein Bewusstsein war da, aber wo war es und wie? Entweder träumte ich oder ich lag im Koma, und mein Kopf spann sich das alles dabei zusammen. Aber es wirkte absolut real. Das war endgültig mehr, als ich verarbeiten konnte. Mein Gehirn war komplett überfordert, und ein Teil von mir zog sich langsam aus der Situation zurück. Eine tiefe Schwere strömte in meinen Kopf. Ich gab ihr nach und fiel in die Dunkelheit, die ich mir gewünscht hatte, und in die mir keine Wesen folgen konnten.





























