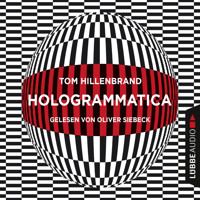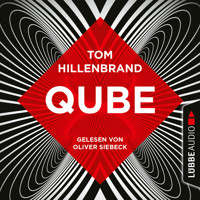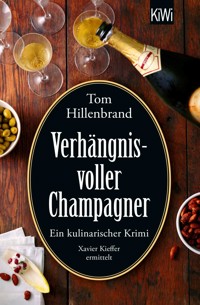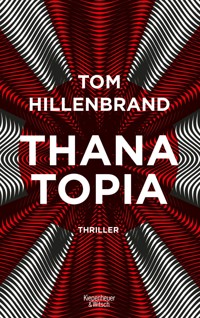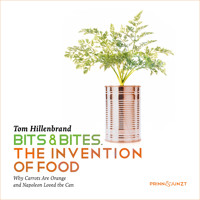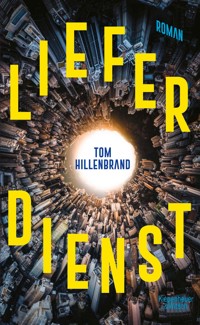9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Xavier-Kieffer-Krimis
- Sprache: Deutsch
Komm, süßer Tod. Als ein Imker zu Tode kommt und dessen Bienenstöcke verschwinden, beginnt der Luxemburger Koch Xavier Kieffer zu recherchieren. Hat der Tod mit dem weltweiten Geschäft mit dem Honig zu tun? Der ehemalige Sternekoch Xavier Kieffer lässt von einem Imker speziellen Honig aus der Luxemburger Unterstadt für sein Restaurant produzieren. Als der Mann plötzlich stirbt und seine Bienenstöcke nicht mehr aufzufinden sind, geht Kieffer der Sache nach. Gemeinsam mit seiner Freundin, der Gastrokritikerin Valérie Gabin, findet er sich schnell im Mittelpunkt eines gigantischen Skandals wieder, der um den halben Globus reicht und sowohl die Reinheit des Honigs als auch das Überleben der Bienen gefährdet. Können sie verhindern, dass der Weltmarkt mit gepanschtem Honig geflutet wird? Können sie ihren Widersachern das Handwerk legen, bevor es zu spät ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Goldenes Gift
Ein kulinarischer Krimi Xavier Kieffer ermittelt
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand, geb. 1972, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Ressortleiter bei SPIEGEL ONLINE. Seine Bücher stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, sie wurden vielfach übersetzt und ausgezeichnet, unter anderem mit dem Radio-Bremen-Krimipreis und dem Glauser-Preis.
www.tomhillenbrand.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der ehemalige Sternekoch Xavier Kieffer lässt von einem Imker speziellen Honig aus der Luxemburger Unterstadt für sein Restaurant produzieren. Als der Mann plötzlich stirbt und seine Bienenstöcke nicht mehr aufzufinden sind, geht Kieffer der Sache nach. Gemeinsam mit seiner Freundin, der Gastrokritikerin Valérie Gabin, findet er sich schnell im Mittelpunkt eines gigantischen Skandals wieder, der um den halben Globus reicht und sowohl die Reinheit des Honigs als auch das Überleben der Bienen gefährdet. Können sie verhindern, dass der Weltmarkt mit gepanschtem Honig geflutet wird? Können sie ihren Widersachern das Handwerk legen, bevor es zu spät ist?
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotive: © Andreas von Einsiedel / Alamy Stock Foto (Küche); © Ashraful Arefin photography / Getty Images (Honigglas mit Löffel)
Emojis unverändert von googlefonts/notoemoji (https://github.com/googlefonts/notoemoji/), © 2019 Google Inc. Licensed under the Apache License, Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE2.0)
ISBN978-3-462-32150-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Glossar: Küchenlatein
Leseprobe »Verhängnisvoller Champagner«
1
Genervt beäugte Pol Schneider das Display seines summenden Handys. Das war bereits der dritte Versuch binnen fünf Minuten. Die Nummer sagte ihm nichts, und auch sonst verspürte er wenig Lust, den Anruf anzunehmen. Pol saß gerade vor einem großen Teller Kartoffelsuppe, und die Mittagspause war ihm heilig.
Das Telefon hörte auf zu summen. Schneider nahm noch einen Löffel Suppe, brummte voller Genugtuung. Sollte der Typ ihm doch die Box vollquatschen. Er würde sich irgendwann später melden.
Erneut begann das Handy zu vibrieren. Einen Fluch murmelnd legte Pol den Löffel beiseite und nahm das Gespräch an.
»Beienbourg, moien. Pol Schneider.«
»Bonjour, Monsieur Schneider«, sagte eine Frau am anderen Ende.
»Mein Name ist Jessica Rawley. Ich möchte … es geht um den, die …«
Man hörte, dass ihr das Französische nicht leicht von den Lippen ging.
»Lieber Englisch?«
»Ja, bitte.«
»Kein Problem. Was kann ich für Sie tun, Mrs Rawley?«
»Es geht um die Bienen. Bei uns auf dem Dach. Mit denen stimmt was nicht.«
Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Silverstein Green.«
Schneider wusste, von welchem Gebäude die Rede war. Die US-Investmentbank Silverstein Green saß auf dem Kirchberg, in einem großen gläsernen Klotz mitten im Luxemburger Finanzdistrikt. Auf dem Dach des Gebäudes lebten einige seiner Bienenvölker.
»Was ist denn mit ihnen?«, fragte Schneider.
»Ich glaube, sie sterben. Da liegen überall tote Bienen herum.«
»Die liegen vor den Beuten?«
»Den was?«
»Den Bienenstöcken.«
»Ja, genau«, erwiderte Rawley, »Dutzende, alle verendet.«
»Das ist ganz normal.«
»Sind Sie sicher? Es wäre uns lieber, wenn Sie mal nachschauen.«
Schneider seufzte leise. Seit über 25 Jahren imkerte er. Als er damit begonnen hatte, waren Bienen noch ein exzentrisches Hobby für Landeier gewesen. Inzwischen lag Imkern jedoch im Trend, auch und gerade in den Städten. Nicht nur Privatleute hielten sich inzwischen Bienenvölker, auch Unternehmen wie Silverstein hatten das Thema für sich entdeckt. Bienen waren Sympathieträger. Wer ihnen auf dem Dach seines Bürohauses oder seiner Fabrik ein Zuhause bot, den sah die Öffentlichkeit in einem freundlicheren Licht. Aber natürlich wollte sich keiner dieser Investmentbanker die Finger klebrig machen. Und da kam er ins Spiel. Schneider stellte Beuten auf, sah regelmäßig nach dem Rechten, schleuderte am Ende die Waben und füllte einen mit speziellem Etikett versehenen Haushonig ab, den der Kunde an Mitarbeiter oder Geschäftspartner verschenken konnte. Für Schneider war das ein einträgliches Geschäft.
Der Nachteil an der Sache war, dass er sich mit der Unbedarftheit von Klienten herumschlagen musste, die kaum Bienen und Wespen auseinanderhalten konnten.
»Mrs Rawley, wir haben Februar. Das heißt, dass die Bienen noch Winterpause machen.«
»Und?«
»Ihnen ist zu kalt, sie bleiben schön im Stock, schließen sich zu einer Wintertraube zusammen, in deren Innerem die Königin gewärmt wird. Sie fliegen nicht viel aus. Und dass Sie vor den Kästen tote Bienen finden, ist ein gutes Zeichen.«
»Wie können tote Tiere ein gutes Zeichen sein?«
»In jedem Stock befinden sich über fünfzigtausend Bienen. Da sterben ständig welche. Die Arbeiterinnen bringen sie zum Einflugloch, werfen sie raus.«
»Das ist ja schrecklich!«
»Das ist das Leben. Sorgen müssen Sie sich machen, wenn keine toten Bienen vor dem Stock liegen. Das würde nämlich bedeuten, dass der Selbstreinigungsmechanismus der Kolonie nicht funktioniert.«
»Ich verstehe. Könnten Sie vielleicht trotzdem mal schauen?«
Erneut seufzte er, diesmal laut genug, dass seine Gesprächspartnerin es hören konnte.
»Hören Sie, ich sage Ihnen doch, Sie machen sich unnötig Sorgen. Es ist auch gar nicht gut, die Bienen im Winter zu stören. Sie verlieren zu viel Wärme und …«
»Es ist nur so«, unterbrach sie ihn, »dass unser Chef persönlich darum gebeten hat. Mr Wright geht immer zum Rauchen rauf aufs Dach, und da ist ihm das aufgefallen.«
Allmählich verstand Schneider. Es handelte sich nicht um ein Bienen-, sondern um ein Bossproblem. Diese Rawley hatte Druck von oben bekommen, deswegen war sie so hartnäckig. Und Schneider hatte allen Ernstes gedacht, die Frau sorge sich um das Wohl der Bienen.
Er überlegte kurz. Am Nachmittag hatte er etwas in der Innenstadt zu erledigen. Vorher im Finanzviertel vorbeizufahren, stellte keinen großen Umweg dar.
»Ich werde Ihnen aber zusätzlich die Anfahrt berechnen müssen«, hörte er sich sagen. »Das liegt nicht auf meiner Route, ich komme derzeit nur selten in die Stadt.«
»Das wäre kein Problem. Wichtig ist nur, dass jemand kommt.«
Wichtig ist, dass du deinem Chef sagen kannst, dass jemand kommt, dachte Schneider.
»Alles klar, Mrs Rawley. Dann schaue ich heute Nachmittag vorbei.«
»Gut, ich melde Sie am Empfang an.«
»Nicht nötig, die kennen mich ja. Ich fahre einfach hoch.«
»Und Sie geben mir danach eine Rückmeldung?«
Schneider bejahte es, notierte sich Rawleys E-Mail-Adresse. Er legte auf und machte sich über den Rest der Suppe her, die leider nur noch lauwarm war. Dennoch löffelte er sie tapfer aus.
Dann stand er auf, griff sich Jacke und Autoschlüssel. Als er aus dem Haus trat, zog er reflexartig die Schultern hoch. Der Himmel war bleigrau. Es war einer dieser Februartage, an denen es selbst mittags noch nicht richtig hell war. Besser, er erledigte die Silverstein-Sache, bevor das Tageslicht ganz verschwand. Im Dunkeln auf einem nassen, eiskalten Hochhausdach herumzuturnen, war etwas, worauf er gerne verzichten konnte.
Schneider ging zu einem Lieferwagen, der vor dem Gebäude stand. Das alte Bauernhaus, in dem er wohnte, lag im Norden Luxemburgs, in einer dünn besiedelten Region namens Ösling. Die umliegenden Felder, die seinem Vater und davor dessen Vater gehört hatten, hatte Schneider bereits vor Jahren an die Nachbarn verkauft. Übrig geblieben waren nur das Haus und eine Scheune.
Er stieg ein und ließ den Motor an. Eine knappe Stunde später erreichte Schneider den Kirchberg. Er parkte in einer Seitenstraße der Kennedy, jener breiten Avenue, die das Finanzzentrum wie mit dem Lineal gezogen durchschnitt. Dem Kofferraum entnahm er seine Ausrüstung: Handschuhe, Besen, Schleierhaube. Schneider verzichtete darauf, einen kompletten Schutzanzug mitzunehmen. Honigbienen waren weitaus weniger aggressiv, als die meisten Menschen glaubten. Ein erfahrener Imker konnte viele kleinere Verrichtungen durchführen, ohne gestochen zu werden.
Am Empfang von Silverstein ließ sich Schneider eine Keycard aushändigen. Er stieg in den Lift und hielt die Karte gegen einen Sensor, bevor er die Taste mit der »8« drückte. In der obersten Etage befanden sich mehrere Konferenzräume sowie eine Treppe, über die man auf das Flachdach des Gebäudes gelangte.
Wenige Minuten später war er dort oben und sah sich um. Neuere Bürohäuser besaßen meist umfänglich begrünte Terrassen. Dieses hingegen stammte aus den Neunzigern, das Dach war eine Steinwüste. Kies bedeckte den Boden, es gab weder Pflanzen noch Sitzgelegenheiten. Das einzig Auffällige waren die hellgrünen Holzkisten, die am Rande standen.
Schneider zog seine Imkerhaube über und hielt einen Moment inne. Der Himmel schien ihm noch grauer als zuvor, feiner Nieselregen hatte eingesetzt. Bei gutem Wetter hatte man von hier oben einen hervorragenden Ausblick, konnte die Avenue Kennedy entlangschauen bis zu den Gebäuden des Europaviertels. Heute erahnte man die markanten Türme des Europäischen Gerichtshofs höchstens.
Er streifte seine Handschuhe über und ging auf die Holzkisten am anderen Ende des Dachs zu. Insgesamt waren es zwölf Stück, säuberlich aufgereiht und auf hölzernen Sockeln stehend, damit sich die Einfluglöcher nicht zu nah am Boden befanden. Es waren keine Bienen in der Luft, was ihn nicht wunderte. Die Ladys machten Winterpause, und bei Regen kamen sie ohnehin ungern hervor. Ansonsten schien alles in bester Ordnung. Alle Kisten standen, wo sie stehen sollten. Als Schneider die Beuten erreichte, kniete er sich nieder, untersuchte den Boden vor den Ausfluglöchern. Wie Rawley gesagt hatte, lagen dort zahlreiche tote Bienen. Angesichts der Dutzenden Völker, die auf dem Dach von Silverstein nisteten, war die Anzahl jedoch keineswegs besorgniserregend.
Schneider las ein paar Insektenleichen auf. Es waren Arbeiterinnen darunter, aber auch Drohnen, zu erkennen an ihren größeren Augenpartien. Er holte eine Juwelierlupe aus der Jackentasche, klemmte sie sich vors rechte Auge. Nun konnte er jede Einzelheit erkennen – den braunen, pelzartigen Flaum, der Körper und Kopf bedeckte, die geäderten Flügel, die Antennen. Schneider untersuchte einige Tiere, hielt Ausschau nach Anzeichen für Pilzinfektionen oder Milbenbefall. Aber diesen Bienen fehlte nichts. Sie waren im biblischen Alter von sechs oder sieben Monaten sanft entschlafen.
Nicht zum ersten Mal fragte Schneider sich, ob es wohl einen Himmel für Bienen gab und wie dieser wohl aussah. Vermutlich handelte es sich um eine endlose, auf immerdar in goldenes Licht getauchte Blumenwiese.
Der Regen nahm zu. Schneider steckte die Lupe weg, richtete sich wieder auf. Er würde Rawley eine Mail schreiben, ihr versichern, dass alles tipptopp sei und dafür eine fette Rechnung stellen. Schon wollte er sich von den Stöcken abwenden, als ihm an einem davon etwas auffiel. Unterhalb der Fluglöcher war ein kleiner Steg angebracht, quasi eine Landeplattform. Auf einem davon lag eine tote Biene. Sie war etwas größer und länger als die Arbeiterinnen.
Schneider runzelte die Stirn. Er schaute sich die Biene genauer an. Die Falten auf seiner Stirn wurden tiefer. Er linste in das Flugloch der fraglichen Beute, leuchtete mit der Taschenlampe hinein.
»Das kann doch nicht wahr sein!«
Möglicherweise würde er doch die ganze Ausrüstung brauchen. Er musste alle Bienenstöcke kontrollieren – nicht nur die von Silverstein, auch die anderen.
Er wandte sich von den Stöcken ab, um seinen Imkeranzug sowie einen Stockmeißel zu holen. Letzteren benötigte er, um die mit Wachs verklebte Beute zu öffnen. Schneider lief auf die Tür zu, zückte währenddessen sein Handy, wählte und stieß auf eine Mailbox:
»Hier spricht Xavier Kieffer. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.«
»Xavier, hier ist Pol, Pol Schneider. Ich müsste mal vorbeikommen, Vorbereitungen für die … die Honigsaison. Liegt der Schlüssel an der üblichen Stelle oder hast du den? Kann ich mir den gleich holen? Ruf mich zurück, okay?«
Schneider legte auf, drückte die Klinke der Treppenhaustür hinunter. Verdutzt nahm er zur Kenntnis, dass sie verschlossen war. Er probierte es erneut, kramte dann die Keycard hervor, die der Pförtner ihm ausgehändigt hatte. Doch obwohl er sie mehrfach vor den Sensor hielt, blieb das erhoffte ›Klack‹ aus.
»So ein Scheißdreck.«
In seiner Anrufliste suchte er die Nummer dieser Silverstein-Tante heraus. Es klingelte vier, fünf Mal, bevor eine Mailbox ansprang. Entnervt legte Schneider auf. Gerade wollte er die Nummer der Silverstein-Telefonzentrale heraussuchen, als ein stechender Schmerz seinen Arm durchfuhr. Schneider kannte das Gefühl nur zu gut, es gehörte zu seinem Job. Eine Biene musste ihn gestochen haben. Dennoch war er derart überrascht, dass er sein Telefon fallen ließ. Da er einen Pullover und eine Jacke trug, musste sie in den Ärmel gekrochen sein, das war die einzige Erklärung. Schneider schüttelte den Arm, zog das Jackenbündchen auseinander.
»Wie bist du da reingekommen? Und bei dem Wetter?«
Schneider beugte sich nach vorn, um das Handy aufzuheben. Als er wieder hochkam, war ihm ein wenig schwindlig. Der Imker presste eine Hand gegen die Brandschutztür, atmete ein paarmal durch. In den Ohren rauschte und summte es, so als ob Hunderte Bienen seinen Kopf umschwirrten.
Mit einiger Mühe entsperrte er das Handy. Gerade wollte er Rawling erneut anrufen, als er aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Schneider drehte sich um. Höchstens drei Meter von ihm entfernt stand eine Gestalt. Sie trug einen Imkeranzug – Overall, Handschuhe und Mütze. Wegen des Schleiers konnte Schneider das Gesicht nicht ausmachen.
»Was zum Teufel ist hier los? Was wollen Sie?«
Die Gestalt bewegte sich auf ihn zu. Schneider presste den Rücken gegen die Metalltür. Er fühlte, wie seine Knie nachgaben. Das Handy glitt ihm aus der Hand.
Die Person im Imkeroutfit war höchstens noch einen Meter von ihm entfernt. Schneider konzentrierte sich auf den Schleier. Nun konnte er durch das hauchdünne Material hindurchblicken. Das Gesicht dahinter war dennoch nicht auszumachen – er sah lediglich eine Schutzbrille und eine Atemmaske.
Schneider rutschte mit dem Rücken an der Tür entlang, fiel zu Boden. Das Letzte, was er sah, war die verschleierte Gestalt, die sich über ihn beugte.
2
Pekka Vatanen schnäuzte vernehmlich in ein Papiertaschentuch. Xavier Kieffer, der auf der anderen Seite der Theke stand, wandte den Blick ab, damit ihm der zweite Akt erspart blieb. Der Finne besaß die Angewohnheit, nach dem Naseputzen stets in sein Taschentuch zu schauen. Der Koch fragte sich, was Vatanen dort wohl vorzufinden erwartete. Eine geheime Botschaft? Eine Marienerscheinung?
Kieffer polierte Gläser. Als er wieder aufsah, schenkte sich Vatanen gerade Rivaner aus der Flasche ein, die in einem Kühler neben ihm stand.
»Soll ich dir vielleicht lieber einen Tee machen, Pekka? Bei der Erkältung.«
Der Finne schüttelte den Kopf, rieb sich die rötliche Nase. Die Färbung mochte mit dem Schnupfen zusammenhängen oder aber mit dem Wein. Vatanen war bereits bei der zweiten Flasche.
»Wein ist gut gegen Schnupfen.«
»Tee mit Honig wäre besser.«
»Glaube ich nicht. Mein Geschniefe ist ja allergisch.«
Kieffer nickte abwesend, ließ den Blick durch den gut gefüllten Schankraum schweifen. Das »Deux Eglises«, dessen Koch und Besitzer er war, servierte vor allem Luxemburger Spezialitäten. Diese waren in der Regel deftig: Schweinenacken mit Saubohnen, Eintöpfe, Kartoffeln in jeder erdenklichen Zubereitungsform. Das nasskalte Februarwetter kam ihm entgegen. Bei zwei Grad und Nieselregen wollten die Leute keinen Salat und kein Sushi, sondern etwas, das sie warm hielt.
»Vielleicht eine heiße Suppe, Pekka?«
»Das schon eher.«
»Ich habe Bouneschlupp, Ënnenzopp und Gehäck.«
»Bohne, Zwiebel und das Letzte ist was?«
»Eine Fleischsuppe mit Lunge, Leber und Herz.«
»Uh, nein, danke. Dann nehme ich die Zwiebelsuppe.«
Kieffer nickte, ging zum Küchentelefon neben dem Speiseaufzug und gab die Bestellung durch. Das »Deux Eglises« befand sich in einem alten Garnisonsgebäude, das nicht sehr groß war. Der Schankraum lag im Erdgeschoss, die Küche im ersten Stock.
Kieffer ging zurück zur Bar, goss sich ebenfalls einen Schluck Wein ein.
»Prost, Pekka.«
»Kippis!«
»Meinetwegen auch das. Aber sag mal«, Kieffer deutete auf die halb leere Packung Papiertaschentücher neben Vatanens Weinglas, »das ist doch nie im Leben eine Allergie. Jetzt blüht doch nichts.«
»Du bist wohl kein Allergiker, was?«
»Nie einer gewesen.«
»Seit es keine richtigen Jahreszeiten mehr gibt, plagt einen der Mist das ganze Jahr, Hasel und Erle früher, Gräser später. Außerdem Staubmilben – die blühen im Winter richtig auf, sozusagen. Die Klimaanlage im Büro ist uralt, die verteilt es im ganzen Gebäude.«
Vatanen arbeitete auf dem Kirchberg, in der Forschungsabteilung des Europäischen Parlaments. Sein Gebäude gehörte zu den ältesten im Europaviertel. Dennoch hielt der Koch die Allergiegeschichte für Unsinn. Sein Freund wollte sich einfach nicht eingestehen, dass er ins Bett gehörte, anstatt sich an Kieffers Tresen zu betrinken.
Dem Finnen entfuhr ein Nieser. Ein weiteres Taschentuch kam zum Einsatz.
»Du kriegst jetzt einen Tee«, murmelte Kieffer kopfschüttelnd.
»Ich sage dir doch, es ist allergisch. Sieht man am Auswurf.«
Vatanen machte Anstalten, Kieffer das geöffnete Taschentuch hinzuhalten. Der Koch zog eine Grimasse, winkte ab. Einem der Schränke entnahm er einen gläsernen Becher, stellte ihn unter den Heißwasserhahn der Espressomaschine.
»Kamille oder Verbene?«, fragte er.
»Pest oder Cholera?«, erwiderte Vatanen.
Kieffer ignorierte den Einwurf, tat einen Beutel in das heiße Wasser. Er stellte die Tasse vor Vatanen auf die Theke. Daneben platzierte er ein Glas Honig. Auf dem Etikett war ein Logo mit zwei blauen Kirchturmspitzen zu sehen.
»Was ist das jetzt wieder?«
»Honig, Pekka?«
»Schon klar. Sieht aber nicht nach Langnese aus. Was steht da? ›Ënnerstad-Hunneg. Vun Lëtzebuerger Beien‹.«
Kritisch musterte der Finne das Honigglas.
»Was ist los, Pekka?«
»Und der stammt aus der Unterstadt?«
»Die Bienenstöcke stehen die Straße runter, in einem Garten am Hang. Sie gehören mir.«
»Du imkerst?«
Kieffer schüttelte den Kopf.
»Ich habe einen Deal mit einem Stadtimker.«
»Er kümmert sich um die Bienen?«
»Um alles, eigentlich. Ich habe die Stöcke finanziert, er schleudert die Waben aus, füllt das Zeug ab, produziert mir meinen eigenen Honig.«
»Und damit kann man Geld verdienen?«
»Es geht. Ich habe den«, Kieffer zeigte auf eine Vitrine neben der Theke, »bei den örtlichen Spezialitäten stehen. Die Touristen mögen so was.«
Dem Koch fiel ein, dass er Schneider demnächst anrufen musste. Der Imker schuldete ihm noch Honig. Das, was er bisher geliefert hatte, entsprach nicht der vereinbarten Menge. Sechs Kisten war ihm Pol Schneider noch schuldig.
»Stehen die Bienenstöcke«, Vatanen deutete mit dem Daumen in Richtung Kirchberg, »da hinten? Sind mir nämlich bisher nicht aufgefallen.«
»Da ist kaum Platz, ist mir außerdem zu nah an der Gästeterrasse. Die stehen oben, an der Einbiegung zur Rue Malakoff.«
»Das große Grundstück an der Ecke?«
»Genau. Gehört einem Bekannten von mir. Wir haben …«
»… einen Deal gemacht, schon klar.«
»Drüben in Grund, nahe der Abbaye de Neumünster hat Pol auch noch welche, aber die gehören nicht mir.«
Vatanen nickte. »Da am Flusslauf wächst einiges. Gute Stelle. Wenn’s denn stimmt.«
»Wie meinst du das?«, fragte Kieffer.
Anstatt zu antworten, schraubte Vatanen das Glas auf, fuhr mit dem Teelöffel hinein. Er träufelte reichlich Honig in den dampfenden Becher. Danach führte er den Löffel zum Mund und schleckte ihn ab.
»Und? Kannst du die Hanglage herausschmecken, Pekka?«
Der Finne verzog keine Miene.
»Bei Honig vermag ich das nicht.«
Vatanen trank einige Schlucke Tee. Dann schob er den Becher weg und griff wieder nach seinem Weinglas. Kieffer zuckte mit den Achseln und verabschiedete sich. Er musste in die Küche. Zunächst ging er jedoch hinaus auf die Terrasse des Restaurants, um eine Zigarette zu rauchen. Das »Deux Eglises« befand sich in Clausen, einem der Luxemburger Unterstadtviertel. Hinter dem alten Steingebäude erhob sich der Hang des Kirchbergs. Zur Straße hin fiel das Gelände weiter ab, sodass man auf die Dächer und Türmchen der ville basse hinabschauen konnte. Der Regen hatte inzwischen nachgelassen, und so konnte man auch die beiden Kirchen ausmachen, nach denen das »Deux Eglises« benannt war: die nur wenige Schritte entfernt liegende Sainte Cunégonde und die auf dem Bockfelsen thronende Notre Dame.
Kieffer rauchte eine Ducal und stieg danach die Treppe zur Küche hinauf. Als Erstes nahm er die Magnettafel neben dem Speiseaufzug in Augenschein, auf der die Tische und die Gangfolgen mit farbigen Magneten gekennzeichnet waren. Unter fast jedem davon klebte ein Zettel. Der Koch hörte jemand etwas auf Französisch rufen – seine Souschefin Claudine. Sie klang unzufrieden. Vielleicht ging ihr etwas nicht schnell genug, vielleicht war ein Teller nicht zu ihrer Zufriedenheit. Er ging zum Pass, jener Stelle, wo die servierfertigen Teller unter Wärmelampen standen. Claudine war gerade dabei, zwei Teller Kanéngchen mat Moschterzooss zu inspizieren. Mit einem Tuch wischte sie Soßenspritzer fort und rief »Sauberer arbeiten!« in Richtung eines Postenkochs.
»Wie sehen wir aus?«, fragte er.
»Wie ein Restaurant, das seine Gäste zu lange auf ihr Essen warten lässt, so sehen wir aus.«
Kieffer murmelte etwas Unverständliches und ließ Claudine ihre Arbeit machen. Er lief einmal durch die Küche, schaute Postenköchen über die Schulter, guckte in Töpfe und Öfen. Als er wieder den Pass erreichte, sah er eine mit Käse gratinierte Suppenterrine, die auf den Abtransport wartete.
»Die mache ich selbst«, sagte er zu Claudine gewandt, »danach übernehme ich am Pass.«
Seine Souschefin antwortete nicht. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt vier Tellern Judd mat Gaardebounen, an denen ihr irgendetwas missfiel.
Kieffer nahm die Zwiebelsuppe und trug sie hinunter zur Bar. Er stellte sie vor Vatanen ab, der gerade durch sein Handy scrollte. Der Koch konnte nicht umhin zu bemerken, dass der Tee ungetrunken auf der Theke stand.
»Deine Suppe, Pekka.«
»Ah, danke.«
»Was Interessantes?«, fragte Kieffer und deutete auf Vatanens Handy. Darauf war eine US-Nachrichtenseite geöffnet.
»Bei den Amis brennt’s.«
»Politisch?«
»Nein, in Kalifornien. Waldbrände, alles fackelt ab.«
»Ich weiß. Valérie hat mir Fotos geschickt.«
Kieffers Freundin Valérie Gabin war Französin. Sie wohnte nicht in Luxemburg, sondern in Paris. Das war zwar nicht allzu weit weg, dennoch sah er sie in letzter Zeit nicht oft. Valérie war andauernd auf Achse, zuletzt hatte sie Japan besucht, nun befand sie sich in Kalifornien, falls sie nicht schon weitergereist war. Kieffer hatte mitunter Schwierigkeiten, den Überblick über ihre Reisepläne zu behalten.
»Valérie ist in Kalifornien? Und was macht sie da?«
»Dasselbe wie immer, denke ich. Restaurants testen.«
»Aber ich dachte, das mit dem Gabin hat sich erledigt?«
Vatanen hatte den gratinierten Toast von der Terrine gekratzt und war dabei, die Suppe auszulöffeln. Genauer gesagt inhalierte er sie. Kieffer fand, dass seine Ënnenzopp mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, sagte aber nichts. Stattdessen wandte er den Blick einem Regal hinter der Theke zu, in dem mehrere Restaurantführer standen – einige Ausgaben des Levoir-Brillet, ferner etliche Bücher in kobaltblauem Einband. Jeder Freund guten Essens kannte sie, es handelte sich um Ausgaben des Guide Gabin, jenes legendären Pariser Gastroführers, der seit beinahe hundert Jahren Sterne an die besten Restaurants der Welt vergab oder genauer gesagt: vergeben hatte.
»Erledigt würde ich nicht sagen, Pekka.«
»Aber ist Valérie denn immer noch die Chefin? Ich dachte, der Guide ist pleite.«
Der Guide Gabin war von Valéries Großvater Auguste gegründet worden. Lange hatte er als die Bibel der haute cuisine gegolten, doch am Ende war das Geschäftsmodell, bei Drucklegung bereits veraltete Restaurantkritiken in ledergebundenen Büchern zu veröffentlichen, völlig überholt gewesen. Valérie hatte jahrelang versucht, das Erbe ihrer Familie zu bewahren, aber am Ende machten Internet und Smartphones ihrem Verlag den Garaus.
»Ist er auch. Aber es gibt eine US-Bewertungsplattform, die den Guide gekauft hat, Delish heißen die.«
»Nie gehört«, sagte Vatanen.
»Genau deshalb haben sie’s gemacht. Die wollten den Markennamen. Delish heißt jetzt gabin.com. Aber der Guide Bleu, also die Bücher, die sind Geschichte.«
»Und Valérie?«
»Besitzt noch eine Minderheitsbeteiligung und ist dort … Moment, ich hab’s hier irgendwo.«
Kieffer wühlte hinter der Bar in einem Stapel aus Notizblöcken, Postkarten und Quittungsbelegen. Nach einigem Suchen platzierte er eine kobaltblaue Visitenkarte auf der Theke. In weißen Lettern stand darauf »Gabin.com«, und darunter: »Valérie Gabin, Editor-at-Large«.
»Aha. Und was bedeutet das?«
»Ich glaube, es bedeutet, dass sie Narrenfreiheit hat. Sie reist auf deren Kosten herum, testet Restaurants oder schreibt Artikel für Delish, ich meine den Gabin. Die veröffentlichen nämlich auch Reportagen, Produkttests, was weiß ich.«
»Ministerin ohne Portfolio, quasi? Macht mich ein bisschen neidisch.«
Vatanen war Beamter mit dem Schwerpunkt EU-Agrarpolitik. Kieffer hatte oft den Eindruck, dies sei ein ziemlich geruhsamer Job.
»Du tust gerade so, als würdest du andauernd von deinem Chef terrorisiert«, sagte er.
»Werde ich auch. Du machst dir keine Vorstellung. Da hat es deine Freundin besser.«
Valérie war Mehrheitseigentümerin und Chefredakteurin des Guide Gabin gewesen. Inzwischen hatte man die Pariser Zentrale abgewickelt, alle Restaurantinspektoren entlassen. Kieffers Freundin war nun Angestellte eines Silicon-Valley-Unternehmens. Es stand außer Frage, dass sie aufgrund ihres Nachnamens keine gewöhnliche Mitarbeiterin war. Ein Abstieg war es trotzdem.
»Stimmt schon, keiner sagt ihr, was sie zu tun hat. Aber sie hat auch nichts mehr zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie glücklich damit ist.«
»Was sagt sie denn selbst?«
»Nicht viel. Sie arbeitet sehr verbissen.«
Vatanen schob die leere Terrine beiseite.
»Also wie eh und je. Und ich hätte gedacht, die Sache hätte sie vielleicht verändert.«
Kieffer starrte die kobaltblaue Visitenkarte an. Wenn einem das väterliche Firmenimperium und damit die bisherige raison d’être abhandenkam, war man vermutlich nicht mehr dieselbe. Zwar konnte er an Valérie bisher keine gravierenden Veränderungen erkennen. Aber sein Gefühl sagte Kieffer, dass in ihr etwas in Bewegung war. Fragen dazu verkniff er sich inzwischen allerdings, da Valérie diese stets mit einem passiv-aggressiven »Nein, wieso? Alles prima« beantwortete.
Vatanen musterte ihn.
»Du weißt es nicht?«
»Nicht so richtig. Sie stand ja immer im Rampenlicht, als Chefredakteurin, Gabin-Erbin. Und ich hätte gedacht, jetzt, wo sie das von der Backe hat, geht sie es ruhiger an. Nutzt die Chance, mal etwas im Hintergrund zu bleiben.«
Pekka Vatanen lachte leise.
»Was?«
»Dass die mal lockerlässt, würde mich wundern.«
Kieffer holte sein Handy hervor, entsperrte es und navigierte zu einer Social-Media-App. Vatanen runzelte die Stirn.
»Mister Retro hat jetzt Instagram?«
Kieffer öffnete die App, tippte etwas und hielt sie Vatanen hin.
»Ach so, Valérie hat da einen Account.«
Der Finne wischte mit dem Finger durch die Fotos.
»Die postet ja einiges. Tokio, Osaka, Los Angeles, Sacramento …«
Vatanen gluckste vergnügt. »Sieht so aus, als wärst du neuerdings mit einer Influencerin zusammen, Xavier.«
»Sehr witzig, Pekka.«
»Es ist witzig.«
Kieffer war sich nicht sicher, ob er dem Finnen zustimmte. Seine Freundin und er waren schon immer grundverschieden gewesen: die weltgewandte französische Gastrokritikerin aus gutem Hause und der etwas einsiedlerische Koch, der sein Unterstadtquartier nur ungern verließ. Aber nun schien es ihm manchmal, als wären sie unterschiedlicher denn je.
Kieffer verabschiedete sich von Vatanen, ging zurück in die Küche. Währenddessen scrollte er durch Valéries Einträge. Der letzte zeigte ein endloses Feld. Darauf waren Bäume mit weißen Blüten zu sehen. Und inmitten dieser Pracht stand Valérie, strahlte in die Kamera. Der Beschreibung zufolge war das Bild nahe Yuba City aufgenommen worden – wo auch immer das war.
»Ich bin mir nicht mal ganz sicher, auf welchem Kontinent du gerade bist«, murmelte er.
Auf der Mitte der Treppe blieb er stehen. Sein Zeigefinger schwebte über dem Display. Kurz überlegte er, ob er das Like-Herzchen drücken sollte. Dann steckte er das Handy in die Hosentasche und machte sich an die Arbeit.
3
Valérie Gabin nippte an ihrem Weißwein und beobachtete die anderen Gäste. Schätzungsweise die Hälfte der Anwesenden waren Amerikaner, dazu kamen Europäer, Japaner sowie einige wenige Südamerikaner. Bevor sie mit jemandem redete, wettete Valérie jedes Mal mit sich selbst, woher ihr Gesprächspartner wohl stammte. Meist war es einfach zu erraten. Die amerikanischen Frauen erkannte man an ihren üppigen Mähnen, die Männer an ihren zu weit geschnittenen Anzügen. Bei den Europäern war es etwas schwieriger, vor allem, wenn sie schon länger in Kalifornien lebten.
Lag Valérie richtig, durfte sie eine Zigarette rauchen – das Ratespiel war ein Versuch, ihren Tabakkonsum etwas einzuschränken. Bislang ohne Erfolg, ihre Erfolgsrate war zu hoch. Vermutlich musste sie sich etwas Schwierigeres ausdenken.
Ein Kellner hielt ihr ein Tablett mit Horsd’oeuvres hin. Es handelte sich um blassgrüne Keramiktellerchen, auf denen jeweils eine buttergelbe Blüte lag, die wie eine Sonnenblume aussah, jedoch deutlich kleiner war. Valérie trat näher heran. Bei genauerer Betrachtung entpuppten sich die Blumen als kulinarische Kunstwerke. Die gelben Blütenblätter waren echt, bei dem braunen Stempel in der Mitte handelte es sich um ein Häuflein gekochter Dupuy-Linsen. Bei dem dunkelgrünen Etwas am Rand, das sie zunächst für ein Blatt gehalten hatte, handelte es sich um einen kunstvoll geformten Keks.
Sie nahm einen der Teller. Blumen oder Blätter aus Lebensmitteln nachzubilden, war in den Achtzigern der letzte Schrei gewesen. Aber heute? Valérie probierte die Linsen. Sie waren in Balsamico gekocht worden oder vielleicht in einer süßlichen Sojasoße. Das Keksblatt enthielt Matcha, zerstoßenen grünen Tee. Widerwillig musste sie eingestehen, dass die säuerlichen Linsen und der süßliche Matcha eine interessante Geschmackskombination bildeten.
Überraschend war das eigentlich nicht. Für das Dinner zeichnete ein japanischstämmiger Däne namens Aksel Akutagawa verantwortlich, der im Guide vor einigen Jahren zwei Sterne erhalten hatte. Inzwischen betrieb er das »Milas« in Red Bluff, einem kleinen Ort an der Westküste. Willinon hatte sie darauf hingewiesen, dass Akutagawas neuer Laden einen Besuch wert sei. Ihm zufolge war die dort servierte Fusion aus skandinavischer und japanischer Küche einzigartig. Deshalb waren sie an diesem Abend hier.
Sie wandte den Blick in Richtung der großen Terrasse. Durch deren Glaspaneele konnte sie Cesar Lee Willinon sehen. Angeregt unterhielt er sich mit einem asiatisch aussehenden Mittdreißiger. Willinon hatte mit Software Milliarden gescheffelt, aber seine Passion galt gutem Essen. Als der Guide Gabin pleiteging, rettete der Amerikaner ihn – oder »schändete dessen Leiche«, wie »Le Monde« nach der Übernahme geschrieben hatte. Beide Deutungen hatten etwas für sich. Valérie Gabin war sich selbst nicht ganz sicher, welcher sie zuneigte.
Unbestreitbar schien, dass der Gabin ohne Willinons Millionen sang- und klanglos untergegangen wäre. Die Banker hatten am Ende nicht einmal mehr abgenommen, wenn Valérie wegen neuer Kredite anrief. Klar war allerdings auch, dass unter Willinons Führung kein Stein auf dem anderen blieb. Diese Soiree war das beste Beispiel dafür. Nach dem Dinner würden sie die Blue List enthüllen, eine Rangliste der hundert besten Lokale der Welt.
Valérie war dagegen gewesen. Seit seiner Gründung anno 1921 vergab der Gabin Sterne. Einen für gute Küche, zwei für herausragende und drei für Restaurants, die eine ganze Reise wert waren. Nie hatte der Guide Köche oder Lokale gegeneinander aufgewogen, was bei einer Liste zwangsläufig der Fall sein würde. Es konnte nur eine Nummer eins geben, aber war der Italian Laundromat im Napa Valley wirklich besser als La Nave Bianca in Alba? Oder servierten beide einfach unterschiedliche, jedoch gleichsam geniale Interpretationen italienischer Klassiker?
Sie hatte dies ihrem Geschäftspartner (ihn als ihren Vorgesetzten zu betrachten, kam Valérie nicht in den Sinn) auseinandergesetzt. Am Ende war Willinon einen Augenblick lang nachdenklich erschienen. Dann jedoch hatte er geantwortet: »Aber die Leute lieben Listen!«
Damit hatte er vermutlich sogar recht. Eine Liste verkaufte sich besser als achthundert unsortierte Einzelbewertungen. Pressevertreter mochten so etwas, sie konnten daraus eine Bildergalerie für ihre Internetseite basteln. Trotzdem fühlte es sich falsch an.
Ein unbekannter Mann kam auf sie zu. Valérie erwiderte seinen Blick, unterdrückte den Impuls, ihm zuzulächeln. Man musste die Typen nicht auch noch ermuntern, schon gar nicht solche wie den Mittvierziger, der sich da heranpirschte. Bereits bevor der Kerl den Mund aufmachte, war ihr klar, dass er gerne eine Frau kennenlernen wollte, die nur für die Party hier war. Eine, die später mit ins Hotel kam. Anscheinend glaubte er, dass sie diese Frau sei. Da hatte er sich allerdings geschnitten.
Er sah nicht einmal übel aus. Schmal geschnittener schwarzer Anzug, tiefbraune, intelligent dreinblickende Augen, glattrasiert. Vor allem Letzteres war ja inzwischen eine Rarität. Valérie musste immer wieder feststellen, dass es viele Bärte gab, aber wenig Männer.
Noch wäre genug Zeit geblieben, die Flucht zu ergreifen, doch sie blieb, wo sie war. Sie würde den schönen Mann benutzen, allerdings nicht so, wie er sich das vorstellte. Aufgrund seines gut geschnittenen Anzugs tippte sie auf Europäer. Er war nicht sehr groß. Spanier vielleicht, oder gar Franzose?
»Guten Abend, Mrs Gabin«, sagte er. Sein Akzent war eindeutig amerikanisch. Keine Zigarette, dachte sie.
»Guten Abend, Mister …«
»Joe Coltelli, angenehm.«
Unter seinem Hemd, dessen beide obere Knöpfe geöffnet waren, lugte ein Tattoo hervor. Außerdem fiel ihr auf, dass er eine ziemlich teure Schweizer Uhr trug.
»Sie sind das erste Mal in Red Bluff, nehme ich an?«
»Das stimmt.«
»Dachte ich mir. Hierhin kommt man nicht, wenn man keinen guten Grund hat.«
»Und Sie?«, fragte Valérie.
»Ich komme tatsächlich von hier, aus der Nähe.«
Coltelli deutete auf Valéries leeres Glas.
»Kann ich Ihnen was bringen?«
»Vielleicht noch einen Weißwein, danke.«
Er lächelte, nickte ihr zu und verschwand in der Menge.
Valérie blickte sich um. Das »Milas« lag am Rande von Red Bluff, nahe dem Sacramento River, in einem zweistöckigen, rechteckigen Gebäude. Die Einrichtung war warm und schlicht, helle Hölzer und Erdfarben, kaum Glas oder Metall. Im oberen Stockwerk befand sich das Restaurant, darunter eine Weinbar. In einem kleinen Park, der das Anwesen umgab, standen mehrere Pavillons, die man für Veranstaltungen mieten konnte.
In einem davon waren provisorische Büros für die Mitarbeiter von gabin.com sowie die Presse eingerichtet worden. Kurz erwog Valérie, das Restaurant zu verlassen und dorthin zu gehen. Zwar hatte sie im Pressezentrum nichts zu erledigen, aber die Aussicht, den vielen Menschen und dem Trubel zu entkommen, und sei es nur für zehn Minuten, erschien ihr verlockend.
Eine Männerhand hielt ihr ein Glas Wein vor die Nase.
»Danke«, sagte sie, »sehr freundlich.«
»Sie sind die Gabin-Erbin, oder?«
»Die Letzte meiner Art.«
»Ich mag Ihren Humor. Ich besitze übrigens mehrere der blauen Bücher, ich war immer ein großer Fan.«
Valérie versuchte, das Thema zu wechseln. Am besten, sie fragte ihn nach seinem Job. Männer redeten gerne über ihre Arbeit.
»Das freut mich. Und was machen Sie so, Joe?«
»Ich bin Farmer.«
»Sie sehen nicht wie einer aus.«
Er schaute amüsiert.
»Wie sehen die denn aus?«
»Burschikoser.«
»Ich habe auch Gummistiefel, wenn Sie das meinen. Aber ehrlich gesagt bin ich selten draußen auf dem Feld, zumindest nicht, um mit den Händen zu arbeiten. Ich bin eher ein Manager.«
Coltelli reichte ihr eine Visitenkarte. Darauf stand: »Golden Acres. Joe Coltelli, CEO.«
»Was bauen Sie denn an?«
»Äpfel.«
»Nur Äpfel?«
»Hundertzwanzig Hektar, das meiste davon Granny Smith.«
Valérie war bewusst, dass sie sich im Central Valley befand, einer der weltweit größten Anbauregionen für Obst und Früchte. Auf dem Weg hierher war sie an Feldern vorbeigefahren, auf denen Bäume und Sträucher in Reih und Glied standen, bis zum Horizont.
»Vermutlich alles automatisiert?«
»So ist es, Valérie.« Er sprach es ›Wällärie‹. »Es gibt natürlich noch ein paar Leute, die die Fahrzeuge fahren. Aber nicht mehr lange.«
»Sie meinen, die fahren bald von selbst?«
»Fahren von selbst, sprühen von selbst, ernten von selbst, ja.«
»Ich habe auf der Fahrt hierher ziemlich viele Bäume gesehen.«
Coltelli nickte.
»Das sind Mandelbäume. Mandeln sind das große Ding. Die Nachfrage ist riesig.«
Coltelli nippte an seinem Wein, lächelte. Er schien sich auf etwas vorzubereiten. Nahm er etwa jetzt schon seinen Mut zusammen? Valérie hatte erwartet, dass er zunächst versuchen würde, ihr noch ein paar Gläser Weißwein zu verabreichen.
»Ich wollte fragen, ob Sie mit rauskommen.«
Es war halb neun. Die Sonne war bereits vor mehreren Stunden untergegangen. Rund um das »Milas« gab es außer dem kleinen Park so gut wie nichts. Schlug er ihr gerade vor, irgendwo ins Gebüsch zu gehen?
An ihrem Gesichtsausdruck schien Coltelli zu erkennen, dass er sich missverständlich ausgedrückt hatte.
»Raus auf die Terrasse. Ich habe gesehen, dass Sie rauchen.«
So wie es aussah, kam sie doch noch zu ihrer Zigarette. Eine Stimme in ihrem Kopf schalt sie. Dies verstieß gegen die Regeln, die sie selbst aufgestellt hatte. Eine andere Stimme wies sie darauf hin, dass es unhöflich wäre, den Mann allein rauchen zu lassen.
Sie traten hinaus auf die Terrasse. In einiger Entfernung wand sich der Sacramento River durch die Landschaft; über ihnen waren Sterne zu sehen. Coltelli holte eine Schachtel Lucky Strike hervor, bot ihr eine an.
»Ich habe selbst, danke.«
Coltelli gab ihr Feuer. Valérie sah sich um. Sie waren keineswegs allein auf der großen Terrasse, schienen jedoch die einzigen Raucher zu sein.
»Die Letzten unserer Art«, sagte Coltelli.
»Wie meinen Sie das?«
»Das haben Sie vorhin gesagt, bezogen auf die Gabin-Familie. Aber ich meinte wegen der Zigaretten.«
»Ja, das stimmt wohl. Hier raucht wirklich keiner mehr.«
»Ich habe gehört, in Frankreich ist das noch anders?«
»Ein wenig. Aber es geht in die gleiche Richtung.«
Aus dem Innenbereich des Restaurants vernahm Valérie einen Glockenton. Das Dinner begann in wenigen Minuten. Sie war nicht unglücklich über die Unterbrechung. Coltelli hatte sich zwar als weniger aufdringlich erwiesen als befürchtet, doch eigentlich wollte sie mit niemandem reden. Daraus würde an solch einem Abend nichts werden, später standen Gespräche mit Köchen, Honoratioren und Pressevertretern an. Aber gerade deshalb galt es, sich die Kräfte einzuteilen. Anders als ihr bisweilen sehr mundfauler Freund hatte Valérie normalerweise kein Problem damit, stundenlang mit Leuten zu plaudern. An diesem Abend fühlte sie sich jedoch wie ein Zuschauer auf ihrer eigenen Veranstaltung. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten rätselte Valérie, warum sie sich all das antat. Ihr Vertrag mit der Delish Group sah vor, dass sie Willinon und seinen Leuten als »strategische Beraterin« zur Verfügung stand und einmal im Monat eine Kolumne schrieb. Alles andere war streng genommen optional. Sie konnte die meisten Aufgaben von ihrem Apartment in Paris aus erledigen oder von Xaviers Küchentisch. Es gab keinen Grund, sich dermaßen ins Zeug zu legen. Sie hatte genug Geld. Aber wenn man seit zwanzig Jahren hochtourig fuhr, war umschalten nicht so einfach.
»Vielleicht nach der Veranstaltung?«
»Wie bitte? Entschuldigung, ich habe das gerade akustisch nicht verstanden, Mr Coltelli.«
»Ich sagte, ich sitze auf einem der billigen Plätze. Aber vielleicht sehen wir uns nach dem Essen auf eine weitere Zigarette?«
»Gerne«, sagte sie.
Valérie drückte ihre Gauloises aus, begab sich zu ihrem Platz. Im Hauptraum des »Milas« standen etwa zwanzig große runde Tische. An ihrem saßen bereits Willinon, sein Assistent Brad, die Moderatorin sowie einige handverlesene Journalisten. Valérie atmete tief durch, setzte sich und lächelte ihren Tischnachbarn zu, fügte sich in das Unvermeidliche.
4
Es war fast zwei, als Kieffer das »Deux Eglises« zusperrte und sich auf den Heimweg machte. Einige Gäste hatten Sitzfleisch bewiesen und immer wieder Wein nachgeordert. Kurz überlegte er, mit dem Auto zu fahren, entschied sich jedoch dagegen. Besser, er ging zu Fuß, schließlich war das der einzige Sport, den er trieb. Kieffer lief über den Parkplatz, vorbei an dem Schild mit den beiden stilisierten Kirchtürmen. Er wandte sich nach links und nahm die den Hang hinabführende Rue Jules Wilhelm. Nach einigen Minuten erreichte er die Allée Mansfeld. Ab hier führte sein Weg an der Alzette entlang, dem Flüsschen, das sich durch die gesamte Luxemburger Unterstadt schlängelte. Über Jahrmillionen hatte sich die Uelzecht, wie sie auf Luxemburgisch hieß, durch den Felsen gefressen. Das Resultat war eine Art Canyon, in dem die Quartiere der ville basse lagen.
Kieffer lief weiter. Aus einiger Entfernung vernahm er Musik. Das früher recht verschlafene Clausen war in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot des Nachtlebens geworden. Als Kieffer das ehemalige Gelände der Mousel-Brauerei erreichte, sah er einige junge Männer rauchend vor dem Eingang stehen. Sie trugen noch immer ihre Büroklamotten, minus der Schlipse.
Durch das Tor konnte er in den Innenhof der sogenannten Rives de Clausen sehen. Die meisten Läden hatten bereits zu oder schlossen gerade. Einige Partypeople schien das nicht zu kümmern. Gut zwei Dutzend junge Frauen und Männer in unterschiedlichen Zuständen der Trunkenheit standen in dem lang gezogenen Innenhof oder saßen an dessen Wände gelehnt auf dem Boden. Kieffer ging weiter und gelangte zu einer Brücke, die über die Alzette führte. Davor gab es eine kleine Treppe, die er hinabstieg. Der Koch lief rechts des Flusses einen Fußgängerweg entlang. Nach einigen Minuten passierte er ein Eisenbahnviadukt, das gut vierzig Meter über der Alzette aufragte.
Früher, bevor das Faubourg Clausen ein In-Viertel geworden war, hatten dort bettelarme Leute gewohnt. Die besseren Stände Luxemburgs hatten seinerzeit alles, was für die feine Oberstadt zu schmutzig oder unansehnlich war, in den Talkessel der Unterstadt verbannt – Brauereien, Gerbereien, Manufakturen. Dass den Bewohnern zusätzlich die Eisenbahn über die Köpfe ratterte, war da kaum noch ins Gewicht gefallen.
Der Uferpfad bog nach rechts ab, endete vor der alten Stadtmauer. Über eine Treppe gelangte Kieffer auf einen Wehrgang, dann querte er die Alzette. Nun befand er sich in Grund, einem weiteren Unterstadtquartier. Dort kam er an der alten Neumünsterabtei vorbei.
Kurz vor der Ulrichsbrücke blieb Kieffer stehen, suchte nach Zigaretten. Er musste alle Taschen seiner Lederjacke abklopfen, bis er sie fand. Als er sich eine angesteckt hatte und gerade weitergehen wollte, fiel ihm etwas auf. Erneut durchsuchte er die Taschen. Sein Handy fehlte. Vermutlich hatte er es im Restaurant liegen lassen. Kurz erwog der Koch, zurückzulaufen, entschied sich aber dagegen. Er wurde allmählich wie Valérie, die sich nicht einmal im Bett von ihrem Telefon trennte – mit der fadenscheinigen Ausrede, sie benutze es als Wecker.
Kieffer überquerte den Fluss erneut und bog in die Rue Saint Ulric ein, im Volksmund Tilleschgaass genannt. Hier lag das Haus, das er von seinen Eltern geerbt hatte. Der Garten grenzte direkt an die Alzette. Als seine nicht sonderlich begüterte Familie das Anwesen erwarb, war diese Wohnlage nicht sonderlich beliebt gewesen. In Grund hatte sich das Luxemburger Gefängnis befunden, und die Redewendung »am Gronn sinn« bedeutete, dass man hinter schwedischen Gardinen saß. Inzwischen war der Knast verschwunden und der Quadratmeterpreis explodiert. Ständig steckten ihm irgendwelche Makler Flyer in den Briefkasten. Der Koch warf sie stets ungelesen in den Müll.
Er sperrte auf, ging durch den Flur in die Küche. Dort holte er sich ein Bier aus dem Kühlschrank und suchte nach etwas Essbarem. Für gewöhnlich war kaum etwas da, schließlich gab es an seinem Arbeitsplatz genug Verpflegung. Heute hatte er im »Deux Eglises« einen Rest lauwarmes Biwwelamoud mit Brot gegessen. Nun verspürte er allerdings schon wieder Hunger.
Da er nichts anderes fand, behalf Kieffer sich mit einer Packung Erdnüsse. Während er auf der Küchenbank saß, sein Bier trank und eine weitere Ducal rauchte, vermisste er sein Telefon. Gerne hätte er nachgeschaut, ob Valérie neue Bilder gepostet oder ihm eine Nachricht geschrieben hatte.
Nach einer Weile erhob er sich und ging zu der Tür, die in den Garten führte. Es hatte angefangen, zu schneien, keine dicken Flocken, sondern feiner Graupel. Es war, als schüttete jemand Puderzucker über der Unterstadt aus. Aus irgendeinem Grund machte ihn der Anblick schläfrig. Kieffer beschloss, ins Bett zu gehen. Nach wenigen Minuten schlief er ein.
5
Valérie wollte nur noch ins Bett. Das Dinner und die Präsentation der Blue List hatten bis ein Uhr gedauert. Coltelli war nicht mehr aufgetaucht – vielleicht hatte er ihr Desinteresse richtig gedeutet und war andererseits fündig geworden.
Valérie ging zu ihrem Mietwagen und stieg ein. Ihr Hotel befand sich eine halbe Stunde weiter südlich, nahe der Interstate. Kurz überlegte Valérie, ob sie das Navi benötigte, beschloss dann aber, dass sie die Autobahn auch so finden würde. Wenige Minuten später hatte sie Red Bluff hinter sich gelassen. Zu beiden Seiten der Straße standen jene Bäume mit den weißen Blüten, die sie bereits auf dem Hinweg gesehen hatte. Seit ihrem Gespräch mit Coltelli wusste sie, dass es sich um Mandelbäume handelte. Die Straße war unbeleuchtet, nur das Mondlicht fiel auf die ausgedehnten Plantagen. Als Valérie nach einiger Zeit noch immer an Baumreihen vorbeifuhr, erkannte sie, dass sie sich verfranst hatte. Die Abzweigung zur Interstate hätte längst kommen müssen.
Einen Fluch unterdrückend, bog sie in einen schmalen Versorgungsweg ein und aktivierte das Navi. Als sie die Adresse ihres Hotels eingegeben hatte, fiel Valéries Blick auf einige seltsam aussehende Kästen. Sie standen jenseits der Hauptstraße zwischen den Bäumen. Die Neugier siegte über ihre Müdigkeit. Valérie stieg aus, um sie sich näher anzusehen. Als sie die Straße überquert hatte, war ihr mulmig zumute. Sie war mutterseelenallein hier draußen. Was, wenn jemand vorbeifuhr und sie sah? Man konnte nicht wissen, was für Leute sich nachts in dieser Gegend herumtrieben.
Rasch erreichte sie die ersten Bäume. Diese waren an die fünf Meter hoch und besaßen einen kurzen Stamm, der sich nach oben rasch in viele schlanke Äste auffächerte. Aus der Ferne wirkte es, als wären Letztere von Raureif bedeckt. Erst als sie sich näherte, wurden aus den grauweißen Tupfern Mandelblüten. Die Bäume waren voll davon. Valérie lief weiter, bis sie die Kästen erreichte. Es handelte sich ganz offensichtlich um hölzerne Boxen, jede davon in etwa so groß wie ein Umzugskarton. Jeweils acht davon waren auf einer Palette gestapelt, weswegen sie aus der Ferne größer gewirkt hatten. Insgesamt sah sie ein halbes Dutzend Paletten. Valérie wollte gerade näher herantreten, da vernahm sie das Summen.
Jemand hatte Bienenstöcke hier abgeladen, um die Mandelbäume zu bestäuben. Valérie hatte zuvor nicht darüber nachgedacht, aber natürlich war es logisch, dass all diese Blüten bestäubt werden mussten. Das Gleiche galt für Coltellis Apfelbäume und vieles andere, was im Central Valley angebaut wurde – Birnen, Kirschen, Melonen, Brokkoli.
Bisher war sie davon ausgegangen, dass die Bienen irgendwie von selbst zu den Blüten fanden. Nun, da sie darüber nachdachte, erschien ihr das unrealistisch. Diese Plantage war eine Monokultur, nur Bäume, sonst nichts. Jemand hatte die Bienenvölker hier abgeladen, damit sie die umliegenden Blüten anflogen. Valerie leuchtete mit dem Handy auf die Seite einer der Kisten. Darauf stand: »D.W.«.
Valérie löschte das Licht, blickte nach oben. Es war unglaublich, wie viele Sterne man hier draußen sah. Der wolkenlose Himmel, dazu die im Mondlicht silbrig schimmernden Mandelbäume – das alles war atemberaubend. Es war außerdem ein hervorragendes Fotomotiv für ihren Instagram-Account.
Valérie probierte verschiedene Einstellungen aus. Der Winkel passte nicht. Wenn sie von einer erhöhten Position aus fotografierte, wäre das Ergebnis zweifelsohne besser. Kurz überlegte sie, auf die Kisten zu steigen. Aber möglicherweise würden ihr deren Bewohnerinnen das übel nehmen. Stattdessen ging sie zurück zu ihrem Auto, kletterte auf dessen Dach. Rasch schoss sie einige Fotos.
Als sie danach eine Zigarette rauchend durch ihre Bilder wischte und überlegte, welche sie hochladen sollte, vernahm Valérie ein Motorengeräusch. Es war still hier draußen, deshalb konnte sie den Wagen hören, obwohl er noch ein ganzes Stück entfernt sein musste. Valérie steckte ihr Handy weg und vergewisserte sich, dass die Beleuchtung ihres Autos aus war. Dann wartete sie.
Ein Truck kam die Straße hoch. Auf seiner Ladefläche war schweres Gerät festgezurrt, es sah aus wie ein kleiner Bagger. Valérie fiel auf, dass der Laster die Scheinwerfer abgeblendet hatte und recht langsam fuhr. Er bog auf einen der kleinen Wege ab, die in regelmäßigen Abständen von der asphaltierten Straße in die Plantage hineinführten. Mit einem Quietschen hielt der Truck, in etwa dort, wo sich die Bienenstöcke befanden.
Valérie löste sich aus dem Schatten des Mandelbaums, hinter dessen Stamm sie gestanden hatte, und bewegte sich vorsichtig in Richtung Straße, um besser sehen zu können. Als Scheinwerfer auf dem Dach der Kabine des Trucks aufflammten, erstarrte sie. Erst nach einer Schrecksekunde begriff Valérie, dass der Lichtkegel sie nicht erfasst hatte. Dennoch suchte sie erneut Deckung hinter einem der Bäume.
Zwei Männer waren ausgestiegen und machten sich an der Ladeklappe zu schaffen. Sie fuhren eine Rampe aus, damit das kleine Fahrzeug von der Ladefläche hinabrollen konnte. Valérie sah, dass es sich um einen Gabelstapler handelte.
Vielleicht kamen Bienentransporteure immer nachts, damit der am Tag stattfindende Plantagenbetrieb nicht gestört wurde. Doch je länger sie darüber nachdachte, desto unwahrscheinlicher erschien ihr dies. Die Arbeit früh morgens oder spät abends zu erledigen, ergab möglicherweise Sinn, aber um halb zwei in der Nacht?
Der Gabelstapler fuhr zu den Kisten und hob eine der Paletten hoch. Nach höchstens fünfzehn Minuten war die Sache gelaufen. Alle Bienenstöcke waren auf der Ladefläche verstaut, der Gabelstapler fuhr die Rampe hinauf. Zum Schluss breiteten die Männer eine Plane über den Bienenstöcken aus. Dann kletterten sie ins Fahrerhäuschen und starteten den Motor.
Valérie eilte zurück zu ihrem Auto. Sie wartete, bis der Laster sich ein Stück entfernt hatte. Erst dann startete sie den Wagen, fuhr zurück zur Straße. In einiger Entfernung konnte sie die Rückleuchten des Bienentrucks ausmachen. Mit der Zündung war auch Valéries Navi angesprungen und wies sie an, links abzubiegen. Sie fuhr stattdessen rechts, dem Laster hinterher.
Nach kurzer Zeit wechselte der Truck auf eine größere Straße, die der Beschilderung zufolge Richtung Yuba City führte. Nach etwa einer halben Stunde bog der Laster ab. Immer noch sah Valérie überall Mandelbäume. Vermutlich hatte sie sich geirrt, und die Männer brachten die Bienen schlichtweg an eine andere Stelle. Vielleicht musste es nachts passieren, weil die Bienen dann schliefen?
Der Laster blinkte. In der Dunkelheit konnte Valérie nicht viel erkennen, es gab keine Schilder, die eine Abzweigung anzeigten. Als der Laster abbog, huschten seine Scheinwerfer über eine schmale Staubpiste und ein Gebäude. Dem Umriss nach zu urteilen, handelte es sich um ein Gehöft. Valérie fuhr weiter, vorbei an Laster und Gebäude und hielt erst nach gut hundert Metern am Straßenrand.
Sie holte ihr Handy hervor, überlegte. Sollte sie die Polizei rufen? Sie überschlug den Zeitunterschied zwischen Kalifornien und Luxemburg, wählte Xaviers Nummer. Es klingelte ein paarmal, dann sprang die Mailbox an. Bei ihrem Freund war es kurz vor elf Uhr morgens. Wenn seine Restaurantschicht am Vorabend lang gewesen war, lag er vielleicht noch im Bett. Oder, und das schien ihr wahrscheinlicher, sein Handy befand sich wieder einmal im Kühlschrank.
Früher, als Xavier noch ein uraltes finnisches Tastentelefon besessen hatte, war er besser erreichbar gewesen. Seit er mit einem Smartphone ausgerüstet war, gestaltete sich die Sache schwieriger. Auf Whatsapps oder Sprachnachrichten antwortete er bestenfalls sporadisch. Zudem beschwerte er sich, weil »das Scheißteil dauernd piept«. Valérie hatte versucht, ihm zu erklären, wie man ungewünschte Benachrichtigungen abstellte, aber Xavier hatte das nicht verstanden – genauer gesagt war er nicht willens, sich mit dem Gerät auseinanderzusetzen. Seine Lösung bestand stattdessen darin, das Handy in den Kühlschrank zu legen. Dessen Isolierung sorgte dafür, dass kein Ton an Xaviers empfindliches Ohr drang.
Valérie versuchte es ein zweites Mal. Wieder bekam sie nur die Mailbox.
»Hallo Süßer, ruf mich bitte mal zurück. Ich bin hier in Kalifornien und habe was beobachtet, ich glaube, ich brauche deine Hilfe.«
Sie legte auf, stieg aus. Auf dem Gehöft brannte inzwischen Licht. Der Gabelstapler war wieder im Einsatz. Valérie sah sich um. Rechts der Straße erstreckten sich Felder, allerdings keine mit Mandelbäumen. Sie tippte auf Äpfel oder Birnen, war sich aber nicht sicher.
Schon war sie zwischen den Obstbäumen und lief auf das Gehöft zu. Es bestand, wie sie nun sehen konnte, aus einem Haupthaus, einem kleineren Nebengebäude sowie einer großen Scheune. Über das Dach des Haupthauses spannte sich eine rissige Plastikplane, die mit Sandsäcken beschwert war. Der Hof stand voller Gerümpel und Müll.
Sie war noch gut dreißig Meter von dem rostigen Maschendrahtzaun entfernt, der das Gehöft umfriedete. Hinter einem der Bäume ging sie in Deckung. Die Bienenstöcke waren abgeladen und in die Scheune gebracht worden, deren Tore offen standen. Im Inneren brannte Licht. Valérie konnte die beiden Männer sehen. Einer der beiden verteilte mit einer Art Sprühflasche Rauch über den Kisten, vermutlich um die Bienen abzuschrecken. Der andere machte sich mit einem Stemmeisen an einer der Boxen zu schaffen. Weiter hinten in der Scheune konnte sie im Halbdunkel weitere Behälter in verschiedenen Farben ausmachen, vermutlich ebenfalls Bienenstöcke. Außerdem standen an der Rückwand Fässer aus Metall.
Valérie erwog, die seltsame Szene zu filmen, entschied sich jedoch dagegen. Die Gesichter der beiden würde sie ohnehin nicht auf die Kamera bannen können, sie trugen Imkerschleier. Deshalb blieb sie, wo sie war, und schaute weiter zu.
Einer der beiden hatte die Kiste inzwischen aufgestemmt und begann, die senkrecht im Stock hängenden Wabenrahmen herauszuziehen. Er begutachtete einen nach dem anderen. Unzählige Bienen umschwirrten die Männer.
Der Mann mit dem Stemmeisen rief seinem Kompagnon etwas zu. Der nickte, produzierte mithilfe seiner Räucherbüchse eine weitere Schwade und machte sich dann daran, die Torflügel der Scheune zu schließen.
Valérie atmete tief durch. Um mehr mitzubekommen, musste sie näher heran. Aber das schien ihr gefährlich. Wer wusste schon, wozu diese Kerle imstande waren? Sie wartete einige Minuten, doch das Tor blieb geschlossen. Valérie lief vorsichtig um die Farm herum. Doch außer ein paar verlassenen Hühnerställen war nichts zu sehen.
Sie gähnte. Auf einmal konnte sie sich vor Müdigkeit kaum noch auf den Beinen halten. Valérie lief zurück zu ihrem Wagen, programmierte das Navigationssystem neu. Als es die Route berechnete, stöhnte sie leise auf. Sie hatte sich weiter von ihrem ursprünglichen Ziel entfernt als angenommen. Das Navi gab die Fahrzeit mit fast anderthalb Stunden an. Vor vier Uhr würde sie nicht im Bett sein.
Während sie fuhr, überlegte Valérie, was ihr dieser Abstecher eingebracht hatte. Vermutlich überhaupt nichts – weder taugte die Sache als Thema für ihre Kolumne, noch gab es etwas, womit sie zur Polizei gehen konnte.
Während der Fahrt versuchte Valérie erneut, Xavier zu erreichen. Bei ihrer Entscheidung vermochte er ihr zwar nicht mehr zu helfen, aber vielleicht konnte er sie ein bisschen wach halten, damit sie nicht im Straßengraben landete. Wieder erreichte sie nur seine Mailbox. Verstimmt legte sie auf.
6
Als Kieffer am nächsten Morgen aus dem Schlafzimmerfenster blickte, waren sein Garten und die Dächer der umliegenden Häuser weiß überpudert. Er zog sich an und ging hinunter in die Küche. Da sich die Vorratssituation über Nacht nicht verbessert hatte, beschloss er, im »Deux Eglises« zu frühstücken. Zu Fuß lief er zum Restaurant, entlang der Alzette, an deren Ufer sich stellenweise ein Eisfilm gebildet hatte.
Als er das »Deux Eglises« erreichte, war er durchgefroren. Kieffer warf die Kaffeemaschine an. Kurz darauf saß er, die Hände an der Milchkaffeeschale wärmend, an der Theke. Sein Handy fiel ihm wieder ein, doch weder hinter der Bar noch im Büro fand er das Gerät. Erst nach einigem Suchen tauchte es in einer Ablage des Barkühlschranks auf, zwischen zwei Tafeln Schokolade. Er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, es dort hingetan zu haben.
Valérie hatte angerufen und ihm auf die Box gesprochen. Dort waren auch noch andere Nachrichten, aber die interessierten ihn zunächst nicht. Während er seinen Milchkaffee trank, hörte er Valéries Nachricht ab, sprang zurück zum Anfang, hörte sie erneut. Es tat gut, ihre Stimme zu hören. Valérie klang müde und gleichzeitig aufgeregt. Kieffer fragte sich, worum es ging. Er versuchte, die Zeitverschiebung auszurechnen. In Kalifornien musste es bereits Abend sein. Betrug die Differenz acht Stunden? Oder waren es sogar zehn?
Gerade wollte der Koch sie anrufen, als es schellte. Er legte das Telefon beiseite und ging zum Haupteingang. Durch die Bleiglasscheibe neben der Tür konnte er verschwommen zwei Personen ausmachen. Sie trugen Uniformen.
»Machen Sie bitte auf«, rief jemand. »Polizei.«
Kieffer öffnete die Tür. Davor standen zwei Streifenpolizisten, ein Mann und eine Frau.
»Monsieur Kieffer?«, fragte die Frau.
»Ja. Moien. Was ist los?«
»Unsere Kollegin hat versucht, Sie zu erreichen, Kommissarin Lobato.«
Commissaire-en-chef Joana Galhardo Lobato arbeitete bei der Luxemburger Mordkommission. Kieffer hatte in der Vergangenheit bereits mit ihr zu tun gehabt.
»Hat sie? Habe ich gar nicht gesehen, Handy verlegt. Was gibt es denn?«
»Es geht um eine aktuelle Ermittlung.«
»Genauer geht’s nicht?«, fragte er.
»Ein Todesfall«, warf der männliche Beamte ein. Dabei deutete er mit dem Kopf Richtung Hang. »Auf dem Kirchberg.«
»Okay. Was habe ich damit zu tun?«
»Die Frau Kommissarin würde Ihnen dazu gerne ein paar Fragen stellen. Können Sie gleich mitkommen?«
»Aufs Revier?«
»Nein, ins Bankenviertel. Sie ist noch vor Ort.«
Kieffer hatte keine Lust. Andererseits lag das Bankenviertel nur fünf Minuten entfernt. Falls man ihn später ins Hauptquartier der Police Judiciaire nach Hamm zitierte, würde es ihn mehr Zeit kosten.
»Fahren Sie mich danach zurück?«
Der Beamte nickte.
»Okay, dann mal los. Ich hole nur schnell meine Jacke.«
Sie stiegen auf dem Parkplatz in einen Streifenwagen und fuhren den Hang hinauf, um nach einigen Hundert Metern den Malakoff-Turm zu passieren, einen der Überreste der alten Stadtmauer. Kaum fünf Minuten später befanden sie sich im Finanzviertel. Der Streifenwagen hielt und Kieffer sah eine Straßensperre, Einsatzfahrzeuge, verfroren dreinschauende Polizisten. Bei dem Gebäude, das sie bewachten, handelte es sich um einen Glasklotz. Mit etwas Wohlwollen konnte man seine Architektur funktional nennen. Kieffer fand ihn speihässlich. Über dem Eingang stand in großen silbernen Lettern »Silverstein Green«.
Kieffer stieg aus, sah sich um. Schaulustige aus den umliegenden Gebäuden beobachteten die Szenerie. Ihm fiel eine Person in einem weißen Overall auf. Sie befand sich auf dem Dach des direkt angrenzenden Nachbarhauses. Während das Silverstein-Aquarium acht Stockwerke besaß, hatte das daneben liegende Bürogebäude nur vier. Der Mann in dem Overall stand am Rande des Flachdachs, schaute hinab zur Straße. War er von der Spurensicherung?
»Hier entlang, Monsieur«, sagte der Beamte.
Kieffer folgte dem Polizisten in die Empfangshalle von Silverstein Green. In den Ecken und vor einer Kaffeebar tuschelten Angestellte und schauten besorgt.
»Sie kommt gleich«, sagte der Wachtmeister.
Kurz darauf öffnete sich die Tür des Fahrstuhls, und commissaire-en-chef Joana Galhardo Lobato trat heraus. Mürrisch schaute die junge Frau sich um. Ihr Blick blieb an Kieffer hängen. Falls dies ihre Laune hob, verbarg sie es gut. Der Koch hatte nichts anderes erwartet. Er konnte sich nicht erinnern, Lobato jemals lächeln gesehen zu haben.
Die Kommissarin trug Jeans und Winterstiefel, dazu einen schwarzen Daunenparka. Sie wirkte ein wenig durchgefroren, ihre ansonsten olivfarbene Haut schien bleich.
»Moien, Kommissärin«, sagte Kieffer.
»Moien, Haer Kieffer. Schön, dass Sie es einrichten konnten.«
Während der Koch noch überlegte, ob der Satz sarkastisch gemeint war, sagte Lobato: »Kommen Sie, wir gehen in den Konferenzraum, den die Bank uns zur Verfügung gestellt hat. Hier unten sind zu viele Leute.«
Die Kommissarin deutete in Richtung Fahrstuhl. Kieffer kannte Lobato inzwischen gut genug, um nicht zu fragen, worum es ging. Sie würde es ihm erklären, wenn und wann sie wollte.
Kurz darauf betraten sie einen Konferenzraum im obersten Stock. Soweit Kieffer wusste, war Silverstein eine traditionsreiche Wall-Street-Bank. Entsprechend edel war die Einrichtung – dunkles Holz, Designermöbel. Er ließ sich in einen Ledersessel fallen. Lobato ging zu einem Kaffeeautomaten in der Ecke des Raums.
»Sie auch?«, fragte sie.
»Gerne.«
Während sie an der Maschine zugange war, schaute Kieffer aus dem Fenster. In der Ferne sah man die Türme des Gerichtshofs, in der Nähe die Avenue Kennedy, auf der sich der Verkehr staute. Dank der bodentiefen Glaspaneele konnte er zudem das Dach des Nebengebäudes betrachten. Dort waren Männer dabei, eine sargähnliche Kiste über das Dach zu tragen. Zwei weitere Personen, beide in weißen Overalls, sahen ihnen zu.
Die Kommissarin kam zum Tisch, stellte ihm einen Cappuccino hin, setzte sich in den Sessel gegenüber. Fest umschlossen ihre Hände die Tasse.
»Sie sind ja ganz blaugefroren.«
»Zieht da oben«, erwiderte sie.
Fragend deutete Kieffer auf das Dach des Nachbargebäudes.
»Auf diesem.«
Der Koch erwiderte nichts, sondern nippte stattdessen an seinem Kaffee.
»Haer Kieffer, kennen Sie einen Pol Schneider?«
»Ja. Was ist mit ihm?«
»Er ist tot.«
Kieffer kam halb aus dem Sitz hoch, starrte in Richtung des benachbarten Dachs. Die Männer mit der Bahre waren inzwischen verschwunden.
»Das war er?«
»Ja. Er lag da schon eine Weile.«
»Und wie ist er gestorben?«
»Der Mann war hier«, sie zeigte gen Decke, »auf dem Dach. Er ist gefallen und drüben auf dem anderen Haus gelandet.«
»Und das ist vorher niemand aufgefallen?«
»Nein. Es war schon fast dunkel, und es hat geregnet. Erst am nächsten Tag ist jemand die Gestalt auf dem Dach aufgefallen.«
»Verstehe. Und was habe ich damit zu tun?«
»Sie kannten ihn.«
»Nicht besonders gut.«
»Wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben?«
»Kein Freund, nicht mal ein Bekannter. Na ja, das vielleicht schon. Pol managte für mich ein paar Bienenstöcke in der Unterstadt.«
»Verstehe. Und warum hat er Sie gestern angerufen?«
»Hat er?«